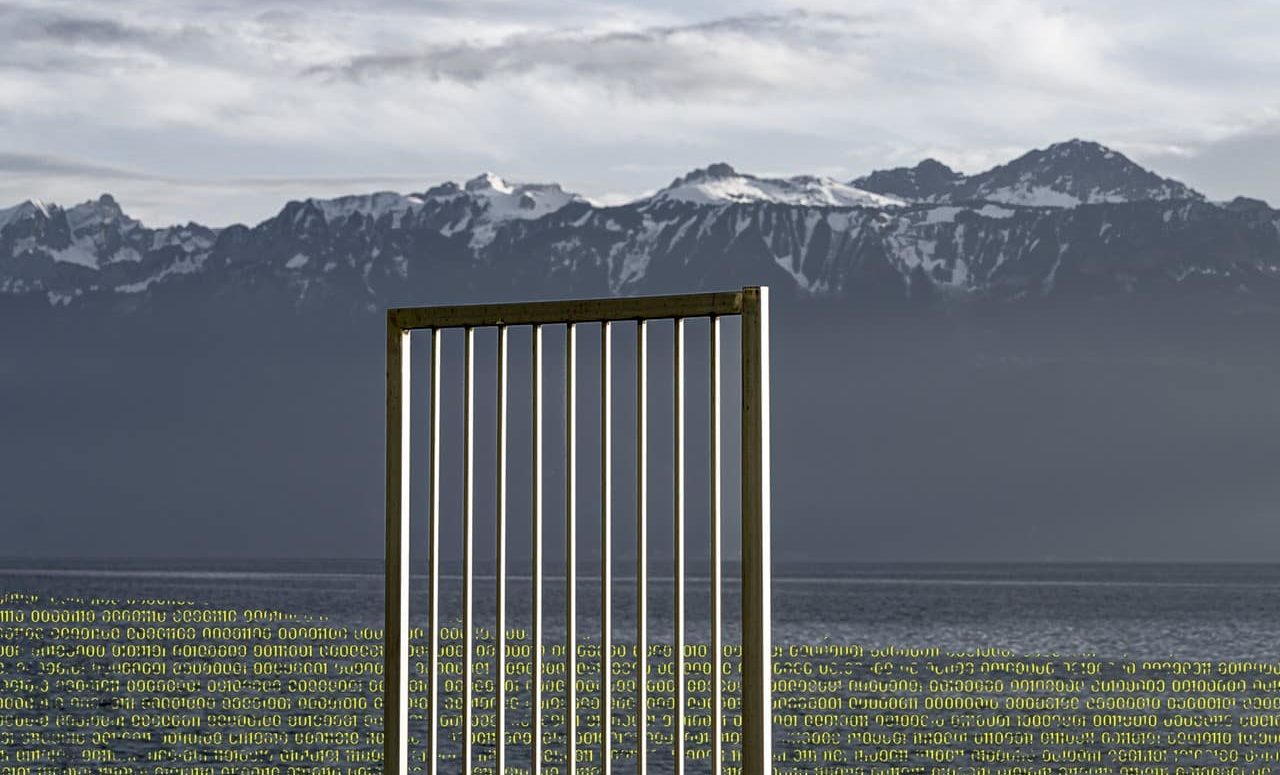Hasenfüße und Kaninchen
Eine etwas andere Sicht auf die Europawahlen vom Juni 2024
Tiermetaphern sind beliebt, um Verhaltensweisen zu beschreiben, von denen eigentlich niemand so recht weiß, wie man dies tun sollte. Sie spiegeln vielleicht auch so manchen küchenpsychologischen Versuch, gesellschaftliche und politische Zusammenhänge zu erklären. Ihr Vorteil: Sie sind ohne Kenntnis von Fachbegriffen leicht zu handhaben, weil sich alle irgendwie etwas unter den gegenüber unserer sprachlichen Hilflosigkeit wehrlosen Tieren vorstellen können und sich so in tiefster Seele bestätigt fühlen dürften, sodass weiteres Nachdenken überflüssig wird.
Für die Bewertung der Europawahlen vom Juni 2024 begebe ich mich auf das gefährliche Feld der Tiermetaphern, die genannten Tiere mögen mir alle verzeihen. Ich wage die These, dass sich vor allem SPD und Grüne mit ihrem hasenfüßigen Wahlkampf massiv geschadet haben. Sie saßen wie die sprichwörtlichen Kaninchen vor der Schlange, die sie mal explizit „Rechts“ nannten, manchmal aber auch nur mit Begriffen wie „Hass und Hetze“ adressierten. Irgendwie waren die „Rechten“ immer schneller, wie der berühmte „Igel“ im Märchen?
Für ihre Niederlagen sorgen die demokratischen Parteien schon selbst. Wer aber die Grünen mit ihrem schlechten Ergebnis, das aber immer noch auf der Ebene ihrer Ergebnisse vor der letzten Wahl liegt, wieder zur „Nischenpartei“ erklärt und die AfD, die auch nur wenige Prozent mehr erhielt, zur „Volkspartei“, oder gar das deutsche Ergebnis für typisch in ganz Europa hält, braucht Nachhilfe in Mathematik. Und in Thüringen konnte die AfD bei den Kommunalwahlen keine einzige Stichwahl für sich entscheiden. Hat da vielleicht doch der Hase mal gewonnen? Das ist keine Entwarnung, aber das eigentliche Problem liegt möglicherweise ganz woanders.
„Rechtsruck“ in Kerneuropa
Gab es den erwarteten „Rechtsruck“ im Europäischen Parlament? Die Antwort lautet: Ja und Nein. Die Fraktionen der Konservativen (EVP) und der Sozialdemokraten (S & D) blieben etwa gleich groß, die Konservativen gewannen sogar leicht. Die beiden rechten Fraktionen (EKR und ID) gewannen hinzu, die Liberalen (Renew) und die Grünen verloren. Das war aber nicht überall so.
Einen guten Überblick bieten die Korrespondent:innen der taz. In einigen Ländern bestätigten die Ergebnisse der Europawahlen die Ergebnisse vorangegangener nationaler Wahlen, so in den Niederlanden und in Italien. Sozialdemokratische Parteien verbesserten sich in den Niederlanden und in Portugal, wo sie in der Opposition sind. Die italienischen Grünen verdoppelten ihr Ergebnis, die schwedischen Grünen überholten die Schwedendemokraten, auch die lettischen Grünen gewannen hinzu. In den skandinavischen Ländern gewannen sozialdemokratische Parteien, rechtspopulistische Parteien verloren, in Dänemark verloren die regierenden Sozialdemokraten an linke Parteien. Besonders erfreulich war das Ergebnis in Polen, wo die regierende liberale KO erstmals vor der PiS lag, auch auf Kosten ihrer Koalitionspartner. In der Slowakei lag die größte Oppositionspartei, die PS, mehrere Punkte vor Ficos SMER, allerdings erhielt die rechtsextremistische REPUBLICA 12,2 Prozent. Die beiden Koalitionspartner Ficos, auch die rechtsextreme SNS, stürzten ab. In Ungarn fuhr die Regierungspartei FIDESZ nur noch 44 Prozent ein, aus dem Stand erhielt die Tisza-Partei, die sich möglicherweise sich der EVP anschließen könnte, etwa 30 Prozent, allerdings auch auf Kosten der sozialliberalen Oppositionsparteien.
Timothy Garton Ash warnte in einem Interview im Tagesspiegel: „Jetzt ist ein kritischer Moment für Europa, ein politischer Augenblick. Die Wahlerfolge der Rechten dürfen nicht zu ihrer Normalisierung beitragen. Wenn Ursula von der Leyen sagt, die Mitte habe sich gehalten, verklärt sie diese Entwicklung.“ Er wies aber auch darauf hin, dass sich die Bedrohung Europas von rechts vor allem in den Staaten der Gründungsmitglieder der EU zeige, in Deutschland, in Frankreich, in Italien, in Belgien und in den Niederlanden. Romano Prodi spitzte es in der ZEIT zu: „Das wahre Problem ist der politische Sturz in Deutschland und in Frankreich.“ Ein kritischer Punkt ist der Zusammenbruch konservativer Parteien in Italien und Frankreich, den Thomas Biebricher in seinem Buch „Mitte / Rechts“ (Berlin, Suhrkamp, 2023) analysierte. In Frankreich wird sich dies mit den angekündigten Neuwahlen noch einmal neu zuspitzen. Einen solchen Zusammenbruch haben wir in Deutschland nicht, sodass CDU und CSU nach wie vor als starke Mitte-Rechts-Parteien gelten dürfen, denen es gelungen ist, Angriffe von Rechtsaußen zu neutralisieren.
Aber was für eine Krise erleben wir? Es ist nicht unbedingt eine Krise der Demokratie, denn Demokratie ist nie zu 100 Prozent stabil, sie trägt ihr Gegenbild immer in sich. Philipp Manow formulierte in seinem Essay „(Ent-)Demokratisierung der Demokratie“ (Berlin, Suhrkamp, 2020) die These, dass wir vor allem eine Krise der Parteien erleben, eine Krise der Repräsentanz: „Parteien werden immer mehr zu Bewegungen – oder es bilden sich symbiotische Beziehungen zwischen Bewegung und Partei“. Es geht letztlich um „Kampagnenfähigkeit“. Ein Indikator könnte auch die Neigung vieler junger Leute sein, kleine Parteien zu wählen, die in Deutschland Ergebnisse von insgesamt 28 Prozent erzielten. Ein weiterer Indikator ist die seit etwa zwei Jahrzehnten in Jugendstudien festgestellte Bereitschaft junger Leute, sich für eine Sache zu engagieren, aber eben nicht in einer der klassischen Organisationen, Parteien, Gewerkschaften und Kirchen. Solche Bereitschaft zum ehrenamtlichen Engagement ist nicht unbedingt etwas Gutes, denn Bewegungen sind instabil und in ihren Einstellungen zur Demokratie oft auch heterogen, siehe Attac, Occupy, Fridays for Future, Gelbwesten, auch einige aus solchen Bewegungen hervorgegangene Parteien wie Podemos, Syriza, die Piraten.
Verspielte Glaubwürdigkeit
In Österreich und in Frankreich erreichten die rechten Parteien das erwartete gute Ergebnis. In Deutschland blieb die AfD ungeachtet ihrer Gewinne gegenüber dem Jahr 2019 hinter dem befürchteten Ergebnis. Sonderlich geschadet hatten ihr die Skandale um ihre beiden Spitzenkandidaten allerdings nicht. Eine Auswahl der Wählerwanderungen in Deutschland dokumentierte der Tagesspiegel auf der Grundlage einer dimap-Umfrage. Unter anderem verlor die SPD im Vergleich zur Bundestagswahl 2021 etwa 2,5 Millionen Wähler:innen an die Gruppe der Nicht-Wähler:innen, die Grünen etwa 540.000 Menschen. Etwa 580.000 wechselten von der SPD zum BSW, 570.000 zur AfD.
Bei den anstehenden nationalen Wahlen (beziehungsweise die drei Landtagswahlen im deutschen Osten) könnten die rechten Parteien die in der Europawahl erzielten Ergebnisse bestätigen oder sogar ausbauen. Frankreich leidet vor allem darunter, dass die ehemals starken Parteien der Sozialisten und der Konservativen (die oft genug den Namen wechselten) marginalisiert wurden, sodass es letztlich nur heißt: Emmanuel Macron gegen Marine Le Pen? Aber wer weiß, wer 2027 gegen Marine Le Pen kandidieren wird? Emmanuel Macron kannte zwei Jahre vor seiner ersten Wahl fast niemand. Quereinsteiger haben gute Chancen, auch hierzu Philipp Manow, der von „insurgent candidates (aufständische, also nicht vom Parteiestablishment unterstützte Kandidaten)“ sprach. Macron war einer davon, natürlich Trump, aber auch Obama. Bei den von Macron ausgerufenen Nationalwahlen wird sich die Frage stellen, in wie vielen Wahlkreisen es seine Renaissance in die Stichwahlen schafft.
Österreich hat weniger das Problem einer starken FPÖ, die sich, wenn sie in Regierungsverantwortung kam, in der Regel schnell ins Abseits korrumpierte, aber immer wieder mit einer dann noch radikaleren Linie wiederauferstand, sondern das Problem von ÖVP und SPÖ, vor allem aber der ÖVP, die nie so recht weiß, mit wem sie koalieren sollte, dann bisher aber doch im Zweifel die FPÖ erwählte. Ob sie Herbert Kickl zum Kanzler wählen würd, ist alles andere als sicher. Gegebenenfalls wären auch eine österreichische Ampel oder ein österreichisches Jamaica mit Grünen und Neos denkbar. Die Grünen haben sich vor der Europawahl in Österreich weitgehend selbst demontiert, nicht zuletzt wegen unsäglicher Dummheiten ihrer Spitzenkandidatin. Ihre Glaubwürdigkeit hatten sie in der Koalition mit der ÖVP ohnehin längst verspielt.
Man könnte es sich natürlich auch leicht machen und erwähnen, dass der konsequente Kurs der deutschen Grünen zur Unterstützung der Ukraine Stimmen gekostet hat – das wäre ehrenwert, aber es gab kein anderes großes Thema, bei dem die Grünen ein klares Profil hätten erkennen lassen, nicht einmal der Klimaschutz. Insofern verwundert es nicht, dass VOLT sich vor allem bei vielen jungen Leuten als pro-europäische, linksliberale, ökologische Partei hat profilieren können. Die Partei vervierfachte ihr Ergebnis und schaffte in vielen großen Städten ein Ergebnis von mehr als fünf Prozent. Sie ist jetzt mit drei deutschen und zwei niederländischen Abgeordneten im EU-Parlament vertreten.
Aber warum traut sich niemand mehr in der SPD und bei den Grünen zu sagen, wofür man steht, wohin man will? Was sind die Ziele, was die Visionen? Man reagierte nur auf Ängste, nicht auf die Hoffnungen, die die Bürger:innen doch nun auch einmal haben, und wendet sich dann gegen die, die man als Ursache des Problems erkennt, obwohl sie vielleicht eher nur das Symptom der Krankheit sind. Wie kommt es, dass man sich kaum noch traut, für Klima- und Artenschutz einzutreten? Wie kommt es, dass man sich kaum traut, offensiv für die Ukraine einzutreten? Bleibt letztlich von dieser Ampel-Regierung nicht mehr übrig als ein Zuwanderungsgesetz, von dem niemand etwas merkt, die Freigabe von Cannabis, ein liberales Transsexuellengesetz und die Erinnerung an die untauglichen Versuche, Wärmepumpen und Kindergrundsicherung durchzusetzen, auf kommunaler Ebene noch ein paar Fahrradwege? Wie kann es sein, dass man in Sachen „Bürgergeld“ die nicht ganz unberechtigte, wenn auch überzogene Kritik einfach ignorierte? Wie kann es sein, dass eine Vertreterin der Grünen Jugend vom Parteivorsitzenden gemaßregelt wurde, als sie es wagte, mehr soziale Gerechtigkeit zu fordern und das – welch Schreck – auch noch mit dem Begriff „Demokratischer Sozialismus“ verband?
Einfallslose SPD – einfallslose Grüne
Vor der Wahl fiel der SPD außer Beruhigungsformeln nichts ein. Giovanni di Lorenzo sprach in seinem Leitartikel der ZEIT vom 13. Juni 2024 von „beunruhigender Ratlosigkeit“ und der „Simulation von Entschlossenheit“. Was bedeutet es eigentlich, wenn die SPD „Frieden“ plakatiert? Marina Weisband hat in einem Podcast für die FAZ kurz nach der Rede des ukrainischen Präsidenten im Bundestag sehr deutlich gesagt, dass „Frieden“ in dieser Form eine Leerformel ist, weil es offenbar kein Ziel gibt, Frieden mit wem, Frieden unter welchen Bedingungen? Welches Ziel verfolgt der Kanzler für die Ukraine? Eine ebensolche Leerformel ist „Wohlstand“, den alle so interpretieren können, wie sie möchten. Wofür sollen sich Bürger:innen dann entscheiden? CDU und CSU hatten es hier etwas leichter, weil sie der Regierung pauschal unterstellen konnten, „Wohlstand“ zu gefährden. Was sie wollten, sagten auch sie nicht, es blieb bei Andeutungen, zum Beispiel steuerfreie Mehrarbeit.
Die Grünen plakatierten „Einigkeit gegen Rechts für Freiheit“. Die SPD präsentierte den Bundeskanzler mit ihrer honorigen Spitzenkandidatin als „Deutschlands stärkste Stimmen“ und trat für „Frieden“ (siehe oben), für „Maß“ und „Mitte“ und ähnliche Allerweltsbegriffe an. SPD und Grüne scheiterten an ihrer Hasenfüßigkeit. Eine ähnliche Analyse formulierte Juli Zeh in „Hart aber fair“ am 10. Juni 2024: „Man muss nicht gegen etwas antreten, man muss für etwas antreten. Es reicht nicht zu sagen, wir vereinen uns gegen die AfD. Das nützt im Zweifel den anderen.“
Auch nach der Wahl fiel SPD und Grünen nichts ein. Die FDP schnitt in den Medien noch am besten ab. Jeder weiß, was sie will, das hat sie in diversen Papieren oft genug gesagt, sie hielt das Ergebnis der Europawahl von 2019 und darf das als Erfolg verkaufen. Der Bundeskanzler schaffte es aber nur mit dem Satz in die Schlagzeilen, man müsse die Politik besser erklären, die Grünen wirken sprachlos. Ein Kommentator der FAZ sprach passend von „Wirklichkeitsverweigerung“. CDU und CSU, die auch nicht mehr schafften als die in den Umfragen prognostizierten 30 Prozent, hatten es leicht, nach der EU-Wahl nationale Neuwahlen zu fordern oder wie Markus Söder den Kanzler als „Kanzler ohne Land“ zu apostrophieren. Inhaltlich haben CDU und CSU auch nicht viel zu bieten: ein halbwegs erfolgreicher Kampf gegen Gendersternchen, ein paar Zulassungen für Pflanzengifte und ein Erfolg bei der Steuerbefreiung des Agrardiesel. Was den einen Cannabis-Freigabe und Gendersternchen, ist den anderen Agrardiesel und der Widerstand gegen ein Tempolimit. Wohlstand mit Suchtpotenzial.
Noch nie hat es eine Regierung einer Opposition so leicht gemacht, sie zu demontieren. Ein Indikator sind die Presseerklärungen der Grünen im Bundestag. Als die Grünen noch in der Opposition waren, erfuhr man dort von interessanten Debatten, man erhielt ein gutes und kompetentes Bild. Seit sie in der Regierung sind, sprich: Ampel, werden selbst offensichtliche Niederlagen in der Regierung (Kindergrundsicherung!) als großer Erfolg dargestellt. Ach ja, der Atomausstieg ist gelungen. In den Landtagen dergleichen.
Ich erlaube mir eine kleine Zusammenstellung der Parolen, die nach Wahlniederlagen zu hören und zu lesen sind:
- „Wir müssen unsere Politik besser erklären.“
- „Wir müssen unser Profil stärken und unsere Positionen klarer vertreten.“
- „Wir müssen die Sorgen und Ängste der Bürger (wird in dieser Form selten gegendert) ernst nehmen.“
Das geht einher mit scharfen Worten nach Attentaten, beispielsweise: „Wir verurteilen aufs Schärfste…“. Langsam nervig wird die gebetsmühlenartig wiederholte Forderung des Bundeskanzlers nach mehr Abschiebungen, obwohl ihm eigentlich klar sein müsste, dass man sich selbst schadet, wenn man einen Straftäter nach Afghanistan abschiebt, möglicherweise mit einer Geldzahlung an die Taliban verbunden, die dem Abgeschobenen eine neue Identität, einen neuen Pass, wahrscheinlich auch einen neuen Auftrag verpassen, der dann irgendwo im Westen umzusetzen ist. Man könnte von erlernter Hilflosigkeit sprechen, die aber nicht die Hilflosigkeit gegenüber dem Migrationsproblem, sondern eine Hilflosigkeit gegenüber denjenigen ist, die noch schärfere Anti-Migrationsmaßnahmen fordern, bis hin zur „Remigration“, zur Deportation, Push-Backs oder zum offenen Schusswaffengebrauch an den Grenzen der EU. Letztlich versucht die Regierung – die demokratische Opposition sowieso – den Forderungen von „Rechts“ – mit dem BSW jetzt auch von scheinbar links – den Status eines „Volkswillens“ zuzugestehen, dem man entgegenkommen müsse, mit dem Ergebnis, dass die vermeintlichen Vertreter dieses „Volkswillens“ die nächste, eine noch radikalere Forderung treffen. Das wissen die Wähler:innen!
Da hilft es auch nichts, wenn der Bundeskanzler wenige Tage vor der Wahl meint, die Forderung der Linken nach 15 EUR Mindestlohn aufnehmen zu müssen (natürlich ohne Copyright). Auch das glaubt ihm einfach niemand. Kaninchen vor der Schlange, Angstbeißen, Rückzug ins Schneckenhaus? Etwa so die Richtung. Ähnlich ist es mit der Forderung nach dem Bürokratieabbau. Wie denn, wenn Migrant:innen die Deutschkurse gestrichen werden, Abschlüsse nur höchst umständlich anerkannt werden? Da hilft es nicht, darüber zu klagen, dass so viele noch keine Arbeit hätten! Ja, wenn man sie nicht lässt! Auch das wissen viele Bürger:innen, die Betriebe, die Arbeitskräfte suchen, ohnehin.
Es fehlte eigentlich nur ein Satz aus dem Repertoire der Wahlverlierer:innen: Niemand sprach von einer Kampagne gegen sie. War auch nicht nötig, denn diese Kampagne macht die Regierung gegen sich selbst. Nicht wegen der FDP, deren Hobby es zu sein scheint, im Kabinett etwas zu beschließen, das sie dann einen Tag später in der Presse als inakzeptabel markiert. Man könnte sogar denken, dass Christian Lindner zwei Identitäten hat, eine vor dem Kabinettbeschluss, eine danach.
Ein Ende mit Schrecken als neuer Aufbruch?
SPD und Grüne sollten sich ehrlich machen. Ein Ende mit Schrecken ist besser als ein Schrecken ohne Ende. Das heißt Neuwahlen. Wahrscheinlich ist eine Regierung Merz-Pistorius, gegebenenfalls auch Merz-Habeck. So erreicht man auch, dass es eine demokratische Opposition geben wird, die ihre Aufgabe ernst nimmt. Sonst droht die Gefahr, dass das Ergebnis im Herbst 2025 eine Regierung Merz-Pistorius-Habeck ist, und als Opposition bleiben im Bundestag nur noch AfD und BSW.
Eine Alternative wäre der Austausch des Bundeskanzlers: Pistorius statt Scholz, das könnte sicherlich helfen, denn so stark wie er zurzeit aussieht, ist Merz nicht, zumal die Söder-Attacken gegen ihn noch gar nicht angefangen haben.
Aber wie auch immer: Kanzlerwechsel oder Neuwahlen, SPD und Grüne müssen sich auf Inhalte besinnen. Sie müssen sagen, wo sie hinwollen, Visionen nennen, Ziele plakatieren, offensiv vertreten, klar machen, dass Frieden nur mit Europa möglich ist, dass statt einer Kapitulation der Ukraine eine Niederlage Russlands das Ziel ist, dass soziale Gerechtigkeit ein zentrales Thema jeder zukunftsfähigen Politik ist, dass man nicht nur fantasielos Mehrarbeit fordern kann, sondern ein Gesamtkonzept einer an den Realitäten orientierten Wirtschaftspolitik braucht. Wie werden unsere Innenstädte wieder attraktiver? Was sollten Kinder in der Schule lernen? Und wie? Was ist mit politischer Bildung (und mit Geschichtsunterricht)? Wie können wir Bürger:innen (auch Kinder!) beteiligen? Alles in allem: was bedeutet eigentlich Gerechtigkeit? Was heißt das konkret?
Es gilt, was Michel Friedman so prägnant formulierte: „Streiten? Unbedingt!“ Wir sollten nicht davon ablassen, Lösungen zu suchen, dann werden wir auch welche finden. Wir müssen aufhören, Politik an Regierungen zu delegieren. Das heißt nicht, dass Volksabstimmungen die Lösung wären. Im Gegenteil. Aber es ist schon klar: Die aktuelle Politik ist eine extrem paternalistische Baldrian-Politik. „Heile heile Gänsche, wird alles wieder gut“, sang mal ein Mainzer Karnevalist, der möglicherweise heute seinen Namen ändern müsste. Viele junge Leute haben sich nicht ohne Grund für kleine Parteien entschieden, bei denen sich spannende Leute finden, nicht zuletzt bei VOLT, auch bei den Freien Wählern. Baldrian-Politik macht Leute ungeduldig und wütend, aber wie wäre es, wenn man in einer Regierung einmal zugäbe, dass man nicht alles weiß, und Vorschläge als Vorschläge präsentiert und nicht als ultimative Weisheiten? Dann würde man auch keine Angst mehr vor Schlangen haben müssen und die Hasen hätten gegen die den armen Igeln zugeschriebenen Strategien des Einigelns und des hinterhältigen Betrugs eine gute Chance.
P.S.: Die Grünen sollten wissen, grüner als mit Ursula von der Leyen wird es nicht. Aber das sollte sie nicht hindern, im EU-Parlament grüne Themen nach vorne auf die Agenda zu setzen. Einige wenige tun das. Die rheinland-pfälzische Abgeordnete Jutta Paulus ist ein Lichtblick.
Norbert Reichel, Bonn
(Anmerkung: Erstveröffentlichung im Juni 2024, Internetzugriffe zuletzt am 19. Juni 2024. Titelbild: Hans Peter Schaefer, aus der Serie Deciphering Photographs.)