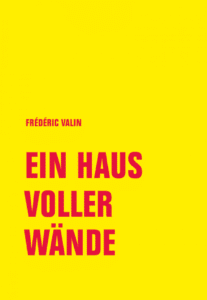Das Glück der Außenseiter
Ein Portrait des Autors und Pflegers Frédéric Nicolas Valin
„Ich stehe in der Zimmertür und atme tief ein; es ist halb zehn, langsam beginne ich zu merken, dass ich die Nacht kaum geschlafen habe. Seit vier Uhr bin ich wach, die ganze Welt ist aus Gummi. Ich gehe zum Fenster und sehe mein Spiegelbild: Die Augen sind rotgerändert, das schmale Gesicht hängt mir müde von den Knochen, es fühlt sich an, als wäre es von einer dünnen Lauge überzogen. Ich reiße das Fenster auf, die kalte Dezemberluft schießt mir in die Bronchien, und ich beginne fast, wieder in Sätzen zu denken statt nur in Stichworten. / Fünf Minuten Pause. Dann Sylvia.“ (Frédéric Valin, Der Vorgang, in: In kleinen Städten, Berlin, Verbrecher Verlag, 2013)
Sylvia ist Epileptikerin und hat Trisomie 21. Sie lebt in einem Heim, in dem Menschen leben, die – wie man so sagt und denkt – sich selbst nicht helfen können, kranke Menschen in einem geschlossenen Raum. Dieses Szenario ist auch die Grundlage eines der berühmtesten Romane deutscher Literatur: Thomas Manns „Der Zauberberg“. Nun sind die in dem Schweizer Sanatorium an der um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert verbreiteten Krankheit kurierenden Menschen alle Angehörige einer finanziell und sozial unabhängigen Schicht der damaligen Bevölkerung. Materielle Nöte kennen diese Persönlichkeiten der Literaturgeschichte nicht. Für diese ist die Tuberkulose eine Art Edel-Krankheit.
Botschaften aus einer anderen Welt
In den Heimen der Bücher von Frédéric Valin ist das anders. Dort leben Menschen, deren Krankheiten, Hilflosigkeiten, Einschränkungen, Behinderungen keine Metaphern sind wie man es bei Tuberkulose-Patient:innen in der Literaturgeschichte gerne annimmt. Sie verfügen nicht über die finanziellen Ressourcen, mit denen sie sich ein Leben in Davos und an ähnlichen Orten leisten könnten. Sie ergehen sich nicht in philosophischen Diskussionen. Die Heime der Bücher Frédéric Valins sind keine Zauberberge, keine Orte, in denen Menschen zu sich selbst finden und sich geradezu in und mit ihrer Krankheit zu höheren Menschen stilisieren.
Es sind Menschen, von deren Leben eigentlich niemand so richtig etwas weiß und viele auch gar nichts wissen möchten, und bei denen wir froh sind, dass es andere Menschen gibt, Pfleger:innen genannt, die bereit sind, eine Zeit ihres Lebens in dem geschlossenen Raum, dem abgesperrten Gelände des Anti-Zauberbergs zu verbringen. Niemand käme auch nur auf die Idee, ihre Krankheiten als „Metaphern“ zu bezeichnen. Insofern wäre der berühmte Essay von Susan Sontag über „Krankheit als Metapher“ in ihrem Leben gegenstandslos. Anders gesagt: diese Menschen sind der lebende Beleg dafür, dass Krankheit Krankheit, Hilflosigkeit Hilflosigkeit ist, nichts sonst. Aber wie soll man über die Menschen in diesen Heimen sprechen? Das ist ein zentrales Thema der Erzählungen Frédéric Valins: Sprachlosigkeit.
Frédéric Valin wurde 1982 in Wangen im Allgäu geboren. Er lebt in Berlin, schreibt Bücher und arbeitet im Pflegebereich, in Pflegeeinrichtungen ebenso wie in der Einzelbetreuung bis hin zur 24-Stundenpflege. Er wurde im Jahr 2022 Vater. In seinem neuen Lebensabschnitt sieht er durchaus Parallelen zwischen der Betreuung eines Kindes und seiner Pflegearbeit, allerdings sei die Verbindung natürlich eine andere. Er sagte mir, es sei sein „großes Ziel, dass das eine stabile und fortlaufende Beziehung wird. Ganz kleine Kinder wissen schon sehr genau was sie wollen. Der größte Teil meines Jobs momentan ist, dem Kind zu verschaffen, was es braucht, und ihm klarzumachen, dass es die Dinge nicht tut, die es potentiell umbringen könnten.“ Ein Unterschied: das was bei Kindern den Anfang einer Entwicklung ausmacht, gibt es bei alten und kranken Menschen in der Pflegeobhut nicht mehr. Dort ist „Endstation“, wie der Erzähler In „Frau Nachtweih wünscht zu sterben“ (im Band „Randgruppenmitglied“) schreibt, aber die Pfleger sind wie Väter und Mütter einander in dieser im wahrsten Sinne des Wortes gegebenen Aussichtslosigkeit verbunden: „Wie ein junges Ehepaar, sagt Albert immer, wenn wir uns von der Nachtweih und dem Hasenberger erzählen. Als ob das unsere Kinder wären.“
Zwei Bücher von Frédéric Valin habe ich bereits im Demokratischen Salon vorgestellt, die Dokumentationen „Pflegeprotokolle“ in der Rezension „Who Cares?“ und „Ein Haus voller Wände“ in dem Essay „Querfront der Exklusion“, in dem auch Verbindungen zu dem Buch „Unmenschlichkeit als Programm“ von Peter Bierl thematisiert wurden. „Zidane schweigt“ ist ein Essay, die Bücher „In kleinen Städten“ und „Randgruppenmitglied“ sind Sammlungen von Erzählungen. Alle Bücher von Frédéric Valin erschienen im Berliner Verbrecher Verlag, bei dem – so sagte er mir, er sich sehr wohl fühlt. Zurzeit denkt er darüber nach, ob er in einem nächsten Buch die Erfahrungen in der 24-Stunden-Pflege, die er vor der Geburt des Kindes machte, in Form eines Romans darstellt. Er nannte aber auch das Problem eines solchen Romans: „Ein Roman gibt aber auch einen zeitlichen Ablauf vor, den die Pflege so nicht kennt. Der Rhythmus eines Romans bildet Krankheiten nur unzureichend ab. Ich muss überlegen, wie ich diese Frage löse.“
Alle Bücher von Frédéric Valin sind Bücher aus einer anderen Welt, über Welten, die wir im Alltag ignorieren. Sie geben Wirklichkeit wieder, anders als die diversen Zauberberge der Weltliteratur. Sie beruhen auf persönlichen Erfahrungen des Autors, der aber in jedem Fall Hinweise vermeidet, die einen Rückschluss auf konkrete Personen zuließen. Die Persönlichkeitsrechte der beschriebenen Menschen müssen auf jeden Fall gewahrt bleiben. Frédéric Valin gelingt es dennoch, die von ihm geschilderten Personen zu Persönlichkeiten werden zu lassen, deren Leben uns als Leser:innen berührt und – auch das ist ein wichtiges Ziel – im besten Sinne des Wortes aufklärt. Dies war – so sagt er – beim Schreiben „die Herausforderung“. Man könnte bei seinen Büchern durchaus auch von „Auto-Fiction“ sprechen, aber er vermischt die beiden Bestandteile dieser zurzeit modischen Gattungsbezeichnung nie.
Ausgelagert
Frédéric Valin hat immer wieder im Pflegebereich gearbeitet, schon als Schüler hat er ab dem 16. Lebensjahr in den Ferien dort gejobbt. Er arbeitete schon damals eine Zeit lang in einem Altenheim, andererseits wurde auf dem Bau besser bezahlt. Dort erhielt man 18 DM die Stunde, im Altenheim nur 13 DM. Er absolvierte seinen Zivildienst in Hamburg, als individuelle Schwerstbehindertenbetreuung bei einem Herrn mit Tetraplegie. Einzelbetreuung erfolgt in einem differenzierten Schichtdienst. In einer Woche beträgt die Arbeitszeit 18 Stunden am Tag, eine Woche ist Freizeit, eine Woche Bereitschaft. Drei Pflegekräfte wechseln sich in diesem Rhythmus ab. Der betreute Herr konnte die Arme bewegen, aber nicht mehr die Finger. Er brauchte bei vielen Dingen Unterstützung, obwohl er sich als erfahrener Mann schon viele Tricks ausgedacht hatte, wie man mit dem Handicap umgehen kann. Ein Pfleger, dem eine solche Aufgabe gestellt ist, lernt von dem Patienten, denn wer kann solche Erfahrungen schon einüben. Viele Pflegekräfte arbeiten ohne eine spezifische Ausbildung, gerade auch Freiwillige. Politiker:innen, die einen sozialen Pflichtdienst für junge Menschen einrichten möchten, verkennen die Komplexität der psychischen und physischen Anforderungen der Pflege. Frédéric Valin arbeitete ohne Ausbildung in München in einer SRT-Abteilung, die die „absolute Hölle“ gewesen sei, sodass er dort erst einmal mit dem Pflegedienst aufhören musste. Die Erzählung „Frau Nachtweih wünscht zu sterben“ ist in diesem Kontext entstanden.
Das Pflegethema hat Frédéric Valin schon in seinen frühen Texten immer wieder angesprochen, beispielsweise in den Erzählungen „Der Vorgang“ (aus dem Band „In kleinen Städten“) und „Frau Nachtweih wünscht zu sterben“ (aus „Randgruppenmitglied“), veröffentlichte. Schon die Titel der beiden Erzählsammlungen lassen sich programmatisch verstehen. Es geht um die Ränder der Gesellschaft, die Ausgeschlossenen, die Ausgelagerten, die schwer Erreichbaren, schwer Zugänglichen, um gelebte Exklusion. Die Orte, an denen diese Menschen leben, spiegeln die fehlende Bereitschaft der Gesellschaft, diese Menschen in ihrer Gesellschaft zu akzeptieren. Selbst ihre Angehörigen tun sich schwer. Anders gesagt: Gesellschaft ist immer exkludierend, immer von dem Bedürfnis nach Exklusion bestimmt, die mitunter einfach nur mit karitativer Rhetorik bemäntelt wird. Die Beschreibung des Zimmers von Frau Nachtweih zu Beginn der ihr gewidmeten Erzählung endet mit den Sätzen: „Hier ist Endstation, ‚Sense‘, wie Albert immer sagt. Oder er sagt: ‚Finito.‘“ Und besuchende Vertreter:innen der Träger der Pflegeeinrichtungen tätscheln – wie Frédéric Valin in „Ein Haus voller Wände“ beschreibt – den „Patient:innen“ schon mal gerne die Wange. Manchmal erwischen sie dabei auch eine Pflegekraft.
„Pflegeprotokolle“ und „Ein Haus voller Wände“ sind im Grunde Erfahrungsberichte, teilweise mit Reportage-Charakter, auf jeden Fall eher als Sachbücher zu lesen, obwohl die Erzählbände ebenso von den Situationen leben, die dort beschrieben werden. Alle Texte leben von einer sehr sensibel gehandhabten Mischung von Empathie und Distanz. Dazu gehört auch Unwille und Ungeduld. Es gibt Patient:innen, die man als Pfleger:in einfach nicht mag, die einem unangenehm sind, die mit der ein oder anderen ständigen Macke nerven, aber es gehört eben auch zu dem Spiel zwischen Empathie und Distanz, sich dies als Pflegekraft einzugestehen.
Der Erzähler von „Frau Nachtweih wünscht zu sterben“ ist Pfleger der Protagonistin. Sie lebt in einem Haus, einem Heim, das der Erzähler als „Irrenghetto“ bezeichnet, in dem er zwischen den dort lebenden beziehungsweise vegetierenden Menschen unterscheidet: „Trotzdem, die Nachtweih ist mir lieber als der Hasenberger. Ich mag die Irren nicht. Die mit den Frontalhirnschäden, wie den Hasenberger. Bei Frontalhirnschäden ist der Charakter kaputt.“ Aber wie erlebt ein Mensch sein Leben, der nicht mehr essen kann, aber fein säuberlich seine Rezepte abheftet? Frau Nachtweih ist da scheinbar einfach: „Fünfundvierzig, Schlaganfall, Halbseitenlähmung links, depressiv und in Folge von Fresssucht übergewichtig. Steht alles so in der Krankenakte.“ Der Hasenberger hat keinen Frontalhirnschaden, er ist ein Frontalhirnschaden, und die Nachtweih – bei beiden spart sich der Erzähler den Vornamen oder das höflich einleitende „Herr“ oder „Frau“ – erst einmal das, was in der „Krankenakte“ steht. „Das ganze Haus ist ein Dorf voller Irrer. (…) Dreieinhalbtausend Leute wohnen dort, alle behindert oder bekloppt oder beides.“
In „Der Vorgang“ beschreibt Frédéric Valin den „Fall“ „Sylvia“ – was auch immer das heißen mag, denn Menschen sind wie Frédéric Valin mit Recht anmerkt keine Fälle. Schauplatz ist ein kleines Dorf, „ein kleines Kaff, irgendwo weit außerhalb, inmitten eines Waldes, in dem Wildschweine leben. // Und Behinderte oder Alte, das ist aus technischer Sicht das Gleiche. Sie wohnen hier, wie sie können, in ambulanter Betreuung oder in Wohngruppen, man hat einen Kindergarten zwischenreingebaut und eine Station zur U-Haftvermeidung für Jugendliche. Weiter hinten stehen noch ein paar echte Häuser (…).“ Diese Menschen sind Bewohner:innen eines Ortes der Unwirklichkeit, es sind eben keine „echten Häuser“, sie leben in der Außensicht vielleicht so etwas wie ein falsches Leben im richtigen. Sie sind Ausgeschlossene oder vielleicht passt ein anderer Begriff besser: Ausgelagerte, Menschen, die uns nicht berühren, weil wir sie nie treffen werden, es sei denn, wir gehören zu dem Personal – auch das ein doch sehr technisch-bürokratischer Begriff –, dessen Zuständigkeit (!) darin besteht, die Grundbedürfnisse dieser Menschen zu befriedigen, welche auch immer das sein können.
Manche dieser Menschen leben nicht in Heimen, sondern an eigentlich zuversichtlich stimmenden Orten. So beispielsweise die Rentner:innen, die in „Lea lacht“ (aus „In kleinen Städten“) sich in Albufera an der Algarve aufhalten. Es gibt solche Resorts, in die sich alte Menschen zurückziehen, auch in der Wirklichkeit. Aber auch die dort lebenden Menschen sind für Auswärtige, zufällige Besucher:innen aus der „echten“ Welt als Outsider erkennbar, denn „sie tragen Kleidung, die aus einem Caritas-Sack stammen könnte, das Alter hat sie jede Scham vergessen lassen. Sie sind hier ohnehin unter sich.“ So leben sie dahin. Wenn Lea „das Wort ‚Lebensweg‘ hört, lacht sie immer.“ Andere verabschieden sich aus einer solchen Welt mit Alkohol, so zum Beispiel eine zentrale Person der Erzählung „Der Trinker“ („In kleinen Städten“): „Es gibt nur einen Zustand, in dem der Zusammenhang keine Rolle mehr spielt, in dem die Welt auseinanderfallen darf: Das ist der Rausch.“ Etwas später der Kommentar des Erzählers: „ein fürchterlicher Zustand“. Oder vielleicht doch nicht: „Genau diese Momente, in denen nichts geschieht außer dem eigenen Atmen (…) Eindruck von Ewigkeit.“
Ein paar Sätze mit Frédéric Valin über das Glück
Norbert Reichel: Von außen identifizieren wir schwer Erkrankte mit ihrer Krankheit. Sie werden zu Akten, zu Fällen. Sie zeigen in ihren Erzählungen aber, was diese Menschen wirklich sind, was sie im „echten“ Leben waren: „Die Nachtweih ist früher mal Künstlerin gewesen, Eiskunstlauf erst, und später dann Malerin. Gedichtet hat sie auch ein bisschen. Jeden Abend ist sie auf irgendeiner Vernissage rumgegondelt und hat in irgendeinem Club gefeiert, mit der halben Stadt war sie befreundet, Bussi hier und Bussi da, noch ein Sektchen, aber gerne, so lief das. Solche Freunde kommen nicht zu Besuch, nicht hierher, man trifft sich oder man trifft sich eben nicht.“ Sie beschreiben ausführlich, welche Unannehmlichkeiten die Menschen in der Einrichtung verursachen, welche Gerüche, welchen Schmutz. Frau Nachtweih weint, als der Erzähler, ihr Pfleger, ihr einige Verse aus einem ihrer beiden Gedichtbände vorliest. Ist das Glück?
Frédéric Valin: Da kann auch Glück dabei sein. Ich will aber gar nicht für Frau Nachtweih sprechen, bin aber nicht unglücklich mit dieser Interpretation. Denn das wird oft nicht gesehen. Gerade bei Demenz. Ich denke an das Buch von Tilman Jens, dem Sohn von Walter Jens. Es ist eines der besten Demenzbücher, weil es so unglaublich misslungen ist, sein Versuch, der Geschichte einen Sinn unterzuschieben, sein Scheitern. Es zeigt aber auch, wie gewaltvoll das Überstülpen der eigenen Sicht der Dinge auf das Leben des dementen Menschen ist. Einerseits rächt sich der Sohn mit dem Buch an seinem Vater, anderseits trauert er auch, ein Gefühlsgemenge, mit der er aber besser an die Realität herankommt als beispielsweise Arno Geiger in „Der alte König in seinem Exil“.
Wir haben in der Pflege immer gesagt: Die meisten Menschen bekommen die Demenz, die sie verdienen. Das klingt vielleicht ein bisschen brutal, aber es ist doch mein Eindruck. Ich habe Menschen gesehen, die unglaublich glücklich waren, Menschen, die offen für ihr Leben waren, die sich etwas zutrauten, für die waren die meisten Tage schön. Das habe ich auch bei Schädelhirntraum so erlebt. Stark individuell denkende Menschen hatten es da schwerer, nach einem Schlaganfall zum Beispiel. Wir Intellektuellen sind besonders gefährdet, dass wir damit viel schlechter zurechtkommen. Je intellektueller und je individualisierter der Lebensentwurf vorher war, umso schwerer ist es wohl, mit Verlusten umzugehen, dem Verlust der Sprachfähigkeit, dem Verlust der Gangfähigkeit, der Konzentrationsfähigkeit, all das, was ein Schlaganfall bewirkt, während viele Handwerker:innen nach meiner Erfahrung viel besser darin waren, die Situation anzunehmen.
Norbert Reichel: Als meine Mutter starb, war mein Vater bereits in einer fortgeschrittenen Phase seiner Demenz. Er war friedlich, freundlich. Zur Beerdigung seiner Frau, mit der er 59 Jahre verheiratet war, konnten wir ihn nicht mitnehmen. Er blieb bei seiner polnischen Betreuerin Anetta, einer wunderbar empathischen Frau. Auf seinen Platz in der Trauerhalle legte ich eine Rose. Eine Woche später erzählte er mir, dass gleich um 5 Uhr nachmittags Leute kämen, die die Wohnung ausräumen und alles auf die andere Rheinseite bringen würden. Das habe in der Zeitung gestanden. Niemand kam. Einige Tage später wurde mir klar, was er erzählte. Er hatte die Todesanzeige meiner Mutter gesehen, er wusste, dass sie auf der anderen Rheinseite beerdigt wurde, einige Tage vor unserem Gespräch wurde das Krankenbett meiner Mutter vom Pflegedienst abgeholt. Er hatte eine eigene Version der Ereignisse geschaffen. Aber als niemand kam, war auch alles gut. Er konnte sich damit abfinden.
Frédéric Valin: Es ist nicht so wichtig, was demente Menschen erzählen, es ist nicht wichtig, ob das objektiv stimmt, und es ist eine objektiv falsche Sache, sie zu korrigieren. Einfach stehen lassen. Man kann einem dementen Menschen keine geordnete Wahrnehmung verordnen, in dem Sinne, wie sich das die nicht-dementen Menschen so vorstellen. Bei den eigenen Eltern fällt es besonders schwer. Eltern waren ja eine Instanz, zu der man als Kind aufsah, aber dennoch: die von der Wirklichkeit abweichende Wahrheit stehen lassen! Das wird umso schwerer, je intensiver die persönliche Beziehung ist. Dann hilft ganz häufig, wenn jemand von außen die gemeinsame Realität beschreibt: die Realität ist in der Regel dann der Streit, der aus der unterschiedlichen Sicht, der Verunsicherung entsteht.
Sprachlosigkeit
In der Erzählung „Mimoun“ (aus: „Randgruppenmitglied“) wohnt – niemand weiß so recht wie es dazu kam – plötzlich ein Dritter in der Wohnung eines Paares. Ein Geflüchteter? Ein Obdachloser? Ein wie auch immer Verlorener, im „echten“ Leben Gescheiterter? Oder etwas von allem? In einer Nebenbemerkung erfahren wir, dass Deutsch nicht seine Muttersprache ist. „Und dann war er hier gestrandet“. Er richtet sich ein, die Kommunikation zwischen den – so ließe sich sagen – Mitgliedern der zufälligen Wohngemeinschaft ist eher spärlich. Er ist einfach da, niemand weiß woher und warum und was er denkt: „Wir hatten längst vergessen, woher wir ihn kannten. Wir erinnerten uns dunkel daran, wie er hieß, aber was er machte, woher er kam, wann wir ihn das letzte Mal getroffen hatten, all das wussten wir nicht mehr. Wir beratschlagten mit gedämpften Stimmen: Vielleicht war das Anfang September gewesen, unser letztes Grillen im Park. Oder war es bei diesem Flohmarktbesuch gewesen, als wir uns nicht einigen konnten, welche Art Couchtisch wir in der neuen Wohnung… Oder (…)“
In einer einzigen Wohnung vollzieht sich die Sprachlosigkeit zwischen denen, die schon immer da waren, und denen, die irgendwie dazu kamen, nicht anders als wir sie im Stadtteil, in der Gesellschaft erleben, ohne darüber nachzudenken, was wir da eigentlich erleben. Mimoun ist höflich, er fragt immer, ob er dies oder jenes benutzen darf. Seine Mitbewohner:innen fragen nicht nach. Es ist ein wenig wie im Parzifal-Mythos, wo ja auch eine verpasste Frage alle folgenden Verwirrungen der Geschichte verursacht. Aus seinen Essgewohnheiten ließe sich vielleicht erschließen, woher er kam – er entdeckt Safran und freut sich, macht Hummus aus dem Kichererbsenvorrat. Seine braune Haut. Vielleicht kam er aus einem orientalischen Land? Vielleicht ließe sich auch erfragen, was ihn von dort vertrieb, aber seine Mitbewohner:innen nehmen es so hin wie es ist: „Mimoun. Wir haben ihn nie gefragt. Das gehörte zum Spiel: Wir wollten es nicht wissen. Das Raten machte uns Spaß.“
Doch dann ändert sich Mimouns Verhalten. Er wird nervös, reagiert nicht mehr auf seine Mitbewohner:innen, möchte alle harten Konsonanten verschwinden lassen, allen voran das „t“, will „eine neue Sprache“. „Nichts zischendes, nichts hartes, wir brauchen eine neue Sprache, wir brauchen eine menschliche Sprache, wir brauchen …“ Niemand fragt, niemand versucht die Verhaltensänderung zu erkunden. Die Sprache, die er wünscht, soll so etwas „wie das Gegenteil des Hebräischen“ sein. Ein Indiz für eine arabische Herkunft?
„Irgendwann war Mimoun verschwunden.“ Seine Mitbewohner:innen beratschlagen, was geschehen sein könnte. Sie finden ein Bündel, darin einen Dolch, an dem sie sich schneiden, einige Briefe und Bilder, darauf eine Frau, mit oder ohne Mimoun, an unterschiedlichen Orten. Sie bleiben sprachlos oder verschlug es ihnen die Sprache? Aber wie sollte ihnen die Sprache verschlagen, wo sie doch auch zuvor nicht, zumindest nichts Substanzielles, gesprochen hatten und dies auch weiterhin nicht tun. „Zwei Stunden saßen wir auf dem Sofa und sahen uns nicht an.“
Da war aber doch noch etwas, ein Umschlag mit zahlreichen zerrissenen Dokumenten, Rechnungen, Kündigungen. „Mimouns zerrissene Überreste.“ Sie warten, vielleicht kommt er wieder. „Vielleicht können wir ihm helfen, vielleicht gibt es noch irgendwas zu tun.“ Und dann finden sie noch etwas: „In seinem Regal liegen seine Sachen, und unter dem Sofa haben wir einen Zettel gefunden, ein Überrest seiner Sprachstudien. Darauf hat er mit grünem Filzstift und mit seiner zittrigen Handschrift fünfzig oder hundertmal groß ein einziges Wort geschrieben, das ganze Blatt voll. Flucht, Flucht, Flucht. Flucht. Flucht. Und immer hat er das t weggestrichen. // Nicht einmal das Wort durfte ein Ende haben.“
Ähnliche Sprachlosigkeit sehen wir auch in der Erzählung „Punk Dead“ (aus: „Randgruppenmitglied“). Die dort beschriebene Kultur – wenn ihre Mitglieder überhaupt wissen, das sie eine ist – existiert ebenso am Rande der Gesellschaft wie die „Häuser voller Wände“. Da blieb nicht viel übrig, „was man als Teenager hätte sein können: Punkt, Nazi oder Hip-Hopper“: „Wir waren so sehr Provinz, wir hatten noch nicht einmal Subkultur. Der nächste soziale Brennpunkt war ein Asylbewerberheim in vierzig Kilometer Entfernung.“ In der Erzählung wird eine Art Imitation von Subkultur beschrieben, in der es aber Jochen gibt, so „eine Art Farbtupfer“, „in jener Übergangsphase, die nur Landkinder erleben“. Jochen hatte Musik, die die anderen nicht kannten: „Ich mochte die Musik nicht, ich war klassisch sozialisiert. Doch Jochen gefiel mir. So müssen sich liberal-konservative Bürgermeister fühlen, wenn sie ein gut-integriertes Mitglied der Gesellschaft mit Migrationshintergrund über ihren Marktplatz spazieren sehen.“ Mimoun und Jochen haben etwas gemeinsam? In der Außensicht? Warum reden? Einfach schauen! Und wieder sieht es aus, als gäbe es so etwas wie ein falsches Leben im richtigen? Oder doch das richtige Leben im falschen, das es – wenn wir Adorno glauben wollen – eigentlich gar nicht geben sollte? Aber wer will eigentlich darüber richten, welches Leben das richtige ist?
In „Punk Dead“ werden die üblichen pubertären Illusionen von diversen Genüssen beschrieben, auch sie alle Imitate eines anderen Lebens, von dem man eigentlich gar nicht weiß, wie es wirklich sein könnte und ob es das überhaupt außerhalb des eigenen Dorfes gibt: Zigaretten, Jägermeister. Als der Erzähler, der in der ersten Person Plural erzählt, Jochen später wieder trifft, ist dieser zum Unternehmensberater geworden, er will Chinesisch lernen, für die „Karriere“. Ähnlich wie in „Mimoun“ gibt es die Zurückbleibenden und die Reisenden, nur mit dem Unterschied, dass Mimoun offenbar in ein unsicheres Nirgendwo, Jochen jedoch in ein ihn gesellschaftlich erhöhendes Irgendwo reist. Die Mitbewohner:innen in Jochens Dorf und in Mimouns Wohnung, die nicht seine ist, bewegen sich nicht. Sie bleiben wo sie sind. Jochen ließe sich nach seinem Abschied sicherlich finden, Mimoun jedoch wohl kaum. Diejenigen, die zurückbleiben, verbleiben in ihrer ereignisarmen Sprachlosigkeit.
Im Gespräch mit Frédéric Valin über soziale Arbeit und die Politik
Norbert Reichel: Immer wieder gibt es in ihren Büchern die Spanne zwischen Inklusion und Exklusion, auch Exklusion von links, wie sie Peter Bierl beschrieb. Ist Inklusion überhaupt möglich?
Frédéric Valin: Inklusion – so wie sie praktiziert wird – geht nach meiner Erfahrung zu Lasten derjenigen, die inkludiert werden sollten, weil man von ihnen mehr verlangt als vom Rest der Gesellschaft. Wenn es dann keinen politischen Anspruch gibt, den die soziale Arbeit zurzeit als Fach nicht ausreichend hat – auch wenn es einzelne Bereiche und Akteure gibt, die politisch denken- funktioniert das nicht. Eigentlich kämpft die soziale Arbeit darum, dass sie von umgebenden Professionen ernstgenommen wird, Medizin und Jura, das sind die Bereiche, mit denen sie am meisten zu tun haben, die werden ernst genommen, aber soziale Arbeit?
Norbert Reichel: Irgendwie landet soziale Arbeit immer wieder in der Rolle der Feuerwehr, die eingreifen soll, wenn es brennt. Mit kontinuierlicher Prävention hat ein solches Bild oft nichts zu tun. Mit Inklusion schon gar nicht.
Frédéric Valin: Ich zitiere in diesem Kontext gerne Silvia Staub-Bernasconi, eine der Ikonen der sozialen Arbeit, und ihren Professionalisierungsgedanken, innerhalb des Systems die eigene Stellung verbessern. Sie macht es daran fest, dass die soziale Arbeit die Profession der Menschenrechte wäre, sie nimmt damit Partei für die Entrechteten. Das halte ich für eine Fehlannahme, die Menschenrechte sind auch in Medizin und Jura von Bedeutung, sie sind die Grundlage aller Gemeinschaft. Das als Profession für sich zu reklamieren, scheint mir gleichermaßen anmaßend und unklug. Es kann außerdem nicht nur darum gehen, Zumutungen auszugleichen, es braucht auch eine positive Vision, sonst brennst Du ja aus.
Norbert Reichel: Das kenne ich aus der Schule. Die Jugendhilfe, die soziale Arbeit ist dazu da, die Probleme zu lösen, die Schule nicht lösen kann. Schule delegiert ihre Verantwortung für alles, was ihr schwierig erscheint, auf die soziale Arbeit. Die soll es dann richten. Soziale Arbeit gerät dann manchmal in die Rolle einer Art Heilslehre. Der Pädagogik geht es dann wie Medizin und Jura, alles nur wirkungslose Technik.
Frédéric Valin: Absolut. Das ist dann auch so ein Marker. Überall wo die soziale Arbeit aktiv wird, da ist ja schon ein Problem. Das stigmatisiert die Betroffenen und die Profession! Die Schule – das höre ich auch von Freundinnen und Freunden – ist das größte schwarze Loch in der sozialen Arbeit. Manchmal hat man Glück, und eine Lehrer:in ist offen, dann kann das klappen, aber wenn man Pech hat und die Lehrer:innen juckt es absolut nicht, sind überfordert, versanden alle Versuche, Hilfe zu organisieren. Fragt man Lehrer:innen, was die Kernaufgaben der Kinder- und Jugendhilfe sind, wissen sie nicht zu antworten.
Norbert Reichel: Ich kann das Beispiel eines Schulaufsichtsbeamten nennen, der meinte, die Jugendhilfe wäre nur für Jugendliche, aber nicht für Kinder zuständig. In der Grundschule hätte sie daher nichts zu suchen. Im Jahr 2022! Kein Einzelfall.
Frédéric Valin: Ja, das meine ich. Und es ist nicht nur die Schule. Das Problem einer Unsichtbarkeit der Sozialen Arbeit und der Pflege besteht fast überall. In der öffentlichen Wahrnehmnung wird das dann oft zu so einem undefinierten Brei.
Norbert Reichel: Wir müssen auch ambulante Hilfen von stationären Einrichtungen unterscheiden. Menschen, die in geschlossenen Einrichtungen leben, haben eine Gemeinsamkeit: sie wurden aus ihrem ursprünglichen Lebenszusammenhang herausgerissen, oft ohne jede Rückkehroption. Förderschulen funktionieren als teilstationäre Einrichtungen ganz ähnlich.
Frédéric Valin: Das ist auch das Elend der UN-Behindertenrechtskonvention. Deutschland hat diese erst sehr spät ratifiziert und setzt sie nicht um. Während der Pandemie hat man gesehen, wie schnell die Einrichtungen wieder zu Verwahranstalten, zu besseren Gefängnissen wurden. Da spielt einiges eine Rolle, auch die Idee der Behindertenwerkstätten, die ihren Auftrag nicht erfüllen, weil sie billige Arbeitskräfte bieten. Das ist pure Ausbeutung. Ich habe einmal eine besichtigt, in der die Menschen Fußbodenheizungen und Bindungen für Langlaufskier herstellten. Sie wurden mit 100 EUR im Monat abgespeist.
Norbert Reichel: Das liegt niedriger als Gefängnisgehälter. Es gibt für die Arbeit in Gefängnissen ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dass diese mit zwei EUR pro Stunde nicht zulässig waren! (Urteil vom 20. Juni 2023, Az. 2 BvR 166/16; 2 BvR 1683/17)
Frédéric Valin: Eigentlich sollte die Arbeit in einer Behinderteneinrichtung, einer sogenannten „Beschützenden Werkstatt“, den Weg in den Ersten Arbeitsmarkt ermöglichen, aber für die meisten Menschen ist das eine Sackgasse, da kommt vielleicht ein Prozent der Leute wieder raus.
Das Wichtigste ist, die Leute zu bestätigen, auch wenn sie einen nerven. Ihre Leistungen anerkennen. Die körperliche Belastung der Arbeit habe ich nicht beschrieben, weil das schnell zu einem voyeuristischen Blick führt. Das liest man oft in solchen Büchern und es macht die Leute zu Freaks.
Norbert Reichel: Hilft politisches Engagement?
Frédéric Valin: Generell schon. Aber ich bin dafür nicht so richtig gut gemacht. All diese Sitzungen, diese Gremien. Ich habe Freund:innen, die sich politisch engagieren, die erreichen auch wichtige Dinge. Ich bin eher jemand, der im Hintergrund Expertise beisteuert. Politik braucht eine Art von Geduld, die ich nicht aufbringen kann.
Norbert Reichel: Das ist auch viel Beziehungsarbeit, man muss zu Leuten nett sein, zu denen man das eigentlich nicht sein möchte.
Frédéric Valin: Das kann ich auch nicht so gut.
Norbert Reichel: Im politischen Spektrum sehe ich Sie eher auf der linken Seite, aber das ist zurzeit auch keine einfache Sache. Die sozialistische Partei in Frankreich ist marginalisiert und wird auf absehbare Zeit wohl kaum die Chance haben, eine Präsidentschaftswahl zu gewinnen.
Frédéric Valin: Es gibt so viele Fehleinschätzungen von der Seite der Linken. Viele dachten anfangs, Emmanuel Macron wäre auch ein Linker. Sie ließen sich von dem Bewegungscharakter seiner Partei täuschen. Zwei Faktoren sind dabei augenscheinlich wichtig: seine entschiedene Ablehnung des Front National beziehungsweise des heutigen Rassemblement National und seine pro-europäische Haltung. Das haben viele mit einer linken Position verwechselt. Diese Verwechslung fand ich häufiger, sogar in der taz, vor allem bei Leuten, die dem Realo-Flügel der Grünen nahestehen.
Norbert Reichel: Die Akteure des Realo-Flügels der Grünen sind gut bürgerlich, liberal, urban, in der Regel sehr gebildet und finanziell gut situiert, aus meiner Sicht durchaus vergleichbar mit dem sozialliberalen Flügel der FDP in den 1970er Jahren mit Gerhart R. Baum, Hildegard Hamm-Brücher oder Karl-Hermann Flach.
Frédéric Valin: Und ein bisschen Ökologie dazu. Im Pflegebereich findet man manchmal übrigens sogar bei der FDP ganz interessante Positionen.
Norbert Reichel: Mit Gerhart R. Baum habe ich mal über das ökologische Programm der FDP-Innenminister der frühen 1970er Jahre sprechen können, das Helmut Schmidt dann kaputt gemacht hat. In der zweiten Hälfte der 1970er Jahre entwickelte sich dann auch die FDP wieder vom Sozialliberalen zum Neoliberalen hin, was ja auch in der SPD eine Rolle spielt, die sich dann spätestens mit der Regierung Schröder auf die neoliberale Seite schlug.
Frédéric Valin: Das ist die Zeit, in der ich politisiert wurde. Eine der großen Tragödien meiner politischen Großwerdung ist das Scheitern der Anti-G8-Proteste, die ihr Ende fanden mit den Anschlägen auf das World-Trade-Center und mit Genua. Es gab viel Mobilisierungspotenzial, aber auf diese Anschläge hatte die globalisierungskritische Linke keine Antwort mehr.
Norbert Reichel: Es gab schon einige Bewegungen: Attac, Occupy Wallstreet, mit Vorbehalt nenne ich die französischen Gelbwesten, die aber bei Weiten nicht so reflektiert agieren wie beispielsweise die Gründer:innen von Attac.
Frédéric Valin: Die Gelbwesten sind nur vom Namen her eine Bewegung. Die lokalen Bündnisse haben völlig verschiedene Ziele, agieren in unterschiedlichen Gemengelagen. Das haben viele für links gehalten, das sehe ich anders.
Outsider und Insider im Fußball
Fußballspieler haben in der Regel keine finanziellen Probleme, sie sind auch in der Regel eher apolitisch. Aber nicht immer, manche sind zumindest als Figuren des öffentlichen Lebens politisch präsent, selbst wenn sie sich selbst nicht äußern, sondern schweigen. Frédéric Valins Essay „Zidane schweigt“ fängt recht dramatisch an: „Der Titelgewinn 1998 kommt zu einer untypischen Zeit: Gerade in Frankreich sind die 90er eine Zeit des Niedergangs, eine Epoche der lähmenden Krise. Nach Fukuyamas ›Ende der Geschichte‹ füllen Apokalypsen die Feuilletons: Der Kommunismus ist passé, die Revolution endgültig Historie, selbst die Literatur gilt als erledigt. Das Land ist müde. Seit 1974 geht nichts mehr voran.“
Dann kam vieles anders und manchmal gingen auch die falschen Dinge voran. Aber der französische Fußball feiert immer wieder Erfolge. Fußball als Politikersatz? Frédéric Valin benennt die sportlichen Erfolge Frankreichs in den 1990er Jahren, zu denen eben Namen wie die Sprinterin Marie-Jo Pérec, die Fechterin Laura Fessel, der Judoka Djamel Bouras, die Eiskunstläuferin Surya Bonalys und der Fußballer Basile Boli gehören. Es ist die Zeit, in der die Eingewanderten in Frankreich sichtbar werden, eben gerade auch über ihre Erfolge im Sport, die aber vielleicht auch ein Erfolg des Bildungssystems sind. Sie sind Outsider, die Insider werden, zumindest für eine bestimmte Zeit. Welche Stimme haben sie, finden sie Gehör? Und wenn sie es findet, ist das von Dauer?
Zunächst ist da die Euphorie in der Sportnation Frankreich, die sich neu entdeckt, nachdem sie lange Zeit – so Frédéric Valin – eher den Ruf des sympathischen Verlierers hatte. „Die Ära des Erfolgs kommt nicht zufällig. Freilich, Leistungssport ist sich selbst nie genug, seine Organisation folgt einer Ideologie. Schon zu Beginn des neuzeitlichen Sports, im England der 1830er Jahre, legen die Gründungsväter Wert darauf, dass durch ihn moralische Ideale vermittelt würden. Diese Ideale – wie beispielsweise das ‚fair play‘ – sind vage genug, um anschlussfähig an ganz unterschiedliche politische Strömungen zu bleiben, sie schwingen im Hintergrund immer mit, ohne offen ausgesprochen werden zu müssen. In Frankreich haben bereits in den 60ern Kommunisten und Gaullisten in seltener Einigkeit daraus eine politische Doktrin gemacht. Der Sport als gesellschaftlicher Zement und Mittel der Erziehung.“
Zu den zentralen Figuren des französischen Sports und der französischen Politik gehört aber auch Bernard Tapie, Manger von Olympique Marseillais, der als Unternehmer unter anderem mit adidas einige Erfolge hatte, Minister wurde, dann aber zu einer Haftstrafe verurteilt wurde, sich aber auch sichtbar gegen den Rechtsextremismus eines Jean-Marie Le Pen engagierte und in Marseille einen so gut wie aussichtslos erscheinenden Wahlkreis für den Parti socialiste gewann. Er war der einzige, der im Fernsehen mit Jean-Marie Le Pen diskutieren wollte. Zum Schluss legte die Moderatorin beiden Boxhandschuhe auf den Tisch. Tapie und Zidane sind im Grunde die beiden komplementären Hauptfiguren des Essays „Zidane schweigt“.
Zunächst gewinnen beide, der Laute und der Leise, aber beliebt ist vor allem der Leise: „Die Republik gibt sich neue Farben: nicht ‚bleu blanc rouge‘, sondern ‚black blanc beur‘ soll das neue Frankreich sein. Jacques Chirac spricht von einer ‚France tricolore et multicolore‘, Zidane gilt Fernsehumfragen zufolge als beliebtester Franzose.“ Das heißt nicht, dass die Bevölkerung das auch durchgehend akzeptiert. Etwa ein Drittel ist der Meinung, dass zu viele Schwarze im Sport aufträten. Frédéric Valin beschreibt im Detail die Tradition – man muss diesen Begriff tatsächlich so wählen – der Aufstände in französischen Vorstädten, brennende Autos, Polizeigewalt. Von Vielfarbigkeit ist nicht mehr die Rede. Etwa zwölf Jahre später sieht das in Frankreich schon anders aus. Es kommt die Zeit, in der Nicolas Sarkozy die Vorstädte mit dem Hochdruckreiniger (er sagt: „un Kärcher“) säubern möchte, eine Formulierung, die auch heute noch von manchen französischen Politiker:innen nicht ohne Zuspruch verwendet wird. Die schwäbische Firma Kärcher kann sich nicht dagegen verwahren. Es ist die Zeit, in der die französische Kolonialpolitik als zivilisatorisches Programm in die Schulbücher hineingeschrieben wird. Auch das ein Produkt der Regierungszeit von Sarkozy. Ein Fußballspiel zwischen Frankreich und Algerien im Stade Saint-Denis am 6. Oktober 2001, kurz nach 9/11, wird zum Skandal. Ein Meer von algerischen Fahnen, bei der französischen Nationalhymne pfeifen viele Zuschauer:innen, und Zinédine Zidane wird jetzt (auch oder vorwiegend?) zur Ikone der Eingewanderten.
Die „Ethnifizierung sozialer Konflikte“ nahm ihren Lauf. „Zidane schweigt“ – das ist nicht nur eine exzellente Analyse der Höhen und Tiefen des französischen Fußballs, das Buch bietet eine ebenso exzellente Analyse der Politik und nicht zuletzt des Aufstiegs des Front National ungeachtet der diversen antisemitischen und rassistischen Ausfälle von Jean-Marie Le Pen, zunächst nicht im Parlament, nicht in den Präsidentschaftswahlen, die er nie im Entferntesten gewinnen konnte, wohl aber auf dem Weg zur Meinungsführerschaft, die sich inzwischen auch in anderen Ländern auswirkte. Die heutige Zeit hat Frédéric Valin natürlich noch nicht in diesem Buch berücksichtigen können, aber die heutige Entwicklung kommt dem Bild sehr nahe, das Thea Dorn in einem ZEIT-Artikel für die Strategie von Marine Le Pen und Giorgia Meloni verwendet, die in der Öffentlichkeit sich als „Löwenmütter“ zu präsentieren verstehen. Es folgen Allianzen wie sie Thomas Biebricher in seinem Buch „Mitte / Rechts“ beschrieb. Die Konservativen verschwanden und ihre Wähler:innen schwenkten zum Rassemblement National über, nur die eher Vorsichtigen blieben Emmanuel Macron treu, der die Wahlen im Jahr 2022 immerhin noch mit etwa 60 Prozent der Stimmen gewinnen konnte.
Doch zurück zu Zinédine Zidane: „Zidane spricht sehr wenig. Was er ist, was er bedeutet, das lässt er Andere sagen. Er ist das wortlose Zentrum der Erzählungen, eine Hemingway-Figur. Es sind die Anderen, die viele Worte um ihn machen. Zidane ist ein postmoderner Held; einer, der Widersprüche in sich vereint, Projektionsfläche für alle. Verschiedene Konzepte von Identität fallen in ihm scheinbar mühelos zusammen: Er ist der Migrant, der dem Land seiner Vorfahren verbunden bleibt, indem er dort immer wieder humanitäre Projekte unterstützt und öffentlich seine Zuneigung zu Algerien bekundet; er ist aber auch der Vorzeigefranzose, einer der beliebtesten ‚compatriotes‘, der 1998 nach seinem Tor sein Trikot küsst und zu dessen Feier man überall Plakate klebt. Er ist bekennender Muslim, lebt seine Religion aber nicht öffentlich. Er ist das technische Genie am Ball, ein brillanter Vorbereiter, der aber in den wichtigen Spielen seine Tore macht, und gleichzeitig ein unbeherrschter Hitzkopf, der sich in seiner Karriere zehn Platzverweise eingefangen hat.“
Die Abgänge von Bernard Tapie und Zinédine Zidane können unterschiedlicher nicht sein, aber dennoch zeigen sie gleichzeitig die unterschiedlichen Möglichkeiten von Außenseitern, die es ins Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit schaffen, exemplarisch. Doch wer erinnert sich noch an Tapie? Zidane hingegen schaffte es schließlich auch zu einer Hass-Figur, auch dank mancher pseudo-Intellektuellen, unter denen Frédéric Valin Alain Finkielkraut hervorhebt, der es versteht, emotionales Grummeln und Unbehagen zuzuspitzen und zu dramatisieren: „Finkielkraut hat damit den Ton vorgegeben, wie zukünftig über die Mannschaft gesprochen wird. Alles an der Identität der Spieler wird in Frage gestellt: ihr Geld, ihre ethnische Herkunft, ihre soziale Herkunft, ihre Intelligenz. Éric Zemmour, eine Mischung aus Sarrazin und Fleischhauer, bekennt in einer Fernsehsendung: ‚Ich denke, dass Domenech Politik macht, indem er nur schwarze Spieler einsetzt.‘ Die Politik selbst zieht nach. Roselyne Bachelot, die Sportministerin, hält gar eine Rede vor dem Parlament. Es klingt fast so, als würde sie vom Pausenhof einer Problemschule berichten, wenn sie vom ‚Desaster einer französischen Nationalmannschaft‘ spricht, in der ‚unreife Clanführer verängstigte Kinder bevormunden‘.“
Sarkozy versteht es meisterhaft, diese Stimmungen aufzugreifen und ist dann auch der „Sargnagel“ für Jean-Marie Le Pen, aber gleichzeitig dann auch der Wegbereiter für Marine Le Pen und ihre „dédiabolisation“ des Front National, der sich jetzt auch im Namen entmilitarisiert und als eher harmlose Sammlungspartei, als „rassemblement“ inszeniert. Dem möglichen Multikulturalismus, den Chirac noch mit seiner Formel von der drei- und vielfarbigen französischen Fahne lobte, fehlte die Grundlage, weil Frankreich – so Frédéric Valin – keine liberale Tradition habe, sondern sich eher in einer Art ständigem Verfall suhlt. „Der Multikulturalismus hat kein überzeugendes Schlagwort gefunden, nur Formeln, die eine Verschlagwortung unterminieren sollen. Eine echte Theorie gibt es nicht.“ Vielleicht ist es das.
Im Gespräch mit Frédéric Valin über Veränderungen im Fußball
Norbert Reichel: Mir hat in Ihrem Zinédine-Zidane-Buch gefallen, wie Sie Politik und Fußball parallelisierten. Eine Fortsetzung wäre meines Erachtens interessant.
Frédéric Valin: Das Zidane-Buch hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber eine Fortsetzung ist schwierig. Die eine Ausnahmegestalt im französischen Fußball gibt es so nicht mehr, vielleicht wieder mit Kylian Mbappé? Eventuell bietet sich das an. Ich warte natürlich auch auf das Buch über Zlatan Ibrahimovic. Ich hoffe, dass es das mal gibt.
Norbert Reichel: Und Deutschland? Ich habe mal den Versuch gewagt, über afrikanischen und afrodeutschen Fußball zu schreiben. Es ist natürlich immer ein Blick aus der weißen Perspektive. Sie kennen die Biographie der drei Boateng-Brüder von Michel Horeni (Die Brüder Boateng – Drei deutsche Karrieren, Stuttgart,Klett-Cotta, 2012).
Frédéric Valin: Ich wohne etwa da, wo George und Kevin-Prince aufgewachsen sind. In Deutschland würde ich mir aber Mesut Özil als Figur auswählen.
Norbert Reichel: Mesut Özil würde passen, gerade auch in all den Widersprüchen einer halbherzigen Integrationspolitik, mit der wir ihn meines Erachtens im Grunde in die Arme Erdoǧans getrieben haben. Dietrich Schulze-Marmeling hat 2018 ein Buch über ihn veröffentlicht (Der Fall Özil – Ein Foto, Rasssismus und das deutsche WM-Aus, Göttingen, Die Werkstatt, 2018). Gelsenkirchener Umfeld, Gesamtschule Berger Feld, eine Schule, die eng mit dem FC Schalke 04 zusammenarbeitet. Da waren auch die beiden Altintops und Manuel Neuer. Der eine Altintop spielte für Deutschland, der andere für die Türkei, ähnlich wie bei Kevin und Jérôme Boateng, die für Ghana beziehungsweise für Deutschland spielten. Als die gegeneinander spielten, kündigte die BILD-Zeitung das mit der Schlagzeile an: „Wedding gegen Wilmersdorf“. Aber wahrscheinlich wird das angesichts des Skandals um Jérôme Boateng eher schwierig.
Frédéric Valin: Es wäre mir unangenehm, darüber zu schreiben, auch im Kontext der Skandale um Ribéry oder Benzema. Paul Pogba könnte noch eine interessante Figur sein, als Gegenfigur zu Antoine Griezmann, der vielleicht der intellektuellste erfolgreiche Spieler ist, der sich öffentlich auch für LSBTIQ* einsetzt. Ich habe mal ein Interview mit Lilian Thuram gemacht, der auch ein Intellektueller ist. Ich habe ihn nach der jüngeren Spielergeneration gefragt. Das Aufstiegsversprechen des Fußballs spielt dabei eine Rolle. Fontainebleau, die Nachwuchsakademie des französischen Fußballs war darin sehr erfolgreich, weil sie den Aufstieg erleichterte, allerdings um den Preis, dass man jetzt eine unpolitische, eher hedonistische Generation bekam. Das war früher anders, da gab es in den Talkshows auch Fußballer, die über Rassismus und andere soziale Themen sprachen, zum Beispiel Thierry Henry, das gibt es in dieser Form so gut wie nicht mehr.
Norbert Reichel: Ribéry spielt schon eine Rolle im Zidane-Buch, aber das ist nun wieder eine andere Geschichte. Auch über Thierry Henry schreiben Sie im Zidane-Buch. Ich darf eine Passage zitieren, die meines Erachtens geradezu optimistisch stimmen könnte. Als ich sie las, dachte ich: gäbe es diese Leichtigkeit doch auch in der Politik! „Thierry Henry spielt Fußball, wie ein idealer Gastgeber eine Abendgesellschaft führt: Alles, was er tut, wirkt leicht und mühelos, dabei aber immerzu überraschend. (…) Außergewöhnlich macht ihn seine Flexibilität. Stellt man Henry, wie Wenger das in den ersten Jahren tut, in die Mitte, wird er von da Tore machen; stellt man ihn auf den Flügel, macht er zwar weniger Tore, aber stattdessen wird er sie seinen Mitspielern verschaffen. Als er später von der Mitte weggezogen wird, avanciert Henry zum perfekten Vorbereiter: Wie später Klose fehlt ihm die Eitelkeit, sich an persönlichen Quoten messen zu lassen. Er ist ein Stürmer, in dem der Geist des untergegangenen Spielmachers weiterlebt.“
Frédéric Valin: Später habe ich erfahren, dass diese Leichtigkeit bei Henry einherging mit schweren Depressionen. Diese Heroen sind in ja zumeist ambivalent. Entsprechend werden Legenden gestrickt, zum Beispiel um Mbappé, der nicht aus dem „Ghetto“ kommt, wie man denkt, sondern aus einer Mittelschichtfamilie. Das teilt er mit vielen Fußballern der neueren Generation, die interessieren sich nicht mehr so sehr dafür, diese Art von politischer Öffentlichkeit herzustellen. Das hat aber auch damit zu tun, weil der Rassismus in den 1990er Jahren brutaler war als er das heute ist. Da konnte das nur von Sportler:innen und Musiker:innen thematisiert werden, weil das die Bereiche waren, die als erstes eine gewisse Durchlässigkeit hergestellt haben. In Deutschland gab es solche Sendungen in der Form nicht und es gibt sie bis auf wenige Ausnahmen auch heute nicht. Nicht bei Lanz, nicht bei Maischberger.
Aber vom Fußball bin ich inzwischen doch eher weit abgekommen und habe das durch Schach ersetzt. Eine absurde Sportart, sehr schlecht fürs Ego, also gut für die Persönlichkeit.
Wie es weitergeht mit der Entwicklung des Autors Frédéric Valin, das kann er noch nicht genau sagen. „Ich habe ein halbes Dutzend interessanter Ideen und Ansätze, aber vor allem habe ich jetzt auch ein Kind. Ich hoffe, ich kann der Versuchung widerstehen, ein Buch darüber zu schreiben, Vater zu sein, davon gibt es ja schon mehr als genug.“
Die Bücher von Frédéric Valin im Verbrecher Verlag:
- Randgruppenmitglied (2010, zurzeit vergriffen, Neuauflage laut Auskunft des Verlages für 2025 vorgesehen).
- In kleinen Städten (2013).
- Zidane schweigt (2018, nur als e-book erhältlich).
- Pflegeprotokolle (2021).
- Ein Haus voller Wände (2022).
Norbert Reichel, Bonn
(Anmerkungen: Erstveröffentlichung im November 2023, Internetzugriffe zuletzt am 20. November 2023. Das Titelbild zeigt eine der Siedlungen an der Algarve, wie sie im Text erwähnt werden, Foto: Joseywales1961, Wikimedia Commons, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.)