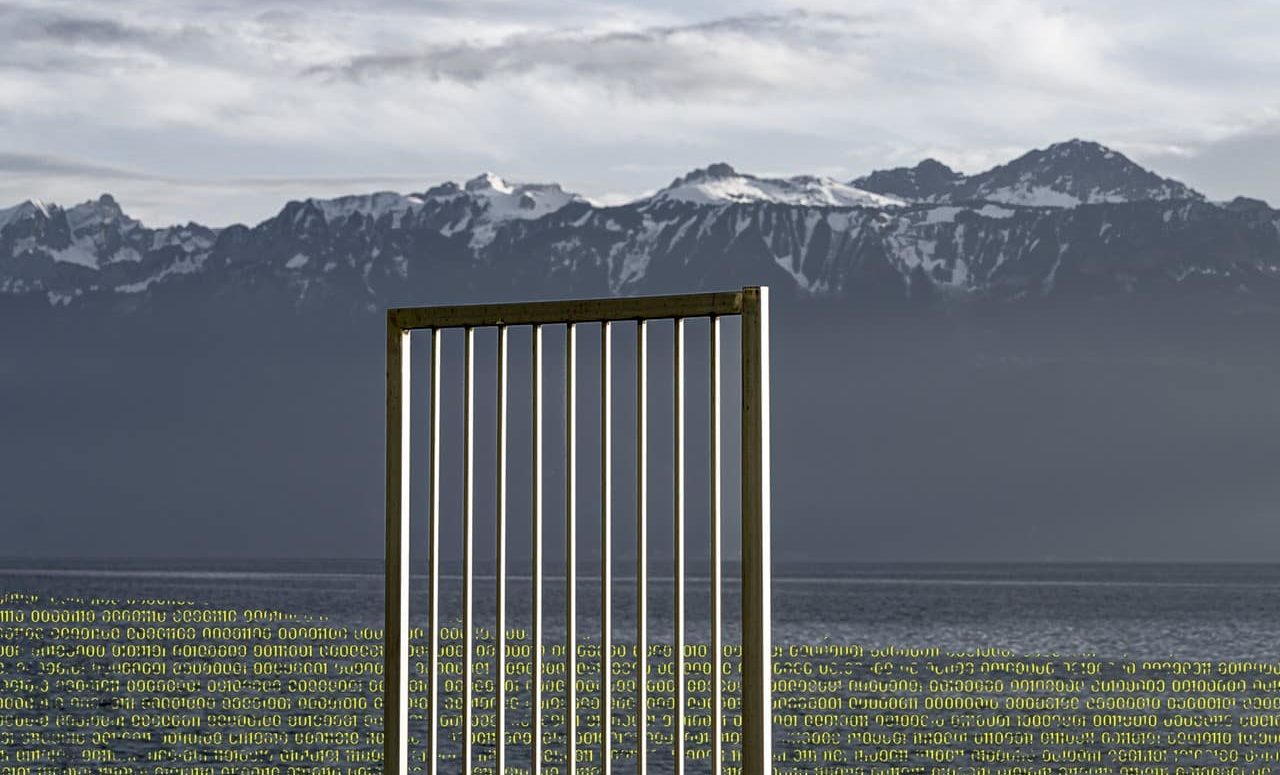Deutschland, Europa und die USA
Kommunizierende Röhren: Geopolitik, Bürgerrechte, Sozialpolitik
„Amerika ist kein verlässlicher Partner mehr, noch ist es eine Kraft, die auf der internationalen Bühne von Nutzen ist. Seine ständig wachsende Selbstsucht und Feigheit haben zur Aufgabe des Anspruchs auf eine moralische Führungsrolle beigetragen, den es einst erheben konnte, ohne dass es absurd wirkte. Wenn es in den kommenden Jahrzehnten eine solche Führungsrolle in internationalen Angelegenheiten geben sollte, muss sie von anderswoher kommen. Die wahrscheinlichste Quelle ist ein selbstsicheres, auf sich selbst bauendes, stolzes und geeintes Europa.“ (Richard Rorty, Europa sollte auf sich selbst bauen, in: Europa oder Amerika? Zur Zukunft des Westens, Sonderheft Merkur September / Oktober 2000)
2000: Das ist kein Tippfehler! Es war das Jahr 2000, in dem der amerikanische Literaturwissenschaftler und Philosoph Richard Rorty (1931-2007) diese Sätze schrieb. Sie erschienen zwei Monate vor der Präsidentschaftswahl in den USA, die George W. Bush gegen Al Gore gewann, nicht, weil er landesweit die meisten Stimmen erhalten hatte, sondern weil er es schaffte, die ausreichende Zahl an Stimmen im Electoral College zu erhalten. Präsident war damals noch Bill Clinton. Florida, heute fest in republikanischer Hand, war noch ein Swing-State, in dem sich die Präsidentschaftswahl 2000 entscheiden sollte.
Will man die illiberalen Entwicklungen, die sich seit den frühen 2000er Jahren in fast allen westlichen Demokratien verstetigten, beschreiben, ergeben sich drei grundlegende Aspekte: Die Eigenständigkeit Europas (Stichwort: Wehrhafte Demokratie), die Freiheit von Wissenschaft und Kunst sowie der Respekt der Menschen- und Bürgerrechte (Stichwort: Liberale Demokratie), die Wirtschafts- und Sozialpolitik (Stichwort: Sozialliberalismus). Alle drei genannten Aspekte gehören untrennbar zusammen. Das eine ist nicht ohne das andere denkbar.
Die geopolitische Rolle Europas
25 Jahre nach der Analyse von Richard Rorty: Die Methode Trump ließe sich als amerikanische Variante von Faschismus beschreiben, aber wer sich auf eine solche Etikettierung beschränkt, macht es sich zu einfach. Viel wichtiger ist es, das zugrundeliegende Drehbuch zu analysieren. Dieses folgt letztlich vor allem dem Modell der illiberalen Demokratie unter Viktor Orbán in Ungarn, nur mit dem Unterschied, dass die USA geopolitisch über eine Macht verfügen, die Ungarn nicht hat.
Die Drehbücher der europäischen Politik der vergangenen 80 Jahre variierten immer wieder den binären Code einer geopolitischen Rivalität zwischen der Sowjetunion beziehungsweise dem heutigen Russland auf der einen Seite und den USA auf der anderen Seite. Mal entspannter, mal angespannter. Unter Trump drohen die USA zu dem Bild zu werden, das anti-amerikanische Apoleget:innen immer schon hatten, oft genug einhergehend mit einer Verharmlosung Russlands beziehungsweise der Sowjetunion. Es ist daher an der Zeit, gerade auf der Grundlage einer Analyse der vergangenen Jahrzehnte einen realistischen Blick auf die Unterschiede und Rivalitäten zwischen den USA und der Europäischen Union zu entwickeln. Daraus lassen sich die zukünftigen Elemente eines liberalen und demokratischen Europas ableiten und – so ist zu hoffen – auch die einer Rückkehr der USA zu den Grundsätzen einer liberalen Demokratie.
In der zitierten Ausgabe des Merkur, der Zeitschrift, die heute den stolzen Untertitel „Zeitschrift für europäisches Denken“ trägt, im Jahr 2000 noch mit dem Attribut „Deutsche Zeitschrift für europäisches Denken“ versehen, schrieb der deutsche Politologe Werner Link (1934-2023) über „Europäische Sicherheitspolitik“. Der Untertitel seiner Analyse lautete gut kantianisch: „Der Ausgang Europas aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit“. Es ist das Erbe der Aufklärung, das nicht nur das heutige Europa, sondern auch die Entstehung der USA prägt beziehungsweise zumindest prägen sollte.
Es lohnt sich, die Texte von Rorty und Link und so manch andere Texte dieser im Jahr 2000 – ich wiederhole mich – erschienen Ausgabe des Merkur neu zu entdecken. Man wird eine Menge an Hinweisen finden, wie bereits in früheren Zeiten die US-Regierung, so zum Beispiel Präsident Richard Nixon zu Beginn der 1970er Jahre, „mit dem Entzug der amerikanischen Sicherheitsgarantie drohte“ und welche Bedeutung die NATO für die USA jeweils hatte und wie sie oft genug gleichzeitig von ihr in Frage gestellt wurde.
Werner Link referiert eine Fülle von europäischen Initiativen, EU-Gipfeln, in denen Beschlüsse gefasst wurden, „Krisenverhütung und Krisenbewältigung“ gemeinsam zu organisieren. „Präsident Bush (der ältere Bush, NR) opponierte vehement gegen die deutsch-französische Initiative, die WEU zum verteidigungspolitischen Arm der EU und ein Euro-Korps zum Kern einer unabhängigen europäischen Militärstruktur zu machen.“ Es wurde sogar darüber gestritten, ob europäische Staaten nicht erst die NATO anfragen sollten, ob sie reagieren sollten. Gibt es ein „Primat der NATO“? Nur am Rande: Der einzige Staatschef, der in den letzten zehn Jahren diese Fragen ernst nahm, war Emmanuel Macron. Viel Gehör fand er nicht. Dies scheint sich allerdings offensichtlich zurzeit angesichts des durchweg anti-diplomatischen Vorgehens von Trump zu ändern. Keir Starmer und Emmanuel Macron gehen voran, hoffentlich bald gemeinsam mit dem deutschen Bundeskanzler und nicht zuletzt dem polnischen Premier Donald Tusk, in einer Art Weimarer Dreieck Plus.
Richard Rorty berichtet, dass Bill Clinton Europa bei seinen Abschiedsbesuchen vor der Wahl im Jahr 2000 zu mehr Unabhängigkeit geraten habe. Dies wäre „das Beste, was Amerika passieren könnte. (…) Ein starkes und geeintes Europa – ein Europa, das den Gedanken fahrengelassen hat, dass Amerika Europas Probleme lösen oder ihm sagen werde, was zu tun sei – kann den USA die blitzartige Einsicht vermitteln, dass es sein Gewissen und seine Ideale verloren hat. Ein solches Europa – und besonders ein Europa, das sich selbst fähig zeigte, schnell und entschlossen mit Gestalten vom Schlage Milošević und Saddam Hussein fertig zu werden, würde die Amerikaner in Staunen versetzen über das, was aus der zuvor unbestrittenen Position ihres Landes als des ‚Führers der freien Welt‘ geworden ist. Solche Verwunderung könnte der Beginn unserer moralischen Erneuerung sein. In diesem Sinne könnte die Alte Welt der Neuen als Rettung dienen.“
Richard Rorty würde heute wohl nicht mehr davon sprechen, Europa könne „gemeinsam mit Putin Amerikas verrückten, jämmerlichen Plan brandmarken, einen Star-Wars-Schutzschild über sich aufzubauen.“ Angesichts der heutigen Ausstattung des Weltraums mit Satelliten verschiedener Art, die in Kriegen die Abwehr von Angriffen beziehungsweise deren Zielgenauigkeit unterstützen, wirkt diese Mahnung ohnehin völlig aus der Zeit gefallen. Und auch Putin hatte sich damals noch nicht als der geoutet als den wir ihn jetzt kennen und als den wir ihn schon bei seinen Reden aus dem Jahr 2007 im Bundestag auf der Münchner Sicherheitskonferenz sowie in so mancher Andeutung seiner Rede aus dem Jahr 2001 im Bundestag hätten erkennen sollen. Zu sehr glaubten wir in Europa – ich schreibe bewusst „wir“ – an vermeintlich gute Absichten, sahen aber durchaus in den USA bedenkliche Entwicklungen, nicht zuletzt mit dem 2002 begonnenen Krieg der USA im Irak, der zwar Saddam Hussein vertrieb, aber zugleich viele anti-amerikanischen Ressentiments der Zeit des Vietnamkrieges wiederbelebte, von denen wiederum Putin profitierte. Gleichwohl richteten vor allem wir Deutschen uns unter dem US-amerikanischen nuklearen Schutzschirm gemütlich ein.
Trump ist kein Nazi, aber er lässt sich von Nazis und Faschisten unterstützen, wenn er meint, dass es ihm nützt. Wenn sein Vize auf der Münchner Sicherheitskonferenz die AfD lobt und Elon Musk sich gerne mit europäischen Faschist:innen und Postfaschist:innen trifft (das italienische Geschäft liegt allerdings vorerst auf Eis), geht es ihnen vor allem um Spaltung Europas. Wenn Trump nicht mehr mit der EU verhandeln muss, sondern sich stattdessen mit jedem Staat einzeln verständigen könnte, wäre es für ihn leichter, seine Agenda umzusetzen. Trump hält – zumindest nach seinen Äußerungen – die bloße Existenz der EU ohnehin schon für einen Angriff auf die USA und offenbar die NATO für ein Geschäftsmodell (kauft US-Waffen!). Einige nationalistische Regierungen und Parteien in Europa (Our Country First!) helfen ihm, wenn auch nicht alle. Das hat erst einmal nichts mit irgendeiner Ideologie zu tun. Es ist ein Geschäftsmodell im Kleid einer spezifisch amerikanischen Art von Faschismus. Wir hätten Vorstufen bereits erkennen können, haben aber wie die US-amerikanischen Demokraten auch geglaubt, es reiche, Trump als Faschisten, Nazi oder gleich als den Gottseibeiuns zu markieren. Eine eigene europäische – beziehungsweise in den USA demokratische – Strategie entstand so nicht und bei Europawahlen wie bei nationalen Wahlen handelten die demokratischen Parteien nicht wesentlich anders.
Europa scheint aufzuwachen. Die von EU und Deutschem Bundestag beschlossenen Finanzpakete für eine eigenständige, von den USA unabhängige Verteidigungspolitik sowie – zusätzlich in Deutschland – ein eigenes umfassendes Infrastrukturpaket wurden zwar erst möglich, nachdem Trump vor laufender Kamera den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Selenskyj abgekanzelt hatte (die Rede von JD Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz hatte dazu noch nicht ausgereicht), aber es ist nun des Öfteren in der Politik so, dass diejenigen, die eine bestimmte Maßnahme, hier die Aufhebung der sogenannten „Schuldenbremse“, grundsätzlich ablehnten, diese dann doch befürworten, weil sich die Gegebenheiten einfach und für alle sichtbar geändert haben. Friedrich Merz und Markus Söder haben sicherlich ein Wahlversprechen gebrochen, wenn sie denn je selbst daran geglaubt haben, es halten zu können.
Verhängnisvoller jedoch war die vorgetragene Ignoranz, es reiche, illegale Migration zu bekämpfen und dies zum Hauptthema des deutschen Wahlkampfes zu machen. Es war absehbar, was in der Präsidentschaft von Trump droht und wie dramatisch sich Klimakrise und militärische Bedrohung durch Russland zuspitzen. Die Unzulänglichkeiten der deutschen Infrastruktur, der Bundeswehr und des Katastrophenschutzes waren bekannt. Aber besser spät als nie. Positiv zu bewerten ist die Einbeziehung ziviler Verteidigung, des Katastrophenschutzes, der Geheimdienste und des Klimaschutzes beziehungsweise der Klimaanpassung in das Paket, die die Grünen durchgesetzt haben. Jetzt kommt es darauf an, die notwendigen Projekte so unbürokratisch wie möglich umzusetzen.
Man muss sich klar vor Augen halten: Die USA ist kein verlässlicher Partner Europas (wenn sie es überhaupt jemals war) und dennoch ist sie nach wie vor Teil des westlichen Bündnisses. Diese Paradoxie wäre aufzulösen: Unabhängigkeit von den USA ist die eine Aufgabe, Rückgewinnung der USA in der Aufklärung verpflichtete liberale, demokratische und rechtsstaatliche Strukturen die andere. Wir Europäer:innen müssen beides im Blick behalten.
Wissenschaftsfreiheit und Bürgerrechte
Der Historiker Thomas Zimmer lehrt zurzeit an der Georgetown University in Washington D.C. In einem Gastbeitrag für die ZEIT schrieb er am 21. März 2025: „Man muss mit dem Schlimmsten rechnen“. Er dokumentiert das unglaubliche Tempo der Maßnahmen des US-Präsidenten zur Einschüchterung und Verfolgung derjenigen, die ihn kritisieren oder einfach – vielleicht passt diese Formulierung besser – nicht passen: So „verkündete das Justizministerium, auf breiter Front gegen Führung und Administration der Columbia-Universität wegen des Verdachts auf „terroristische Verbrechen“ zu ermitteln – weil es an der Universität im vergangenen Jahr propalästinensische Proteste gegeben hatte. Die Regierung legte außerdem eine Liste mit Forderungen vor, denen sich die Universität unterwerfen solle, wenn sie weiter staatliche Förderung beziehen wolle. Dafür müsste die Bildungseinrichtung das Recht abtreten, selbst zu entscheiden, was sie lehrt, woran sie forscht und welche Studierenden sie aufnimmt. Wenige Tage später verkündete die Trump-Administration, der privaten University of Pennsylvania Hunderte Millionen Dollar an Fördermitteln zu streichen, weil sie sich bislang geweigert hat, trans Studierende von organisierten Universitätssportveranstaltungen auszuschließen.“ (Links im zitierten Text von der ZEIT-Redaktion). Es dauerte nur wenige Tage, bis die Columbia Universität allen Forderungen zugestimmt hat. So gibt es jetzt 36 Spezialbeamte, die auf dem Campus Studierende entfernen oder verhaften dürfen, Lehrinhalte insbesondere in allen Fragen, die den Nahen Osten betreffen, werden von einem eigens dafür eingesetzten Dekan beaufsichtigt.
Freiheit – das bedeutet in der Trump-Administration Freiheit von allem, was Trump, Musk und Kolleg:innen nicht passt. All das soll einfach nicht mehr erwähnt werden dürfen. Dann gibt es das auch nicht mehr. Forschung hat es schwer in den USA, Klimaschutz und Biomedizin zum Beispiel, besonders schwer – sofern Steigerungen überhaupt möglich sind – hat es Forschung zu „Diversity, Equity, Inclusion“ (DEI). Im Tagesspiegel berichteten sieben Forscher:innen, zum Teil anonym, was die neue US-Regierung mit ihren biomedizinischen Laboren macht. Die Wissenschaftsredakteurin des Tagesspiegels Farangies Ghafoor fasste die Interviews zusammen. Einige rechnen damit, dass sie im Sommer 2025 ihre Mitarbeiter:innen entlassen müssen, private Mittel sind kaum vorhanden und auch nicht in Aussicht, neue Förderanträge können nicht mehr begutachtet werden. Eine Virologin: „Der gesamte Wissenschaftsbetrieb wird beschnitten. Ich fand viele Diversity-Maßnahmen übertrieben, etwa musste man in Bewerbungsverfahren lange Diversity-Statements einreichen. Aber jetzt erleben wir das andere Extrem. Das ist ideologisch motivierte Wissenschaftspolitik.“ Gesundheitsminister ist mit Robert F. Kennedy ein ausgewiesener Impfgegner und Esoteriker: „Die Förderung für globale Impfstoffgerechtigkeit wurde gestrichen. Das Projekt hatte ‚Gerechtigkeit‘ im Titel.“
In einem weiteren Artikel berichtete Farangies Ghafoor von Selbstzensur: „Der Angriff auf die Forschungsfreiheit scheint dabei weit umfassender als erwartet. Nicht nur Begriffe wie ‚Gender‘ und ‚Diversität‘, sondern auch ‚Frauen‘, ‚Bias‘ oder ‚systemisch‘ gelten als problematisch – Studien, die sie verwenden, müssen überprüft werden. Das hat schon jetzt Konsequenzen. Forschungsdaten zu Gesundheit, Umwelt und sozialen Ungleichheiten verschwinden von Regierungsseiten. Die Folge: Forschende zensieren sich selbst, aus Angst vor Repressionen.“ Ob verschiedene Gerichtsurteile und Demonstrationen den wissenschaftsfeindlichen Trend umkehren können, muss nach derzeitigem Stand der Dinge bezweifelt werden. Farangies Ghafoor berichtete, dass einige Forscher:innen daran dächten, die USA zu verlassen, beispielsweise nach Singapur oder auf die arabische Halbinsel. Inzwischen gibt es auch in Deutschland Stimmen, US-amerikanische Forscher:innen nach Deutschland zu holen. Es besteht die Gefahr, dass es den USA ergeht wie Deutschland unter den Nazis: Eine führende Forschungsnation demontiert sich selbst.
Die laufende Rückabwicklung der Erfolge der Bürgerrechtsbewegung in den USA beschreibt Frauke Steffens in der FAZ. Im Pentagon werden Bilder abgehängt, in denen möglicherweise Hinweise auf Trans-Menschen oder schwule Soldaten vermutet werden, beispielsweise sogar, wenn die Buchstabenkombination „gay“ im Namen erscheint. Der Damnatio Memoriae verfallen selbst Kriegshelden die „Tuskegee Airmen, die ersten afroamerikanischen Kampfpiloten“ oder „Harold Gonsalves, einen schwarzen Amerikaner portugiesischer Herkunft, der posthum die Medal of Honor erhalten hatte. In der Schlacht von Okinawa im Zweiten Weltkrieg hatte er sein Leben geopfert, als er sich auf eine feindliche Granate warf, um einen anderen Soldaten zu retten.“ Es ist derselbe Kampf, der zurzeit gegen die Wissenschaften geführt wird, in denen alles, was irgendwie nach „DEI“ klingen könnte, delegitimiert und verboten wird: „Diskriminierung soll wieder Privatsache werden, der politische Kampf gegen Rassismus, Misogynie oder Behindertenfeindlichkeit wird delegitimiert. Und nur die Leistung weißer Männer, ob im Job, in Kunst und Wissenschaft, im Kampf oder im Kriegstod, wird ohne Hintergedanken gewürdigt.“
Universitäten, Bürgerrechte – das sind zentrale Themen, aber nicht nur diese. Thomas Zimmer verweist auch auf die Studien von Steven Levitsky, zuletzt in deutscher Übersetzung verfügbar über seinen gemeinsam mit Lucan A. Way verfassten Essay „Kompetitiver Autoritarismus“. Dieser Begriff unterscheidet sich – so Levitsky und Way – vom klassischen Begriff einer „Diktatur“. Ob die „Checks and Balances“, insbesondere in der Justiz, die Spielräume Trumps einschränken werden, zumindest in den demokratisch regierten Staaten der USA, ist eine offene Frage. Trump wird allerdings wohl alles tun, um Bundesrichter, die ihn nicht unterstützen, aus ihrem Amt so bald wie möglich zu entfernen. Bereits jetzt werden Gerichtsurteile einfach ignoriert oder zumindest die Richter als „illegal“ beschimpft. Übrigens nicht nur in den USA. Ebenso verfuhren Orbán, die polnische PiS-Regierung, Erdoǧan und verfährt jetzt Benjamin Netanjahu in Israel.
Wie die Trumpisten in der Regierung – wie viele Personen sind es eigentlich wirklich? – vorgehen, beschreibt auch Heather Cox Richardson auf ihrem Blog am Beispiel der Deportation von 200 Venezolanern nach El Salvador auf der Grundlage eines Gesetzes aus dem Jahr 1798, dem „Alien Enemys Act“, dem diese Verfügung aufhebenden Urteil des Bundesrichters James Boasberg und der prompten Reaktion Trumps, der das Urteil ignorierte: „The Trump White House and its MAGA supporters appear to be trying to cement their power to control the government by undermining the rule of law and the judges who are defending it. White House press secretary Karoline Leavitt yesterday called Judge Boasberg a ‚Democrat activist”, although he was originally appointed by President George W. Bush, and badly misrepresented Boasberg’s order. She also attacked Boasberg’s wife for her political donations.“ Pam Bondi, die Justizministerin setzte noch einen drauf, indem sie Boasberg vorwarf, die Sicherheit der USA zu gefährden. Alle, die gegen Trump argumentieren, protestieren oder als Richter:innen gegen seine Executive Orders entscheiden, werden schlichtweg delegitimiert, eine Strategie, die schon im Wahlkampf funktionierte. Der nächste Schritt wäre die Kriminalisierung, in etwa nach dem Vorbild Putins und Erdoǧans. Vielleicht braucht es dazu gar nicht so viele Mitstreiter:innen. Es reicht, wenn Kritik verstummt beziehungsweise zum Verstummen gebracht wird. Mitunter reicht es, Gegner:innen in kostenträchtige Proteste zu verwickeln, die sie in den Ruin treiben können.
In der normalerweise mehr als USA-freundlichen FAZ nennt Majid Sattar am 24. März 2025 die Bedrohung beim Namen: „Trumps postdemokratischer Umsturz von oben“. Er bezweifelt, dass die Mahnung des konservativen Vorsitzenden des Supreme Court John Roberts dessen fünf konservativen Kollegen überzeugen wird. Wenn es Roberts nicht gelingt, hätte Trump freie Hand, Immunität hat ihm der Supreme Court bereits zugesichert: „Der Umbau des Staates ist im vollen Gange. Gewiss, es gab in der Geschichte der Vereinigten Staaten immer mal wieder populistische Wellen, die vorübergingen. Und Phasen, in denen Präsidenten versuchten, ihre Kompetenzen gegenüber anderen Staatsgewalten auszuweiten. Auch diese wurden abgewehrt. Es folgten Zeiten, in denen der Kongress sich behauptete und seiner Kontrollfunktion nachkam. 1974 führte dies zum Rücktritt von Richard Nixon, der einer Amtsenthebung zuvorkam.“ Aber auch ohne ein Trump stützendes Votum ist die Gefahr noch lange nicht gebannt. Sabine Achour brachte es in einem Essay mit dem Titel „Die ‚gespaltene Gesellschaft‘“ (in: Aus Politik und Zeitgeschichte 26. März 2018) auf den Punkt: „So kann sich ein menschenfeindliches Vorurteil von der Ideologie zur sozialen Norm verschieben und zur geteilten Realität einer Gruppe werden.“
Sozialliberale Hoffnungen?
Ob das Tempo der Trump- und Musk-Administration nachhaltig wirken wird, lässt sich noch nicht abschließend beurteilen. Nur wie könnte man ihre Agenda bekämpfen? Identitätspolitische Themen dürften nicht helfen, was nicht bedeutet, dass man auf sie verzichten sollte. Könnten soziale Themen eine entscheidende Rolle spielen? Als auf soziale Gerechtigkeit zielende Ausformung des von Bill Clinton geprägten Diktums: „It’s the economy, stupid“? Immerhin war die Inflation einer der die Wahl 2024 entscheidenden Faktoren.
Zurzeit reisen Bernie Sanders, Alexandria Ocasio Cortez und Greg Casar in ihrer „Fighting Oligarchy Tour“ durch die USA, gerade auch durch Staaten, in denen die Republikaner ihre Mehrheiten in der Regel mit großer Sicherheit gewannen. Sie organisieren Townhall-Meetings und fanden zuletzt in Denver (Colorado) 35.000 Zuhörer:innen. Johanna Roth berichtete in der ZEIT. Sie berichtete allerdings auch über den Teil der Demokraten, der sich noch zu orientieren versucht, manche, indem sie sich – wie der Minderheitenführer im Senat Chuck Schumer – kompromissbereit geben oder sich – wie zum Beispiel John Fetterman gleich selbst nach rechts wenden. Die Einschüchterungsstrategie Trumps zeigt durchaus Wirkung. Andererseits: Die Republikaner meiden zurzeit Townhall-Meetings, lehnen Einladungen sogar ab. Sie befürchten Unmut, nicht zu Unrecht. Wirtschaftliche Probleme zeichnen sich bereits ab. Beispielsweise verursachen die Streichungen von USAID einen erheblichen Kollateralschaden, sodass Farmer ihre Produkte nicht mehr an USAID verkaufen können, die diese dann in Ländern der sogenannten Dritten Welt zur Verfügung stellt. Und wie Wirtschaftsunternehmen so sind: Sie warten nicht auf Zölle, sondern erhöhen schon einmal prophylaktisch die Preise und die bei der letzten Wahl durchaus wahlentscheidende Inflation steigt.
Die von Gerhard Schröder, Tony Blair und Bill Clinton gepflegte Wirtschafts- und Sozialpolitik unterschied sich von dem von Ronald Reagan und Margaret Thatcher propagierten Neoliberalismus nur in Nuancen. Sie klang nur einfach netter. Alle glaubten gleichermaßen, dass es den ärmeren Schichten einer Gesellschaft mit der Zeit gut gehen würde, wenn es nur den reicheren Schichten besser ginge, da diese mit ihren Ersparnissen bei den Steuern doch sicherlich zahlreiche neue Arbeitsplätze schaffen würden („Trickle-Down-Effekt“). Rechtsextremistische und rechtspopulistische Parteien gab es damals allerdings um die Jahrtausendwende kaum, libertäre Extremisten wie Elon Musk, Peter Thiel und Javier Milei waren kaum vorstellbar. Eine Machtoption rechtspopulistischer und rechtsextremistischer Parteien war die Ausnahme. Als sich im Spätherbst 1999 in Österreich ÖVP und FPÖ auf eine Koalition verständigten, wurde diese in der Europäischen Union noch geächtet. Es war auch nicht absehbar, dass in Deutschland (und in manch anderen europäischen Staaten) eine in Teilen rechtsextremistische Partei unter den Arbeiter:innen die meisten Stimmen erhalten sollte und in den USA die eigentlich dem Großkapital verpflichteten Republikaner immer mehr Wähler:innen unter den Arbeiter:innen, nicht nur im sogenannten Rust Belt, gewinnen sollten.
Ralph Nader, der 2000 zum Präsidentschaftsamt in den USA kandidierte und – so sagen manche – mit seinen Stimmen verhindert habe, dass Al Gore die Wahlen gewann, wurde in seinem Blog am 21. März 2025 sehr deutlich: „Sporting its lowest-ever favorability ratings, the Party of the Donkey (die Demokraten haben einen Esel, die Republikaner einen Elefanten als Wappentier, NR) neither listens to seasoned civic group leaders, who know how to talk to all Americans (…), nor to progressive labor unions like the American Postal Workers Union and the Association of Flight Attendants. The dominant corporate Democrats (just look at their big campaign donors) don’t even listen to Illinois Governor JB Pritzker who for many months has been aggressively taking the Grand Old Plutocrats, led by their dangerous Madman, Trumpty Dumpty, to the woodshed.” Welche Botschaft haben die Demokraten, fragt Ralph Nader fast schon verzweifelnd.
Doch es gibt so manche, die nicht erst aufzuwachen brauchten, weil sie im Grunde schon immer deutlich vertreten hatten, dass die Demokraten ihre sozialpolitischen Botschaften in den Vordergrund stellen sollten. Auch in Deutschland zeichnet sich offenbar mit dem Wahlerfolg der Linken seit der Bundestagswahl 2025 eine solche Bewegung ab. Die Strategie von Bernie Sanders und Alexandria Ocasio Cortez entspricht durchaus der Strategie, mit der in Deutschland die „Silberlocken“ der Linken bei der Bundestagswahl 2025 erfolgreich waren. Ob die Fighting Oligarchy Tour mit einer Stärkung der örtlichen Demokraten verbunden ist, ist zurzeit nicht absehbar. Eine Voraussetzung wäre, es wie die deutsche Linke zu machen, die damit begonnen hat, gezielt in Bereiche zu gehen, in denen die AfD stark abschnitt. Nur am Rande: Eine Spaltung an den inneren Linien der Woke-Bewegung sollte allerdings grundsätzlich vermieden werden. Die Re-Stabilisierung der liberalen Demokratie geht vor Identitätspolitik, zumal die Rechte in Sachen Identitätspolitik zurzeit ohnehin erfolgreicher ist, wie nicht zuletzt die Popularität einer Art Starke-Männer-Kult gegen den angeblich so gefährlichen Feminismus, vulgo „Genderwahn“, belegt. Aber auf dem sozialen Feld sind die Rechten besiegbar.
Larissa Deppisch hat in einem Beitrag zum Thema „Infrastruktur“ in der Zeitschrift „Aus Politik und Zeitgeschichte“ vom 1. März 2025 die Korrelationen zwischen dem Abbau von Daseinsvorsorge und dem Aufstieg von Rechtspopulismus untersucht. Dies ist nicht so eindeutig wie es scheint, aber das Verschwinden von Infrastruktur spielt eine Rolle. In Gruppendiskussionen erfuhr die Autorin: „Auch in kleinen Orten habe es früher einen Bäcker, einen Metzger, einen Dorfladen, eine Kneipe gegeben. Heute fehlen selbst erreichbare Arztpraxen und Schulen. Dies wird als großer persönlicher Verlust empfunden – mit den Schließungen gingen auch Teilhabemöglichkeiten verloren: ‚Jetzt nehmen die mir ja alles‘.“ Durchweg, auch in Regionen mit eher geringem Zuspruch für die AfD, wird „Unverständnis darüber geäußert, dass der Staat keine finanziellen Mittel für Infrastrukturinvestitionen in ländlichen Räumen bereitstelle, wohl aber Geflüchtete unterstütze.“ Diese Unzufriedenheit ist ein für Populisten abschöpfbares Potenzial.
Joe Biden hatte bereits umfangreiche Infrastrukturprogramme beschlossen, die sich jedoch nicht in Stimmen für Kamala Harris und die Demokraten auszahlten, weil offenbar die örtlichen Kümmererstrukturen fehlten. Insofern ist es auch jetzt eine vorrangige Aufgabe der nächsten Bundesregierung und der Landesregierungen, das von ihnen beschlossene Infrastrukturprogramm möglichst gepaart mit hoher Präsenz von Mandatsträger:innen vor Ort umzusetzen. Wer es schafft, eine solche sozialliberale Politik – die man gar nicht unbedingt so nennen muss – zügig umzusetzen, die Bürger:innen bei der Planung zu beteiligen, Entscheidungen vor Ort zu begründen und die Erfolge für alle vor Ort spürbar zu machen, dürfte bei den nächsten Wahlen gute Chancen haben, Rechtspopulist:innen und ihre illiberale und antidemokratische, den Rechtsstaat zerstörende Agenda zurückzudrängen. Denn diese profitieren nur von einem einzigen Gefühl, dem Ressentiment gegen alles, was ihnen einfach nicht passt.
Ein Fazit? Warum sollte Europa nicht Vorbild werden (können)? In einem Gastbeitrag für CORRECTIV forderte Can Dündar schon vor zwei Jahren „ein internationales Netzwerk der Solidarität (…). Es braucht enge Verbindungen zu den Parteien, den Handelsorganisationen, den Kommunalverwaltungen und der Zivilgesellschaft in diesen Ländern, auch mit Frauenrechts- und Jugendorganisationen.“ Vielleicht sind die großen Demonstrationen in der Türkei, in Georgien, in der Slowakei, in Argentinien und inzwischen auch in den USA ein Hoffnungszeichen? Solidarität, nicht Appeasement, ist die Aufgabe unserer Zeit. Jürgen Trittin schrieb in der Märzausgabe 2025 der Blätter für deutsche und internationale Politik: „Die Antwort auf das oligarchische ‚America First‘ muss ‚Europe United‘ sein.“
Norbert Reichel, Bonn
(Anmerkungen: Erstveröffentlichung im März 2025, Internetzugriffe zuletzt am 25. März 2025. Für den Hinweis auf die Blogs von Ralph Nader und Heather Cox Richardson sowie einige weitere Hinweise auf Debatten und Entwicklungen in den USA danke ich Michael Kleff. Titelbild: Hans Peter Schaefer.)