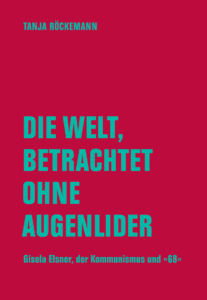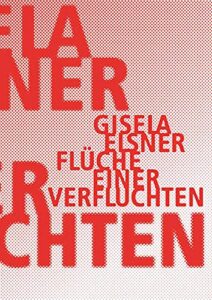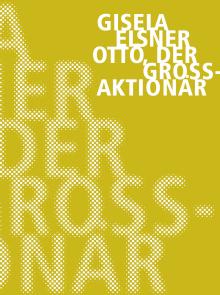Die Realistin
Tanja Röckemann über Literatur und Politik im Werk von Gisela Elsner
„Sie darf die Wirklichkeit bedienen, aber sie darf sie nicht beschreiben, wie sie ist. Dem, was schon da ist, dienen, nur das ist erlaubt. Und darf sie einmal zu etwas dienen, dann nicht, um Kunstwerke herzustellen, für man ‚mit einer verletzenden Generosität‘ von manchen Kritikern bedacht wird, wie Gisela Elsner, schon ziemlich verzweifelt, über diese Herablassung spricht, mit der dem weiblichen Werk etwas wie eine Sonderstellung, mit irgendwie geschrumpften, puppenmöbelartigen Kriterien, ‚eingeräumt‘ wird (schon wieder dieses Einräumen! Diesmal aber im Sinne einer Beschränkung), obwohl doch schließlich sie, die Frau, dazu da ist, Fächer und Regale immer wieder zu säubern und aufs neue eben: einzuräumen, und unter all diesem Einräumen bleibt ihr kein Raum mehr, wo sie sich selber hintun könnte und wo ihre Aussagen auch noch mit hineingingen. Die Wände würden ja platzen.“ (Elfriede Jelinek, Ist die Schwarze Köchin da? Ja, ja, ja! in: Christine Künzel, Hg., Die letzte Kommunistin, Hamburg, KVV konkret, 2009)
Elfriede Jelinek spielt in der zitierten Textpassage mit dem doppelten Wortsinn des „Einräumens“, einerseits das Schaffen von Ordnung (welcher und wessen Ordnung?), andererseits das vorsichtige sich von sich selbst Distanzieren, weil das, was man gesagt oder geschrieben hat, doch nicht so richtig in das passt, was in der Gesellschaft (welcher Gesellschaft eigentlich?) so im Allgemeinen erwartet oder aus dem, was man sagt oder schreibt, herausgelesen wird. Dieses Wortspiel beschreibt das Verhältnis Gisela Elsners zu dem Umfeld, in dem sie schrieb, schreiben musste, recht präzise. Es zeigt auch, dass mit pauschalen Zuschreibungen keine Erkenntnisse gewonnen werden können. Elfriede Jelinek konstatiert: „Für die Frau, die in ihrer Überschreitung als Dichterin zur Distanz als solche wird, nein, zum Fremden, zur Differenz, gibt es keine Distanz mehr, oder alles wird zur Distanz, zum ‚Berührungsverbot‘, das gar nicht ausgesprochen zu werden braucht (…) sie schreibt das Normale, allerdings in seiner Monstrosität.“ Was bleibt da „einzuräumen“?
Eine kurze Hinführung in das Werk von Gisela Elsner

Tanja Röckemann, Foto: privat.
Gisela Elsner wurde am 2. Mai 1937 in Nürnberg geboren, am 13. Mai 1992 tötete sie sich in München selbst. Tanja Röckemann hat in ihrer Dissertation „Die Welt, betrachtet ohne Augenlider – Gisela Elsner, der Kommunismus und 1968“ (Berlin, Verbrecher Verlag, 2024) die Klarheit beschrieben, mit der Gisela Elsner ihren eigenen Standpunkt beschrieb, der sich nicht zuletzt dadurch auszeichnete, dass er festgefügte Überzeugungen und Annahmen ihres Umfelds in Frage stellte: „Gisela Elsner betont, dass sie selbst etwa aus der Erfahrung ihrer Klassenherkunft heraus schreibt, lehnt jedoch Rollenerfahrung und Identität, wie sie am deutlichsten bezüglich des Genres Frauenliteratur formuliert, als geeignetes Kriterium für die Erfassung literarischer Formen ab. Mit diesem Festhalten an Literaturproduktion als spezialisierter Tätigkeit vertritt sie letztlich dieselbe Kritik, die DDR-Autor:innen wie Christa Wolf seit den späten fünfziger Jahren am Bitterfelder Weg äußern.“ Gisela Elsner vertritt eben keine der gängigen literarischen „Strömungen“, sie lässt sich in keine literarische Schule oder keinen literarischen Club einordnen, weder in West- noch in Ostdeutschland, und dennoch erschließt sich ihre Bedeutung in der deutschen Literatur gerade aus ihrem kritischen Verhältnis zu „Strömungen“ und Erwartungshaltungen, vor denen es kaum ein Entrinnen zu geben scheint.
Es ist nicht so einfach, Bücher von Gisela Elsner in Buchläden zu entdecken. Es gab zwar vor einiger Zeit elf Bücher im Berliner Verbrecher Verlag, auch einzelne Bücher in anderen Verlagen, sie sind zurzeit jedoch leider nicht im Handel erhältlich. Herausgeberin der Buchreihe im Verbrecher Verlag war die Hamburger Germanistin Christine Künzel, Erste Vorsitzende der 2012 gegründeten Internationalen Gisela-Elsner-Gesellschaft und Autorin der Monographie „‚Ich bin eine schmutzige Satirikerin‘ – Zum Werk Gisela Elsners (1937-1992)“ (Sulzbach / Taunus, Ulrike Helmer Verlag, 2012). Das Literaturhaus Nürnberg e.V. vergibt den Gisela Elsner Literaturpreis, den am 3. Juni 2025 Ulrike Draesner erhielt. Wer Gisela Elsner kennenlernen möchte, besuche daher die Internetseite der Gesellschaft, gehe in die Antiquariate oder lese vielleicht zur Einstimmung das Buch von Tanja Röckemann, die seit 2020 als Wissenschaftsredakteurin bei nd / Die Woche arbeitet.
Zur aktuellen Rezeptionsgeschichte Gisela Elsners gehört die Theater-Inszenierung von „Heilig Blut“ im Sommer 2025 in Nürnberg. Es war die letzte Inszenierung des Schauspieldirektors Jan Philipp Gloger vor dessen Wechsel ans Volkstheater in Wien. Florian Welle rezensierte die Aufführung in der Süddeutschen Zeitung: „Wirklich komisch ist hier gar nichts, dafür alles heiter brutal. Gisela Elsner führt in den drei alten Männern die bundesrepublikanische Nachkriegsgesellschaft vor. In ihnen lebt die faschistische Ideologie ungebrochen fort. Sie sind emotional vereist, hart gegen sich selbst, vor allem aber hart gegen andere. Der ihnen anvertraute Gösch ist für sie als Wehrdienstverweigerer, Weichei und Vegetarier ein gefundenes Fressen.“
Die Qualität der Romane von Gisela Elsner lässt sich in ihrer schonungslosen Intensität und Ästhetik mit der Qualität der Erzählungen und Romane von Ingeborg Bachmann, Elfriede Jelinek oder auch Herta Müller vergleichen (meine subjektive Auswahl). Allerdings leidet Gisela Elsner in der Rezeptionsgeschichte wie schon zu ihren Lebezeiten darunter, dass sie von Verlagen, Kollegen und Kritikern (hier ist die männliche Form angemessen) immer wieder auf ihre politischen Anschauungen reduziert wird. Sie gilt vielen einfach als die Kommunistin, war auch zeitweise Mitglied der DKP und kritisierte den Fall der DDR. Das bedeutet jedoch nicht, dass sie eine fundamentalistische Parteigängerin irgendeiner Richtung gewesen wäre. Aber dies wird gerne übersehen.
Tanja Röckemann geht den politischen Implikationen im Werk Gisela Elsners in drei Kapiteln nach, die sich mit ihrem Verhältnis zur Sozialdemokratie, zur Neuen Linken der 1968er Zeit und zur DKP befassen. Dabei spielt Gisela Elsners Verhältnis oder Unverhältnis zu den Größen und Schein-Größen der deutschsprachigen Literaturszene eine wichtige Rolle. Die Chefideologen der Gruppe 47 hatten schon ihre eigene Vorstellung, wie Frauen schreiben sollten oder eher nicht schreiben sollten. Es ist daher kein Zufall, dass „Heilig Blut“ im Jahr 1987 zunächst nur auf Russisch, etwas später auf Bulgarisch erschien. Ob die russischen beziehungsweise bulgarischen Verleger die Tragweite des Romans verstanden haben, wäre eine andere Frage. Gisela Elsner habe – so Tanja Röckemann – in „Heilig Blut“ eine ähnliche Botschaft vertreten wie Thomas Brasch in „Vor den Vätern sterben die Söhne“ (1977). So ist Gisela Elsner eine Zeugin der Zeitgeschichte, die sich immer ihre eigenen Gedanken machte, gleichermaßen bezogen auf Ost und West.
Tanja Röckemann betont, ihr Buch über Gisela Elsner sei „keine Biographie, sondern eine kritische Betrachtung der Verhältnisse, in denen sie politisch und literarisch gewirkt hat.“ Gattungsbezeichnungen wie „Groteske“ oder „Satire“, Begriffe wie „Realismus“ und „Parteilichkeit“ erhalten in diesem Rahmen eine eigene Bedeutung, auch dann, wenn Gisela Elsner sie zur Selbstbezeichnung ihres literarischen Schaffens verwendete. Tanja Röckemann zitiert aus Gisela Elsners Text „Über Mittel und Bedingungen schriftstellerischer Arbeit“: „Literarische Parteilichkeit besteht für Elsner darin, durch die Darstellung im Roman ‚einen natürlichen Widerpart zu jenen Sprachregelungen, Wunschbildern und Schönfärbereinen ab(zugeben), ohne die das Bürgertum, auch wenn es sich mittlerweile die Zweifel an der eigenen Ewigkeit einverleibt hat, offenbar nicht auskommen kann.‘“
Die Schriftstellerin, die sich bewusst in Gefahr begibt
Norbert Reichel: Wie kamen Sie auf die Idee, sich näher mit Gisela Elsner zu befassen?
Tanja Röckemann: In meinem Germanistikstudium in Münster kam Gisela Elsner nicht vor. Ich zog dann nach Berlin und habe die Linken Buchtage mitorganisiert. Beteiligt war auch der Verbrecher Verlag. In dessen Räumen entdeckte ich die Werkausgabe von Gisela Elsner. Ich habe als erstes Buch „Die Zähmung“ gelesen und war sehr beeindruckt. Ich hatte eigentlich nicht vor zu promovieren, aber dann kristallisierte sich heraus, dass es sich lohnen würde, eine Dissertation über Gisela Elsner zu schreiben. Ich bekam eine Förderung über die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Der Verbrecher Verlag hat sie dann veröffentlicht. Das war nicht von Anfang an geplant, hat sich dann aber so ergeben. Der Verbrecher Verlag ist kein herkömmlicher Wissenschaftsverlag. Mir war es wichtig, dass das Buch nicht nur einfach erscheint, sondern auch zu einem vernünftigen Preis verlegt werden konnte.
Norbert Reichel: Zurzeit ist Ihre Dissertation das Einzige, was im Verbrecher Verlag zu Gisela Elsner verfügbar ist, ihre Romane sind zurzeit leider nicht im Handel verfügbar.
Tanja Röckemann: Ein großes Ärgernis.

Gisela Elsner im Jahr 1973, Foto: Kai Greiser (mit freundlicher Genehmigung der Internationalen Gisela Elsner Gesellschaft e.V.).
Norbert Reichel: Ein unsägliches Kapitel der deutschsprachigen Literaturgeschichte. Gisela Elsner ist für mich so bedeutend für die Literatur wie für die gesellschaftlichen Entwicklungen wie beispielsweise Ingeborg Bachmann oder auch Inge Müller. Ich sprach einmal mit Ines Geipel über Gemeinsamkeiten bei Ingeborg Bachmann und Inge Müller. Ines Geipel sprach von der „Versehrtheit“; die beide verbinde. Dieser Begriff lässt sich meines Erachtens auch auf Gisela Elsner beziehen. Er passt auch zu dem Titel Ihrer Arbeit: „Die Welt, betrachtet ohne Augenlider“.
Tanja Röckemann: Die Formulierung habe ich in einem Brief von Hermann Henselmann, einem Architekten in der DDR, mit dem Gisela Elsner befreundet war, an sie gefunden. Im Nachhinein wies mich jemand darauf hin, dass dieser Begriff auf Heinrich von Kleist zurückgeht, der in Bezug auf Bilder von Caspar David Friedrich geschrieben hat, diese hätten auf ihn so gewirkt, „als ob Einem die Augenlieder [sic] weggeschnitten wären“. Ich sehe dies als eine treffende Beschreibung, wie sich Gisela Elsner in der Welt sah und auch ein wenig, wie ich auf die Welt schaue. Der Begriff der „Versehrtheit“ passt dazu. Es ist eine gewisse Schutzlosigkeit, zugleich ein klarer Blick, der gar nicht immer so einfach zu ertragen ist. Viele ihrer Texte sind Frontalangriffe, gehen in die Offensive. Zum Beispiel „Das Berührungsverbot“: Es war zum Erscheinungsdatum ein Angriff auf die Auswüchse der sexuellen Revolution. Das kam auch auf der linken Seite nicht sonderlich gut an. Dabei ist das Buch eigentlich ein Anti-Porno. Gisela Elsner war in vielerlei Hinsicht immer in der Schusslinie. Sie hat sich stark behauptet, aber auch Schaden genommen.
Norbert Reichel: Sie hat sich auch immer wieder mit Situationen konfrontiert, in denen sie Schaden nehmen konnte.
Tanja Röckemann: Das sah sie als ihre Aufgabe als Schriftstellerin. Eben dies schätze ich so sehr an ihr. Sie verstand ihre schriftstellerische Tätigkeit als politischen Akt oder vielleicht besser als politische Aktivität. Literatur habe sich kritisch zu den Verhältnissen zu stellen. Ich weiß nicht, ob sie das Schreiben an sich als politischen Akt verstand, aber die Produktionsverhältnisse des Schreibens sicherlich. Ich zitiere in meinem Buch eine exemplarische Äußerung von Gisela Elsner zu der Reaktion von Verlagen auf ihre Manuskripte, konkret zu „Gefahrensphären“, dem einzigen zu ihren Lebezeiten erschienenen Band ihrer kulturkritischen Schriften (Zsolnay Verlag), „dass man auf politisch unliebsame Argumente nicht mit politischen Gegenargumenten reagiert, sondern mit ästhetischen Argumenten.“ Ich sehe hier einen Bezug zur Brecht’schen Kritik an „kulinarischer Kritik“. Inhalte werden einfach ignoriert, wenn sie nicht gefallen.
Keine Feministin
Norbert Reichel: Intention und Wirkung sind zwei Paar Schuh.
Tanja Röckemann: Das stimmt. Selbst Literatur, die explizit als nicht politisch gekennzeichnet ist, hat implizit in sich eine politische Haltung. Gisela Elsners Werke beziehen sich sogar sehr explizit auf die gesellschaftlichen Verhältnisse, sodass es eigentlich nicht möglich sein sollte, den politischen Bezug zu ignorieren. Natürlich hängt das auch immer davon ab, wie das Publikum, die Öffentlichkeit verfasst sind.
Gisela Elsner hat viel recherchiert. Sie wollte nicht ihr eigenes Innenleben in den Mittelpunkt stellen, wie das aus meiner Sicht bei sogenannter „Frauenliteratur“ erwartet wird. Hier sehe ich auch einen Unterschied zu Ingeborg Bachmann, die auf eine andere Art und Weise als Gisela Elsner seelische Zustände verarbeitet. Bei Ingeborg Bachmann werden auch Individuen dargestellt, während Gisela Elsner eher Typen beschreibt. In ihrer Kritik an dem Genre „Frauenliteratur“ sehe ich sie beispielsweise in der Nähe von Irmtraud Morgner oder auch Christa Wolf und Maxie Wander. Ich habe zu diesem Thema geschrieben, dass Irmtraud Morgner „ebenso wie Gisela Elsner die Unbrauchbarkeit der Kategorie Geschlecht für die Konstituierung eines literarischen Genres“ konstatierte.
Norbert Reichel: Ich sehe einige Parallelen im Hinblick darauf, wie Gisela Elsner als Frau und wie sie über Frauen schreibt und möchte Marlen Haushofer nennen, deren Romane – wenn wir mal von „Die Wand“ absehen – von den Kritikern als „Hausfrauenliteratur“ abgetan wurde, obwohl sie sehr präzise Status und Rolle von Frauen in ihren Romanen beschreibt und das patriarchalische Verhalten der Ehemänner geradezu chirurgisch seziert, zum Beispiel in „Die Mansarde“ oder „Die Tapetentür“. In „Die Mansarde“ ignoriert der Ehemann die künstlerischen Arbeiten seiner Frau völlig und schleppt die Familie jeden Sonntag in das Militärhistorische Museum. Sie haben in Ihrem Buch das Thema „Patriarchat“ ausführlich angesprochen. Die Frauen bei Marlen Haushofer sind sehr einsam. Die Idee zu „Die Wand“ kam nicht aus dem Nichts.
Tanja Röckemann: Dieses nimmt einen großen Teil meines Buches ein und war für mich als Feministin auch eine wichtige Motivation, mich mit dem Werk Gisela Elsners zu befassen. Aber diese Thematik ist sehr komplex, denn Gisela Elsner verstand sich nicht als Feministin. Sie steht damit in der Tradition der sozialistischen Bewegungen, in denen der Begriff des Feminismus zugunsten eines universalen Befreiungsgedankens zurückgewiesen wurde. Hier teilt sich ihr Werk in zwei Teile, das literarische Werk auf der einen Seite und ihre politischen Aktivitäten und Schriften auf der anderen Seite. Rowohlt wollte sie in die Kategorie „Frauenliteratur“ einordnen. Das hat sie abgelehnt und so auch Karriereeinbußen hingenommen.
Gisela Elsner wollte nicht unter dem Label „Frau“ eingeordnet werden. Sie hat in ihrem Aufsatz „Autorinnen im literarischen Ghetto“ den Begriff der „Frauenliteratur“ auseinandergenommen, aber durchaus auch mit einer Schlagseite, das Weibliche abzuwerten, etwa zu sagen, dass – wie es in der DDR auch hieß – „Frauen ihren Mann zu stehen hatten“. Sie wollte auch in der DKP nicht frauenpolitisch tätig werden. Sie hat ausdrücklich zurückgewiesen, dass sich ihre eigene Sozialisation als Frau maßgeblich auf ihre Literatur auswirke. Sie gestaltet jedoch in ihrer Literatur die patriarchalischen Zwangsverhältnisse, in denen Frauen sich befinden. Hier gestaltet sie auch privaten Raum, während sie sich in ihren politischen Aktivitäten auf den öffentlichen Raum konzentriert.
Ein Beispiel wäre „Das Berührungsverbot“: Es ist in dem Roman völlig klar, dass die Männer das Projekt des Partnertauschs durchziehen, ungeachtet dessen, was ihre Frauen davon halten. Es kommt auch zu einer Vergewaltigung. „Abseits“ war einerseits sehr erfolgreich, wurde aber auch als trivial behandelt. Es ist die Biographie einer Hausfrau und Mutter, die an dieser Existenz zugrunde geht und sich suizidiert. Dieses Buch ist am wenigstens satirisch gehalten. In „Die Zähmung“ wiederum gestaltet sie die Tatsache, dass die Geschlechterrollen nicht an den Körperlichkeiten, sondern an den sozialen Rollen festzumachen sind: Ein Schriftsteller arbeitet zu Hause, nicht allzu viel, während seine Frau außerhalb Karriere macht, er kümmert sich um das Kind und wird zu einer Art Hausmann. Gisela Elsner nimmt die obsessive Besetzung dieser Arbeit minutiös auseinander. Das Motiv des Geschlechtertauschs verweist in diesem Kontext darauf, dass es sich um soziale und nicht um erbbiologisch angeborene Funktionen handelt.
Im Übrigen schrieb sie auch keine Arbeiterliteratur. In meinem Buch habe ich darauf hingewiesen: „Elsner entwirft in ihrer Literatur nahezu ausschließlich bürgerliche Milieus, ihre Figuren sind eine Arbeiter:innen, sondern Unternehmer, deren Ehefrauen oder Künstlerinnen.“ Ich beziehe mich hier auf die DDR-Germanistin Ursula Reinhold, die in „Antihumanismus in der westdeutschen Literatur“ (Berlin, Dietz, 1971) Gisela Elsners Literatur als „eine Literatur (sieht), die als menschen- und geschichtsbildendes Element ernst genommen sein will (…) die Unmenschlichkeit bewerten (muss) als das, was sie ist: als vergängliches Menschenwerk, hervorgebracht von bestimmten gesellschaftlichen Verhältnissen, an sie gebunden und durch bewußte menschliche Tätigkeit zu verändern.“
Die politische Person Gisela Elsner
Norbert Reichel: Der Buchtitel „Die Riesenzwerge“ mag da geradezu programmatisch wirken. Schon der Romananfang mit einer reichlich unappetitlichen Beschreibung des essenden Vaters der Familie legt dies nahe. Mich erinnerte diese Beschreibung der Bürgerlichkeit an Franz Josef Degenhardts Lied vom deutschen Sonntag. Für manche ist diese Bloßstellung einer spießig-selbstgefälligen Bürgerlichkeit schon nahe an sozialistischen oder gar kommunistischen politischen Einstellungen, auch wenn sich die kommunistische Bürgerlichkeit in der DDR von der kapitalistischen im Westen gar nicht so sehr unterschied. Das sah meines Erachtens Gisela Elsner durchaus. Sie hatte ein ausgesprochenes kritisches Verhältnis zu orthodoxen Vorstellungen von Sozialismus, Kommunismus und den dies vertretenden Parteien.
Tanja Röckemann: Man kann sich nicht mit Gisela Elsner befassen, wenn man sie nicht auch als politische Person wahrnimmt. Ich habe daher meine Arbeit in drei Kapitel gegliedert, die sozusagen ein Panorama der Parteien und Entwicklungen der Linken in der Bundesrepublik bilden: Sozialdemokratie, 1968er, DKP. Gisela Elsner war in unterschiedlicher Weise dort eingebettet, gehörte aber zu keiner wirklich dazu. Gleichzeitig muss man sagen, dass sie 1977 in die DKP eingetreten ist und auch abgesehen von einem kurzen temporären Austritt in den späten 1980er Jahren bis zu ihrem Suizid im Jahr 1992 Mitglied der Partei geblieben ist.
In ihrem Werk findet man nicht so viel Ausbuchstabiertes über eine politische Utopie, die sie vertreten hätte. Aber ich würde schon sagen, dass sie die Vorstellung hatte, dass man einen sozialistischen Staat schaffen müsse.
Ich teile Gisela Elsners Position hier nicht. Ich denke eher, man müsse den Staat als Staat abschaffen, weil sonst immer genau das passiert, was in den sozialistischen Staaten passiert ist. Gisela Elsner vertrat keine Staatskritik. Sie hatte auch kein Problem mit dem Autoritarismus, der in der DKP als „demokratischer Zentralismus“ bezeichnet wurde. Sie gehörte nicht zu denen, die in den späten 1980er Jahren forderten, man müsse die Parteilinie weniger autoritär gestalten. Zum Thema DDR äußert sie sich fast gar nicht. Es gibt natürlich „Die teuflische Komödie“, ihr letztes nicht vollendetes Werk, in dem sie mit dem Zusammenbruch der DDR und der Wiedervereinigung abrechnete. Vorher taucht die DDR in ihren Äußerungen kaum auf, aber sie war eben Mitglied der Partei, die der DDR sehr nahestand.
Norbert Reichel: Und die diejenigen, die heute noch Mitglied der Partei sind, nach wie vor hochleben lassen. Ich denke aber, dass die DDR für Gisela Elsner auch deshalb kein Thema war, weil sie eben in der Bundesrepublik lebte und sich mit den dortigen Verhältnissen auseinandersetzte, ungeachtet von Parallelen in ihrem Werk zu Autorinnen wie Irmtraud Morgner oder Christa Wolf.
Tanja Röckemann: Zu ihrer Motivation, in die DKP einzutreten, schrieb sie einmal, sie wolle „aus dem Sumpf der Verneinung herauskommen“. Sie hat selbst darunter gelitten.
Norbert Reichel: Diesen „Sumpf“ finden wir in „Die Riesenzwerge“, in „Heilig Blut“, in „Das Berührungsverbot“, um nur drei Titel zu nennen.
Tanja Röckemann: Ihre Bücher bieten keinen Ausweg. Es gibt keine irgendwie sympathischen Figuren. Im Verlauf der 1970er Jahre hat sich bei ihr daraus möglicherweise der Wunsch entwickelt, politisch aktiv zu werden. Und da fiel ihre Wahl auf die DKP. Warum es ausgerechnet diese Partei sein musste? Das hing auch damit zusammen, dass Gisela Elsner von Beginn an die neuen sozialen Bewegungen, die sich aus der 68er-Bewegung entwickelten – dazu der zweite Teil meines Buches – sehr stark kritisierte. Sie kritisierte die Fragmentierung der 68er in Umweltbewegung, Frauenbewegung, Schwulenbewegung, die auch eine Abkehr von revolutionären Absichten war. Dies kulminierte in der Gründung der Grünen, die sie von Anfang an zutiefst kritisierte. Die Grünen wären eigentlich das hauptsächliche Angebot gewesen, aber sie war schon davon überzeugt, dass man eine kommunistische Partei bräuchte. Ich habe geschrieben, „dass die Kultur- und Konsumkritik der Neuen Linken von vornherein eine Schlagseite hatte, die das – naturgemäß auch in der Bundesrepublik vorhandene – Armutsproblem negiert.“ Das liegt natürlich auch an der Herkunft der Aktivist:innen der Studentenbewegung aus eher wohlhabenden Elternhäusern. Ich halte ihre Kritik an den Grünen für aktuell: Was geschieht, wenn eine Partei, die aus einer linken Bewegung kommt, versucht, ihre Kritik an der kapitalistischen Gesellschaft und die kapitalistische Gesellschaft selbst in Einklang zu bringen? Das ist aber auch nicht nur ein deutsches Phänomen.
Norbert Reichel: Das ist in der Tat eines der Probleme der Grünen, aber das wäre noch einmal eine andere Geschichte. Mir ist aufgefallen, dass Sie in den beiden ersten Teilen, die sich mit der Sozialdemokratie und der Neuen Linken nach 68 befassten, zwei Mal in einer Zwischenüberschrift das Wort „Dämmermännerung“ verwenden. Es kam dann im dritten Teil nicht mehr vor, obwohl man ihn dort angesichts ihrer Patriarchatskritik durchaus hätte erwarten können.
Tanja Röckemann: Den Begriff „Dämmermännerung“ habe ich im Kontext der Kritik an Enzensberger und Grass erfunden. Es geht um diese beiden spezifischen Personen, die ich damit kritisieren wollte.
Norbert Reichel: Säulenheilige der SPD beziehungsweise der Neuen Linken. In den Beschreibungen der beiden bieten Sie meines Erachtens sehr treffende Einblicke in die Verhaltensweisen der Gruppe 47. Sie schreiben: „Anti-Bürgerlichkeit ist hier reine Lebensweise ohne politische Konsequenzen; ein Phänomen, welches die strukturelle Armutsproduktion der bürgerlichen Klassengesellschaft in privilegiertem Postmaterialismus beschönigt – eine Position, die sich später auch in der Neuen Linken wiederfinden wird.“
Tanja Röckemann: Man muss hier schon einen Unterschied machen. Enzensberger hat einige gute Bücher geschrieben, beispielsweise „Das Verhör von Habana“, sich auch in den neuen sozialen Bewegungen engagiert. Grass trat immer als sehr politischer Mensch auf, behauptete aber gleichzeitig, er sei Nonkonformist. Er steht für mich für die problematischen Linien der Politik in der Bundesrepubik, auch in der Gedenkpolitik, nicht zuletzt durch sein langes Verschweigen der eigenen SS-Mitgliedschaft.
Norbert Reichel: Im Hinblick auf das Verhältnis Gisela Elsners zur Neuen Linken sprechen Sie von „Voluntarismuskritik“ und schlagen einen Bogen von Che Guevara bis zu Petra Kelly.
Tanja Röckemann: Der Begriff der ‚Voluntarismuskritik‘ bezieht sich auf die marxistisch-leninistische Position, dass man historische Gesetzmäßigkeiten nicht durch einen reinen Willensakt durchbrechen kann. Gisela Elsner macht sich über Che Guevara auch ein wenig lustig, in der Kritik einer männlichen Heldenfigur. Sie nannte ihn jemanden, „der auszog, eine Revolution ohne Volk anzuzetteln.“ Gisela Elsner hat Petra Kelly wegen ihres Pazifismus angegriffen, aber auch weil sie als zarte Lichtgestalt dargestellt wurde. Gisela Elsner schrieb in einer Rezension der Biographie von Monika Sperr über Petra Kelly: „Dadurch, daß sie das Übel, statt es beim Namen zu nennen, wie einen Maulesel mit Symbolik befrachtet, sucht Petra Kelly zugleich den symbolischen Charakter vieler ihrer Aktionen zu rechtfertigen. Gleichgültig, ob sie in Bonn eine Papprakete verbrennt, um die Stationierung von ‚Pershing 2‘-Raketen zu verhindern, oder ob sie vor dem Weißen Haus in Washington achtzig Tauben gen Himmel fliegen läßt, stets scheint sie weit davon entfernt zu sein, sich der notorischen Hilflosigkeit solcher Aktionen bewußt zu werden.“ Die Biographie von Monika Sperr erschien 1983 und hatte den Titel „Petra Karin Kelly – Politikerin aus Betroffenheit“, der Titel der Rezension Gisela Elsners lautete „Mit Schöpfkellen gegen Flutkatastrophen“.
Norbert Reichel: Der maskuline Revolutionär und die zarte engelgleiche Pazifistin – so landet man auf Plakaten, die sich junge Leute dann in ihr Jugendzimmer oder in die Studentenbude hängen, letztlich bei einer Art „Revolutionsromantik“.
Tanja Röckemann: Von Pazifismus hielt Gisela Elsner gar nichts. Das kritisierte sie auch an der DKP, die sich an der Friedensbewegung beteiligte.
Norbert Reichel: Obwohl die DKP keine pazifistische Partei war. Militär kritisierte sie nur im Westen.
Tanja Röckemann: Das stimmt, aber in der Friedensbewegung grenzte sich die DKP scharf von militanten Bewegungen ab. Das fand Gisela Elsner falsch. Gisela Elsner war der Meinung, dass gewaltloser Widerstand an der Gewalt der bestehenden Verhältnisse scheitern müsse. Es gibt auch einen Ausspruch von ihr, dass es keinen Sinn mache, ein Peace-Zeichen in einer Menschenkette zu formen, das man nur von oben, von einem Polizei- oder Militärhubschrauber sehen könnte.
Bürgerliche Literaturkritik
Norbert Reichel: Da war sie ganz Satirikerin. Mein Lieblingsbuch von Gisela Elsner ist „Heilig Blut“. Das ist nicht mehr nur Satire, das ist ein realistischer Roman. Meines Erachtens passt hier auch der folgende von Ihnen zitierte Satz Gisela Elsners zu ihrer eigenen literarischen Entwicklung: „Ich konnte mich von Kafka komischerweise dadurch trennen, dass ich Zola las.“ In „Heilig Blut“ beschreibt sie eine Männergesellschaft, alles Honoratioren wie man so sagt. Den Gegenpol bildet der junge Mann, der in der Runde seinen Vater vertreten muss. Beim Jagdausflug töten die Alten den Jungen und die Umstände werden vertuscht.
Tanja Röckemann: „Heilig Blut“ ist auch mein Lieblingsroman. Die alten Herren sind alte Nazis, gehören zu der Generation, die in der Wehrmacht oder in anderen NS-Organisationen tätig war. Ich sehe in dem Roman die realistische Darstellung eines Teils der Tätergeneration. Der sozialdemokratische Sohn, der sich als Pazifist versteht, spiegelt die Haltung der SPD, die aber eigentlich der Tätergeneration nicht viel entgegenzusetzen hat.
Der Roman hat eine interessante Publikationsgeschichte, die ich in meinem Buch ausführlich beschreibe. Er wurde in Deutschland aufs Heftigste abgelehnt, war auch der Beginn eines sehr scharfen Tonfalls gegenüber der Autorin. Er wurde in Gutachten für die Verlage als ästhetisch misslungen dargestellt. Szenen, die aus meiner Sicht realistisch dargestellt wurden, wurden als „an den Haaren herbeigezogen“ bezeichnet. Ich hatte den Eindruck, dass die Lektoren bei Rowohlt etwa eine Klientel waren wie der sozialdemokratische Sohn im Roman, die einfach nicht wahrhaben wollten, was da um sie herum geschah. Rowohlt war ein damals sehr SPD-naher Verlag. Ich kann das nicht im Detail belegen, halte meine These jedoch für plausibel. Das sieht heute anders aus, denn der Roman wird inzwischen anerkannt. Auch die hervorragende Inszenierung als Theaterstück in Nürnberg gehört dazu.
Norbert Reichel: Sie zitieren Gisela Elsner mit dem Hinweis, dass man in den Verlagen auf politisch unliebsame Passagen oder Bücher nicht mit politischen, sondern mit ästhetischen Argumenten reagiere.
Tanja Röckemann: Das kennzeichnet aus meiner Sicht die bürgerliche Literaturkritik. Wenn die politische Aussage nicht gefällt oder wenn man diese nicht verstehen will, flüchtet man in ästhetische Argumente. Oder ein anderes Beispiel: Bei ihren Satiren wurde Gisela Elsner vorgeworfen, sie gestalte keine psychologisch plausiblen Innenleben. Aber wie ich schon sagte, sie beschrieb Typen, keine Individuen. Oder es war die Rede von Banalitäten. Ich sehe dies als Verweigerung, sich inhaltlich mit den Romanen Gisela Elsners auseinanderzusetzen. Aber Satiren haben historisch ohnehin einen schweren Stand. Dazu kann Christine Künzel mehr sagen, die in ihrer Habilschrift über Gisela Elsner als Satirikerin geschrieben hat.
Norbert Reichel: Mit Christine Künzel habe ich schon gesprochen und wir haben verabredet, dass ich nach unserem Interview auch ein Interview mit ihr mache.
Tanja Röckemann: Es gab in den 1970er Jahren angesichts des Aufstiegs der Neuen Linken durchaus Akzeptanz für entsprechende Literatur. Es gab auch eine Phase, wo linke Positionen in der Literatur stärker vertreten waren. Davon hatte Gisela Elsner damals profitiert. In den 1980er Jahren verschwand dies wieder in einer Tendenz zur Innerlichkeit. Gisela Elsner sagte 1979 in einem Interview mit den roten blättern, der Zeitschrift des MSB Spartakus: „Da ist ein Mensch, der die Welt nicht versteht und selbst nichts ins Reine kommt und eigentlich nur noch Ich-Forschung betreibt“.
Von der Groteske über die Satire zum realistischen Roman
Norbert Reichel. Heute erleben wir das nach wie vor bei schlecht gemachter Auto-Fiction und leider auch immer wieder bei der Verleihung von Buchpreisen in Frankfurt und Leipzig in der Sparte Belletristik. Immer wieder Menschen, gerne Frauen mit ihren Töchtern, die sich irgendwie selbst finden wollen. Sie zitieren „Jost Hermand, der ebenso wie Elsner die sogenannte Neue Innerlichkeit nicht als genuin neues Phänomen begreift, sondern als konsequente Fortführung eines ‚ungehemmten Subjektivismus‘ in der Literatur der antiautoritären Neuen Linken.“
Tanja Röckemann: Hier passt auch wieder Gisela Elsners Satz zu ihrer Entwicklung von Kafka zu Zola. Zu Kafka gibt es immer wieder in der Forschung die These, dass die Dinge letztlich nicht erklärbar wären. Gisela Elsner sieht bei Kafka das Problem, dass er mit seiner Tätigkeit bei der Arbeiter-Unfall-Versicherungs-Anstalt (AUVA) für das Königreich Böhmen nicht den letzten Schritt gegangen ist, seine eigene Situation zu klären, obwohl so die Dinge letztlich doch erklärbar gewesen wären. In „Die Riesenzwerge“ steht noch das Absurde im Vordergrund. Von dieser Form der Groteske hat sie sich verabschiedet und zur Satire hinbewegt. Es könne nicht dabei bleiben, das Groteske darzustellen, denn letztlich sei das, was geschieht, erklärbar. Insofern passt es auch, dass Gisela Elsner mit der Zeit Zola vorzog. Viele Gemeinsamkeiten zu Gisela Elsner gibt es in dieser Hinsicht meines Erachtens bei Peter Weiss. Kritik an der bürgerlichen Gesellschaft kann sich nicht in Bürokratiekritik erschöpfen.
Zu ihren literarischen Vorbildern zählt Gisela Elsner – so habe ich es geschrieben – „bürgerliche Realisten des 19. Jahrhunderts, namentlich Gustave Flaubert, Lew Tolstoi und Émile Zola (…) Sie hält es für richtiger, literarische Strömungen nicht unter dem Vorwurf der Antibürgerlichkeit abzulehnen, sondern konkrete Werke anhand der Kategorien Wirklichkeit, Wahrscheinlichkeit und Wahrheit auf ihren realistischen Gehalt hin zu untersuchen.“
Gisela Elsner ist – so ließe sich ergänzen – eine realistische Autorin, ungeachtet der jeweiligen literarischen Form. Sie hat reale Themen gestaltet, die manche nicht so gerne sahen.
Norbert Reichel: Und manche wollten nicht so dargestellt werden wie Gisela Elsner das tat. Vor allem wollten sie sich in diesen Personen nicht wiedererkennen müssen. Da geht man dann lieber in die Offensive und findet alle möglichen Argumente, die einen solchen Roman in Grund und Boden kritisieren oder rezensieren.
Zum Abschluss die Frage: Warum sollten wir heute Gisela Elsner lesen? Und eine zweite Frage dazu: Warum ist es dringend angezeigt, alle ihre Werke wieder zu veröffentlichen? Am besten gleich in einer Gesamtausgabe.
Tanja Röckemann: Diese Frage wurde mir bei Veranstaltungen, zum Beispiel zu meinem Buch, bisher nicht gestellt. Wir sollten Gisela Elsner lesen, weil ein großer Teil ihres Werks sich mit den Leiden befasst, die die kapitalistischen Produktionsprozesse bewirken. „Otto der Großaktionär“ wäre hier ein passender Lesetipp. Der Roman erschien erst posthum. Er ist nicht nur eine Satire, sondern gestaltet auf eine empathische Weise die Beschädigungen, die die kapitalistische Gesellschaft den Arbeitern zumutet. Er hat insofern auch eine Sonderstellung in ihrem Werk, denn sie hat sich in vielen Werken auf Unternehmerfiguren konzentriert. Sie hat „Otto der Großaktionär“ nicht so schreiben wollen wie vorhergehende Romane, weil sie Otto nicht mit derselben Häme beschreiben wollte, mit der sie beispielsweise die Unternehmerfiguren in „Heilig Blut“ oder die Bürger in „Das Berührungsverbot“ beschrieben hatte.
So manches, was Gisela Elsner schrieb, ist eine historische Dokumentation der gesellschaftlichen Verhältnisse und Entwicklungen der alten Bundesrepublik. Die Strukturen des Patriarchats, der nun gerade wieder im Aufstieg ist und die damit einhergehende Abwertung von Frauen lassen sich mit Gisela Elsner besser verstehen. Gisela Elsner hält immer daran fest, dass der Kapitalismus abgeschafft werden muss. Ich finde es absolut wichtig, diese Position auch weiterhin sichtbar zu machen.
(Anmerkungen: Erstveröffentlichung im November 2025, Internetzugriffe zuletzt am 22. November 2025, Titelbild: Hans Peter Schaefer.)