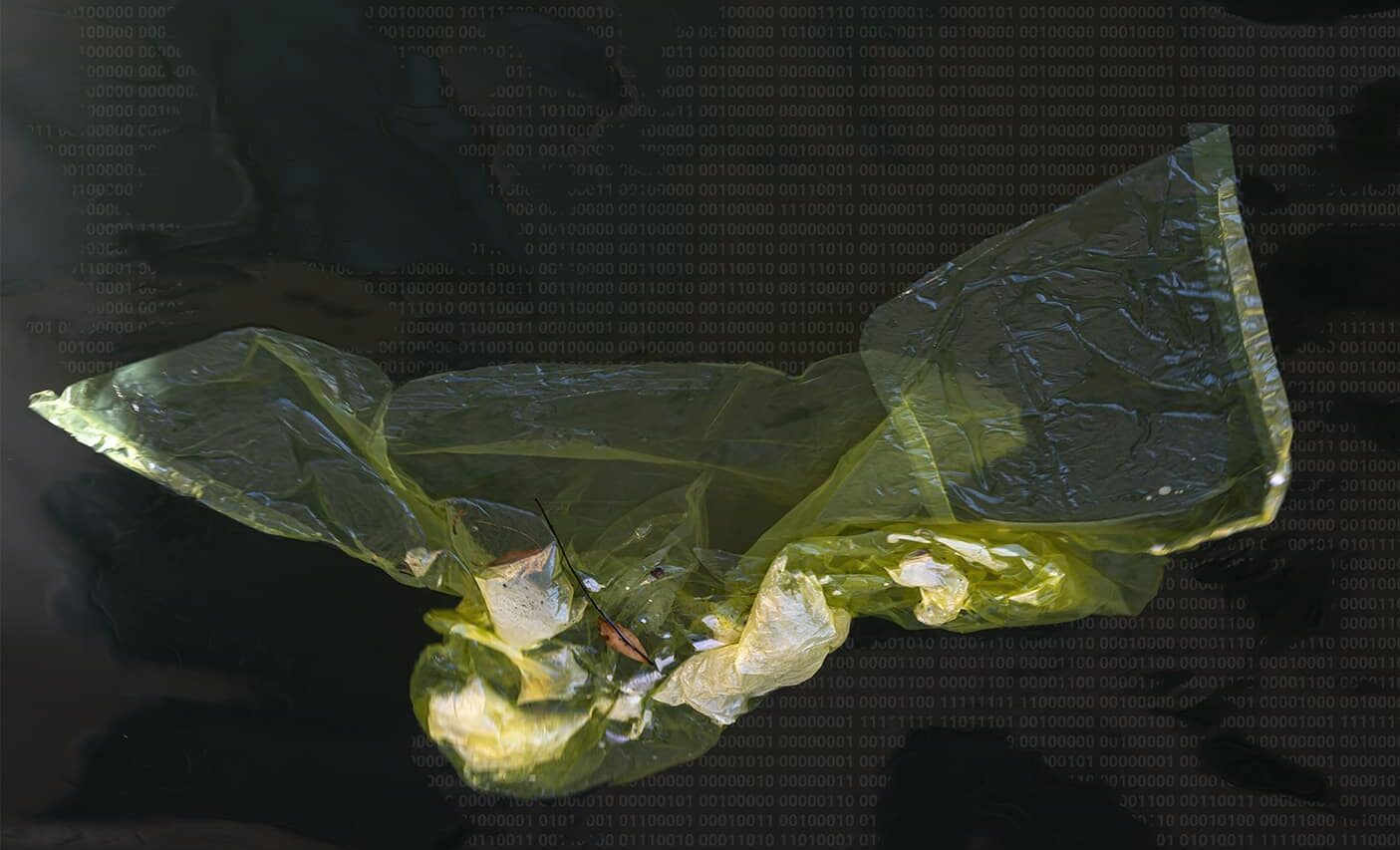Die Träume des Schmetterlings
Sprechen, Schreiben, Schweigen in der Erziehungsdiktatur
„Und wer ist nun Medea, wie kommt man ihr nah, die man nur kennen lernt in den extremsten Situationen, in die sie hineingetrieben wird wie ein Tier, das bis zum Letzten gehetzt ist und nur noch reagiert, genau so reagiert, wie es reagieren soll, um das Spiel weiterzuspielen? Bei Windebbe brauchen die Götter ein Opfer.“ (Gabriele Stötzer, Medea, in: Ich bin die Frau von gestern, erschienen in: Die Verschwiegene Bibliothek, Frankfurt am Main, Wien und Zürich, Büchergilde Gutenberg, 2005)
Menschen, die schreiben, brauchen Menschen, die lesen, was sie schreiben. Aber viel zu oft lesen in Diktaturen Menschen ihre Texte, die sich weniger dafür interessieren, sich mit den Schreibenden über das Geschriebene auszutauschen, als dafür, wie sie verhindern können, dass andere das Geschriebene lesen und wie verhindert werden kann, dass die Schreibenden in der Art und Weise, wie sie schreiben, weiterschreiben. In der DDR gab es viele Autor*innen, die darunter zu leiden hatten, dass vom Staat bestellte Leser*innen eine Veröffentlichung ihrer Texte verhinderten, sie schikanierten, vor Gericht stellen und verurteilen ließen. Herrschte Stillstand und Not in der wirtschaftlichen, drohte Unmut in der gesellschaftlichen Entwicklung, brauchen die Götter herrschender Parteien Opfer.
Manche hatten Glück und wurden in den „Westen“ abgeschoben, manche wurden zu drakonischen Gefängnisstrafen verurteilt, manche töteten sich selbst, allen gemeinsam war, dass ihre Texte in der DDR nicht veröffentlicht oder falls schon veröffentlicht unzugänglich gemacht wurden. Aber nicht nur die Schreibenden begaben sich in Gefahr, auch ihre Leser*innen. Manchmal reichte der Besitz eines Briefes oder eines Gedichtes einer*eines verfemten Autorin*Autors, um von der Stasi beobachtet und schikaniert zu werden. Erst nach dem 9. November 1989 kamen manche Autor*innen zu ihrem Recht. Dank der Förderung durch die Bundesstiftung Aufarbeitung wurden einige dieser Autor*innen in der Reihe „Die verschwiegene Bibliothek“ veröffentlicht, einige erlebten diese Veröffentlichung nicht mehr.
Von der Staatszensur zur Selbstzensur
Es ist das Verdienst von Ines Geipel (*1960) und Joachim Walther (1943-2020), in der DDR verfemten Autor*innen den ihnen gebührenden Platz in der deutschen Literaturgeschichte zu sichern. In ihrem Buch „Gesperrte Ablage – Unterdrückte Literaturgeschichte in Ostdeutschland 1945 – 1989“ (Düsseldorf, Lilienfeld, 2015) beschreiben sie die Szene dieser dritten Literatur – der Begriff wurde von F.J. Raddatz in die Debatte eingeführt – in Deutschland, Ines Geipel widmet sich den Jahren 1945-1968, Joachim Walther den Jahren 1969-1989. Das Achsenjahr 1968, das den ersten Teil beendet, hat in der DDR allerdings eine andere Bedeutung als im „Westen“: es ist das Prager 1968, nicht das 1968 der Studentenrevolten in West-Berlin und in anderen Städten des „Westens“, es ist das Ende der Hoffnungen auf eine humane Zukunft des Sozialismus.
Programmatisch sind die Titel der Vorworte zu „Gesperrte Ablage“: Ines Geipel wählte den Titel: „Gedächtnissiegel Buchenwald“, Joachim Walther den Titel „Angstträume und literarische Gegenwelten“. Darüber hinaus hat Ines Geipel in ihrem Buch „Zensiert, verschwiegen, vergessen – Autorinnen in Ostdeutschland 1945-1989“ (Düsseldorf, Artemis & Winkler, 2009) mehrere dieser verfemten Autorinnen portraitiert, nicht mehr lieferbar ist leider ihr Portraitband „Die Welt ist eine Schachtel – Vier Autorinnen in der frühen DDR: Susanne Kerckhoff, Eveline Kuffel, Jutta Petzold, Hannelore Becker“ (Berlin, Transit, 1999).
Ines Geipel beschreibt die Zerrissenheit, in der diese Autorinnen versuchten, sich in der DDR zu behaupten: „Die Notwendigkeit, sich von der Diktatur des Textrealismus zu befreien, gegen die in der offiziellen Sprache eingeschlossene DDR-Wirklichkeit anzuschreiben, inhaltlich aus den Ankünften, aus der Mainstream-Figur des sozialistischen Aufbauhelden auszubrechen. Aber durch welche Stoffe, mit welcher Ästhetik! Wohin entweichen! Und wo dann sein! Die Texte der Unveröffentlichten geben Auskunft über den schmalen Grat zwischen Existenz und Schreibexistenz unter der Diktatur, die Sprache generell extrem behandelt. Die unter Verschluss stehenden Textfiguren stoßen in jeder Richtung an Grenzen, werden attackiert, müssen ihre Gedanken und Gefühle verstecken, sind ummauert, stehen unter Druck, bewegen sich im Kreis, kommen nicht vorwärts, leben unter verschobenen Raum- und Zeitkoordinaten, fangen an zu stottern, zu lallen.“ Und wenige Zeilen danach: „Ostberlin als eine Landschaft des Surrealen. Die Bilder kippen.“
Oder in den Worten von Heidemarie Härtl (1943-1993) in dem 2006 in der Reihe „Die Verschwiegene Bibliothek“ veröffentlichten Roman „Puppe im Sommer“: „Die Zahl der Wörter ist knapp bemessen: negative Variante, positive Variante. Beide sind leer. Letzten Endes braucht gar nicht gesprochen zu werden. Tod, keine Berührung. Also doch sprechen, irgendwas, singen, lächeln. Der Himmel ist blau. Ich gehe zum Fenster. Jetzt ist Frühling. Dort ist ein Hund, einige Kiefern.“ Dieser Text ist Teil des inneren Monologs einer der beiden Hauptpersonen des Romans, Christian Gerber, der in der Zeit dieser Gedanken „eine Stelle in einem Kaufhausrestaurant angenommen“ hat und darüber nachdenkt, ob er überhaupt sprechen soll: „Einen Tag lang überlegte er, ob er lieber reden oder stumm bleiben sollte.“ Ein Kollege reißt ihn mit dem lapidaren Satz „Der Mond nimmt ab“ aus diesen Gedanken. Wenn es schon so schwer ist, sich im Alltag zu äußern, wie schwer ist es dann, diese Gedanken aufzuschreiben, in eine literarische Form zu bringen? Der Satz von Brecht, dass ein Gespräch über Bäume ein Verbrechen wäre, wenn es das Schweigen über so viel Unheil verdecke, bekommt eine ganz andere Bedeutung, vielleicht als Tarnung, als Variante des Schweigens?
Joachim Walther schreibt in seinem Vorwort über Zensur und Selbstzensur. Er bezeichnet die offiziellen Zensor*innen als „Dialektikjongleure mit ihrer komplementär gewendeten marxistischen Semantik“. Möglicherweise hätte sich Karl Marx schon längst im Grabe umgedreht, wenn er die in der DDR und in anderen sich sozialistisch nennenden Staaten ins Werk gesetzte „Deklaration des Zwanges als Freiheit, des Diktatorischen als demokratisch, des Verschlossenen als offen, des Innen und Außen als verbunden, des hartleibigen Provinzialismus als propagierte Weite und Vielfalt“ hätte verfolgen können. Verbunden mit dieser Orwell’schen Umdeutung der Begriffe ging es in der DDR darum, die Autor*innen zu bewegen, sich möglichst schon beim Aufschreiben ihrer Texte selbst zu zensieren: „Jeder sein eigener Zensor, die Schere im Kopf, davon träumten die Retuscheure der Diktatur. Allein die individuell verinnerlichte Zensur ist die perfekte Zensur.“
Zwischen den Zeiten
Die Jahre rund um die Gründung der DDR waren die Jahre, in denen der damalige Parteichef Walter Ulbricht alles in der Hand haben, es aber demokratisch aussehen lassen wollte. Den zweiten Halbsatz verewigten er und seine Genoss*innen im Staatsnamen. SPD und KPD wurden im Osten Berlins, dem sowjetischen Sektor Berlins, der nach der Staatsgründung zur Hauptstadt der DDR aufstieg, zu einer Partei vereinigt, der SED. SPD und SED waren auch die Parteien, denen Susanne Kerckhoff (1918-1950) angehörte. Susanne Kerckhoff war Mitglied der SPD, trat aus und 1948 in die SED ein. Sie lebte und schrieb zwischen den Welten, im Osten wie im Westen.
Wolfgang Harich (1923-1995) war ihr Halbbruder. Ines Geipel zitiert einen Text von Susanne Kerckhoff aus dem Jahr 1947: „Mein Bruder hat sich mit dem bürgerlichen Lager völlig überworfen. Ich dagegen pendele. Nicht aus Charakterlosigkeit, sondern weil die Welt so rund ist und die Ideologien so eckig. Und das hatten wir ja auch schon mal alles. Aus der SPD bin ich nach wackerer Tätigkeit wieder ausgetreten. Sie beschneiden mir die Flügel. Wenn ich mal von Christus dichte, ist das CDU-Propaganda. Aber das ist nicht der Grund. Der Grund ist die Blockbildung. Ich bin nicht für Blocks.“ Wenige Zeit nachdem sie diesen Text geschrieben hatte, wurde Susanne Kerckhoff die Chefin des Feuilletons der „Berliner Zeitung“.
Die Texte, die wahrscheinlich die Spannung und die Widersprüche, in denen in der damaligen Zeit des Umbruchs nicht nur Susanne Kerckhoff lebte, am deutlichsten belegen, sind die „Berliner Briefe“. Die „Berliner Briefe“ sind ein Briefroman – so auch der Untertitel der 1948 im Berliner Wedding-Verlag veröffentlichten Texte, die 2020 im Verlag „Das Kulturelle Gedächtnis“ wiederaufgelegt wurden. In 13 fiktiven Briefen an einen jüdischen Freund in Paris beschreibt die Autorin die Unsicherheiten ihrer Zeitgenoss*innen im Umgang mit der Vergangenheit der nationalsozialistischen Herrschaft. Obwohl die offizielle Linie der KPD beziehungsweise der SED sowie der DDR-Führung den Nationalsozialismus für erledigt erklärte, weil die veränderten Verhältnisse als Sein das Bewusstsein, vulgär-marxistisch gesprochen die Basis den Überbau bestimmen musste, wirkten Unrecht und Verbrechen der Vergangenheit nach wie vor nach. Im Dreizehnten Brief schreibt Susanne Kerckhoff: „Ja – Hans – das ist der Nachkrieg! Das ist unser Nachkrieg! (…) / Es gibt jetzt keinen Krieg, der Probleme löst und Fragen klärt! Ein Sieg bringt keine Reformation, sondern eine Deformation! / Sind die Menschen denn noch immer nicht so weit, zu schreien: Nie wieder!“
Nachdenkliche Menschen sind Zerrissene. Im Elften Brief: „Wenn es heute heißt: hie Kapitalismus – hie Sozialismus – und im Hintergrunde stehen Kirchen und Sekten, stehen darüber und predigen Gutes, das kaum einer zu leisten auch nur willens ist; untergründig kichern die Dämonen über unseren losgelassenen Freiheitsdurst, der mit so wilder Unschuld in neue Sklaverei läuft – / – dann kann sich der Mensch, er mag übersehen, was immer er übersehen kann, vor dem Ziehen an einem Tau nicht vorbeidrücken. Drückt er sich vorbei, hat er schon mitgezogen und wird die Konsequenzen in Schuld und Gnade zu tragen haben.“ Die Chance, sich einer Auseinandersetzung mit der Vergangenheit zu entziehen, gibt es ebenso wenig wie die Chance, sich nicht oder zumindest noch nicht zu einer bestimmten Zukunft zu bekennen. Jedes Wort wird geradezu zu einem quasi-religiösen Bekenntnis.
Sarkastisch resignierend formuliert Susanne Kerckhoff im Ersten Brief: „In ein bestimmtes Lager gehöre ich – in das Lager derjenigen, die sich noch in gar keiner Weise beruhigt haben – über Nationalsozialismus und Krieg, über Sozialismus und Kapitalismus, über Schuld und Sühne über eigene Schuld und eigene Sühne, kann ich mich nicht beruhigen.“ Und im Dritten Brief beklagt sie: „Eines ist von Anfang des Endes an schlecht gelungen: der deutschen Allgemeinheit Schuldgefühl und Sühnebereitschaft aufzunötigen. Die Erfolglosigkeit aller Erziehung zur Einsicht war von vornherein zu befürchten. Ein besiegtes Volk läßt sich von den Siegern höchst widerwillig belehren.“
Alle – auch die Autorin der Briefe – zählen „in die Verteidigung gedrängt, wie eine Krämerseele“ auf, was sie in der Vergangenheit doch Gutes getan hätten und stilisieren sich zu Opfern: „‚Wir sind alle Opfer des Faschismus!‘ schreit der kleine Mann, der einmal sagte: ‚Der Führer wird schon wissen!‘“ Es kann eigentlich nur ein Bekenntnis geben: „Die Gräber der in Auschwitz vergasten Freunde sind in mir. Die Gräber der Soldaten aller Länder. Die heimatlosen zwangsverschleppten singen ihr monotones Lied vom Heimweg, das mich nicht losläßt – die verwahrlosten und hungernden Kinder – die Verhungerten in Griechenland – die Skelette, die aus den Moorlagern in unser Mil-Gov-Büro schwankten – die Krüppel aus den Lazaretten – alle kommen sie zu mir – und ihr Schweigen schreit: Aber D u konntest nicht sterben!“
Wie zerrissen Susanne Kerckhoff war, die von sich sagte, dass das Politische und das Private nicht voneinander zu trennen seien, belegt ihre Sprache. Wer die „Berliner Briefe“ liest, spürt ihre Wut, ihren Sarkasmus, ihr Gefühl der Ohnmacht gegenüber der Ignoranz und Beharrlichkeit der deutschen Nachkriegsgesellschaft, in Ost und West. Ihre Hoffnung, das System durch den Eintritt in die SED von innen zu beeinflussen, trog. Wenige Monate nach ihrem Eintritt „verordnete man ihr ein Schreibverbot für die Tagespolitik. Das Prinzip Unruhe, das sie so schwungvoll in den politischen Raum ausgelagert hatte, kam zu ihr zurück und nahm sie erneut völlig in Besitz“ (Ines Geipel in: Gesperrte Ablage). Sie verliert das Sorgerecht für ihre drei Kinder, sie erlebt, wie ihre Arbeit in Frage gestellt und torpediert wird, sie tötet sich am 15. März 1950.
Erziehung durch Buchenwald
Texte wie die von Susanne Kerckhoff treffen jede Erziehungsdiktatur – und eine solche war die SED-Diktatur – ins Mark. Während im Westen die sogenannte „Re-Education“ schon in den ersten Jahren der neu gegründeten Bundesrepublik Deutschland (BRD) von Jahr zu Jahr versandete und Aufarbeitung und Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit zunächst einigen wenigen besonders sensiblen Autor*innen wie Wolfgang Koeppen oder Ingeborg Bachmann vorbehalten blieben, bestand die DDR-Führung darauf, dass der kommunistische Widerstand der eigentliche und einzige Widerstand gewesen war und dass mit der Staatsgründung der Deutschen Demokratischen Republik auch die Vergangenheit abgeschlossen sein musste. Zweifel daran waren staatsfeindliche Akte. Aber auch dies ist eine Form, sich „von jeder Verantwortlichkeit zu drücken und die Schuldenlast von sich abzuwälzen!“ Diese Formulierung wählt Susanne Kerckhoff im Zehnten Brief. Sie bezieht sie nicht ausdrücklich auf die Positionierung der DDR-Führung, doch liegt ein solches Verständnis nahe, der Erledigungsvermerk als Leugnung.
Eine Erziehungsdiktatur bemächtigt sich der Erinnerungen an die Vergangenheit, sie verordnet Opferhierarchien. Mit der Zeit verschwinden die auf die unteren Stufen dieser Hierarchie verwiesenen Menschen aus dem kollektiven Gedächtnis. Buchenwald wurde in der DDR zum Symbol des kommunistischen Widerstandes, der unbeschadet gelegentlicher Kollaboration mit der SS immer im Recht war. In ihrem Vorwort zu „Gesperrte Ablage“ referiert Ines Geipel die Einlassungen von Helmut Thielmann, „in der SBZ als Rolf Markert zum Schutz vor den US-amerikanischen Ermittlungen maskiert“, 1954 bis 1981 „Geheimdienstchef von Sachsen“. Thielmann-Markert war deutlich, es interessierten nur die kommunistischen Häftlinge: „Da unsere Genossen mehr wert waren als alle anderen, mussten wir also einen Schritt gemeinsam mit der SS gehen, und zwar in der Vernichtung von aussichtslos kranken und kollabierenden Menschen … Dass ich die Liquidierung nicht alleine durchführen konnte, versteht sich von selbst. Dazu gehörte ein ganzer Apparat. Derselbe bestand fast nur aus Genossen, mit denen ich nur als Exekutive arbeitete. Die Anweisungen bekam ich ja nur durch die Partei.“ Dieses Wissen war schon 1945 kein Geheimwissen mehr, umso wichtiger war es für die SED- und DDR-Führung, jeden Zweifel an der moralischen Integrität der kommunistischen Buchenwald-Kapos zu unterbinden.
Ines Geipel: „Denn die einsickernde Milch der Geschichte musste um jeden Preis gestoppt werden, mit einem ehernen Gegengedächtnis in Schwarz-Weiß.“ Es darf offenbleiben, ob die Metapher der „Milch der Geschichte“ an die „schwarze Milch der Frühe“ aus der „Todesfuge“ von Paul Celan oder an die „Milch der frommen Denkungsart“ von Schillers Wilhelm Tell erinnern mag. Wenn die Partei sagt, die „schwarze Milch“ wäre weiß, dann ist sie weiß.
Der Roman, der diese Sicht der Vergangenheit im kollektiven Gedächtnis der Leser*innen in der DDR hätte aufbrechen können, war „Nackt unter Wölfen“ von Bruno Apitz. Der Roman erschien 1958. Ines Geipel fasst die Widersprüchlichkeiten des Textes und der Geschichte der Edition dieses Romans einschließlich der damit verbundenen internen Debatten zusammen: „Die Großbotschaft lautete: Das kommunistische Netzwerk versuchte, in einem Kosmos aus Terror und Gewalt zu überleben, und diese Not rechtfertigte alle Mittel.“ Und damit sind wir bei der Philosophie – wenn man*frau es so nennen möchte – des 1930 uraufgeführten sogenannten „Lehrstücks“ „Die Maßnahme“ von Bert Brecht.
Der Faschismus war besiegt und so gab es ihn nicht mehr. Die Schulkinder beteiligten sich an den verordneten Klassenfahrten nach Buchenwald, manche trugen zum Auf- und Ausbau der Gedenkstätte bei. „Familiengedächtnis“ und „Staatsgedächtnis“ sollten identisch werden. Das, was nicht sein durfte, wurde einfach „auf die jeweils andere Seite ausgelagert“, konstatiert Ines Geipel in „Umkämpfte Zone – Mein Bruder, der Osten und der Hass, Stuttgart, Klett-Cotta, 2019).
Ines Geipel zitiert Gerd Koenen, der die „Spaltung des Landes“ als „Hauptmodus der Vergangenheitsbewältigung“ bezeichnet, in West und Ost. Faschismus gibt es für die DDR nur noch im Westen. Niemand muss mehr darüber nachdenken, was Großväter und Großmütter vor 1945 in Riga, in Auschwitz, in Buchenwald und anderswo taten. Vorbei ist vorbei. Und so wurden die kommunistischen Buchenwalder Kapos mit ihren Intrigen Vorbilder des heldenhaften antifaschistischen Kampfes und zu Helden der in Bildung und Erziehung der DDR vermittelten Werte. Sie wurden im offiziellen Gedächtnis der DDR die „eiserne Kampfelite“ (Ines Geipel), als die sie sich selbst immer verstanden.
Doch dieses offizielle Bild des heldenhaften kommunistischen Widerstandes war brüchig. Silvia Kabus (*1952), die ihren Roman „Weißer als Schnee“ erst nach 1989 in „Die Verschwiegene Bibliothek“ veröffentlichen konnte (Frankfurt am Main 2008), dokumentiert die Zweifel am verordneten Staatsoptimismus. Ein nachhaltiges Bildungserlebnis war die Fahrt nach Buchenwald nicht, Schocktherapie und Parteipropaganda verschreckten. „Elvira reichte die Zeitung über den Tisch, einer ausgestreckten Hand entgegen. Stimmte zu: ‚Höchstens mein Enkel, einmal, in Buchenwald. Er war hinterher verstört, die Tage danach. Die Eltern waren völlig ratlos.‘ / ‚Es ist gut, dass sie dahin fahren. Davon geht keiner kaputt. Das ist das Einzige, damit sie noch ein bisschen spuren. Die Werte ihres Lebens überhaupt verstehen. / Und ich habe mir das alles lange angesehen, und überlegt. Es hilft nur ein tiefer, wirklicher Schock.‘ / ‚Ist das ihr Ernst? Und was heißt spuren?‘, rief Rica. ‚Ich verzeihe nicht, dass ich als Neunjährige dort war. Nur für ein Entsetzen, ohne Verstehen.‘“
Ein richtiges Leben im falschen?
Theodor W. Adorno dekretierte in den „Minima Moralia“, dass es „kein richtiges Leben im falschen“ geben könne. Angela, Bibliothekarin, 21 Jahre alt, fasst in Maxie Wanders (1933-1977) „Guten Morgen du Schöne“ (erstmals 1977 im Buchverlag Der Morgen, Berlin, Hauptstadt der DDR, erschienen, wiederaufgelegt als im Suhrkamp Taschenbuch Verlag 2007 und seit 2019 als suhrkamp pocket verfügbar) diese Annahme in ihren Worten wie folgt: „Man kann doch nicht für sich ein kleines System aufbauen, wo wir alle im großen sitzen. Man muß sich doch erst im großen wohl fühlen.“ Und weil dies nicht möglich zu sein scheint, vermag sie sich auch in ihren Beziehungen nicht wohlzufühlen, nicht in Gruppen, nicht mit einem einzigen mehr oder weniger geliebten Menschen. Angela fährt fort: „Das Gerede von Gleichberechtigung ist blödsinnig. Ernsthaft. Ich glaube nicht, daß sich das verwirklichen läßt. Niemals.“ Das dürfte die Parteiführung anders gesehen haben, aber wie auch immer, der Text konnte veröffentlicht werden, und Christa Wolf steuerte ein Vorwort bei. Sie ordnet die Texte, die Maxie Wander zusammenstellte, im Sinne der DDR-Erziehungsidee ein: „Der Geist, der in diesem Buch herrscht – nein: am Werke ist – ist der Geist der real existierenden Utopie, ohne den jede Wirklichkeit für Menschen unlebbar wird.“
Alles Vorstufen zum großen Ziel? Christa Wolf grenzt die Texte der 19 Frauen, die Maxie Wander interviewte, von feministischen Texten im „Westen“ ab: „Diese Frauen sehen sich nicht als Gegnerinnen der Männer – anders als bestimmte Frauengruppen in kapitalistischen Ländern, denen man ihren oft fanatischen Männerhaß vorwirft. (…) Besonders, wenn eine starke Arbeiterbewegung fehlt, werden Frauen in sektiererische, gegen die Männer gerichtete Zusammenschlüsse getrieben; meinen sie, die Männer mit den gleichen Mitteln bekämpfen zu müssen, mit denen die Männer jahrhundertelang sie bekämpft haben.“ Haupt- und Nebenwiderspruch, es zählt allein der Klassenstandpunkt, alles andere löst sich mit der Zeit von selbst.
Heidemarie Härtl spricht in „Puppe im Sommer“ von „fünf Leben“, die sie als Frau lebe. Ines Geipel zitiert sie im Nachwort des Romans: „Ich habe fünf Leben gelebt. Ich war Schriftstellerin, und ich war die Frau eines Schriftstellers, was ein großer Unterschied ist. Immer hatte ich Angst, dass ich als Künstlerfamilie den Anfeindungen aus dem Umfeld zu sehr ausgesetzt bin, so dass mein Schreiben gestört worden wäre. Gert hatte sehr wenig Verständnis für das, was ich schrieb, obwohl er sehr viel Zuwendung von mir brauchte und auch bekam. Außerdem war ich die Frau eines Arbeiters und musste mir die Anerkennung von außen dafür erst einmal sichern. Dann habe ich auch selbst gearbeitet. Und ich war Mutter.“
Mitte der 1970er Jahre wurde das Ehepaar Härtl von der Stasi massiv unter Druck gesetzt. In dieser Zeit erschien „Ach, ich zog den blauen Anzug an“, eine Prosasammlung, „ihre einzige offizielle Publikation in der DDR“ (Ines Geipel). Über das Leben des Ehepaars im Jahr 1977 schreibt Ines Geipel: „Sie hinterlegten ihre Manuskripte in den Gepäckschließfächern auf dem Leipziger Hauptbahnhof, kryptisierten ihre Post, stellten dem Geheimdienst in ihrer Wohnung diese und jene Falle, klärten vorausschauend unbekannte Räume ab, lebten zusammen mit den Freunden in permanenter Habachtstellung. Je mehr die Härtls dabei einsetzten, umso gefährdeter lebten sie. Obwohl beide um die zunehmende Heimatlosigkeit wussten, in die sie jene Existenz zwischen blanker Gewalt und zwangsbedingter Symbiose führen musste, blieben sie bei diesem Leben. Sie wollten kein anderes.“
„Puppe im Sommer“ dokumentiert dieses Leben am Beispiel der fiktiven Personen des Romans. Diese versuchen sich in der schönen neuen DDR-Welt zurechtzufinden und stellen immer wieder fest, dass sie keinen freien Raum finden: „Das gesamte Material, so scheint es, ist vom Staat besetzt. Es gibt keine Möglichkeit einer freien Handlung, dachte Christian Gerber. Ganz ohne Material zu handeln, wäre sicher das Beste. Dann ist man vom Staat getrennt.“ Das klingt schon ein wenig nach Selbstauflösung, nach einem sich vom Körper lösenden Geistwesen, nach einer unbestimmten Sehnsucht, sich vom fesselnden Körper zu trennen und damit auch von der Gewalt, die die Partei, der Staat, die Welt diesem antun könnte, doch die Materialität des Alltags hält gefangen. Der Schmetterling kann die Puppe nicht verlassen.
Heidemarie Härtl lässt Christian Gerber in ihrem Roman im Jargon der Partei räsonieren und zeigt so, wie selbst oppositionelle Anwandlungen von diesem Jargon aufgesaugt, vereinnahmt, integriert werden. Ist körperloses Schweigen eine Alternative, das Verharren im Kokon, der Verzicht auf die Freiheit des Schmetterlings? Aber auch das ist kein Ausweg, es bleibt das Gefühl absoluter Ohnmacht. Der eigene Alltag wird zum Alltag eines „Strafgefangenen“, es bedarf keiner Gitter in diesem Gefängnis, Freiheit ist Illusion: „Die Unverletzlichkeit des Körpers ist eine neue Dimension im sozialen Kampf (…) Ist es nicht so, dass unsere Gesellschaft nur noch mit Hilfe von Strafgefangenen aufrechterhalten wird? In den chemischen Betrieben, der Braunkohle, den Stahlwerken. – Und kein Streikrecht, unterbrach ihn der Mann.“
Puppe oder Schmetterling?
Christian Gerber denkt darüber nach, wie es, wenn schon der Körper stets ein gefangener Körper bleiben mag, möglich sein könnte, in diesem Körper zu überleben. „Leben habe ich genug, dachte er. Wie war es mir nur gelungen, so verdammt viel Leben zu bekommen? Ich habe keine Meinung gehabt, dachte er.“ Der Körper widersteht der verordneten Gedankenmaterie: „Die Anbeter des Staates wurden nicht fertig mit mir, obwohl sie ein ausgeklügeltes System hatten: saubere Materie und Modesprache. Sie wollten meinem Körper, der im Schweigen lebte, sprachliche Äußerungen abpressen.“ Er verweigert sich, entleert seinen Körper jeder möglichen Äußerung, widersteht dem Diktat, einen Standpunkt zu haben: „Quatschen, quatschen, quatschen: Ausbildung, Kaderleiter, Patienten, Sinn des Gesundheitswesens – Axel Bauer ist Pfleger –, Ärzte, Urlaub in einem Land, in dem man nicht erwünscht ist. Er führt das soziale Gespräch, dachte Christian Gerber, bestenfalls mit der Hoffnung auf eine Uminterpretation. Und es ist eine Gemeinsamkeit, dass er sie von mir verlangt. Die Rettung des Lebens besteht in der Rettung der Würde der Gegenstände – Straßenpflaster, Ziegelsteine, Zimmertüren Plastebetten, Wolldecken. (…) Letztlich muss jeder für seine eigene Würde eintreten, sich gegen Herrschaft wehren.“
Die Dinge sind die Dinge sind die Dinge – so ließe sich mit einem leichten Seitenblick auf die berühmte Rose von Gertrude Stein schließen? Aber die Dinge sind eben nicht die Dinge. Sobald in der Diktatur gesprochen wird, sind sie es nicht mehr: „Und solange jene kleinen Wörter auftauchen, die aus Schwarz Weiß machen, ist an etwas Gemeinsames in der Zukunft nicht zu denken.“ Aber alles könnte etwas anderes bedeuten, alles könnte eine Metapher sein für etwas, das sich nicht mehr beherrschen lässt. „Die Welt ist eine Riesenmetapher, entfuhr es ihm. Sie enthält die Möglichkeit des Ja-Sagens. Und: Ich bin der Patient an sich.“ Patient oder Arzt, Gefährdeter oder Gefährder – für die aufmerksamen Beobachter des Staates mag dies keinen Unterschied machen, denn jedes gesprochene Wort – das gilt eben auch für sie – könnte etwas anderes bedeuten, jede Puppe könnte einen Schmetterling enthalten. Und das gilt es zu verhindern.
Der Staat – wer auch immer das sein mag – weiß, wie er seine Bürger*innen erzieht: „Das Leben selbst ist eine Herrschaftsform: für jeden Angestellten einen Erzieher.“ Dies ist ein Gedanke von Sonja Schumann, eine weitere Hauptperson des Romans. Sie macht sich bei ihren Lehrer*innen unbeliebt: „Im Unterricht hatte sie die so genannte soziale Sicherheit in der DDR als Sicherheit eines Sarges bezeichnet.“ Postwendend erfolgt der Vorwurf, sie habe „mit Westargumenten provoziert“. Ihr wird klar, dass sie immer „nur Kulisse für die Welt der Herrschenden“ ist: „Wie kann ich ausdrücken, dass ich dieses Leben nicht haben will?“ Die Puppe wird kein Schmetterling, aber Puppe bleiben darf sie auch nicht.
Alles, was sie sieht, bleibt fremd. Nichts ist das, als was es erscheint. „An der Haltestelle sah sie Menschen, die sich frei glaubten – frei für das Wochenende, das kam. Es gab Anziehung, sogar Berührung, ja Zusammenstöße, die nicht von Gedränge diktiert waren. Das Ergebnis der kreiselnden Gedanken der Arbeitstage fand Sonja Schumann in bunten Stiefeln, gestrickten Hüten, Taschen mit Bildern.“ Die Welt wird banalisiert, auch dies eine Art und Weise, Körper und Geist so unsichtbar zu machen wie es nur geht, auf dass man*frau keinen Anstoß errege. „Geredet wird ausschließlich über das, worüber auch die Arbeitskolleginnen redeten: Kaufen, Urlaub, die nicht anwesende Familie. Sie tolerierte das gern. Und wäre bei alldem dennoch nie auf den Gedanken gekommen, dass ihr Leben ähnlich dem ihrer Cousins und Cousinen verlaufen könnte.“
Karoline, 47 Jahre alt, Jugendfürsorgerin und Kaderleiterin, verheiratet und fünf Kinder, gesteht in „Guten Morgen, du Schöne“, dass es nicht nur einen Alltag gibt, den Alltag in der Familie, den Alltag im öffentlichen Leben: „Wir besaßen kein Radio, aber unsere Mutter hat uns politisch gebildet, soweit das ging. Da lernte ich trennen: In der Familie wird anders gesprochen und gehandelt da draußen. Niemals hätten wir außerhalb der Familie was erzählt. Im Ort lebten die Fremden, die uns gefährlich werden konnten.“ Diese Sätze bezogen sich nicht auf die DDR, sondern auf die Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft, die zweite Hälfte der 1930er Jahre. Aber vergangen ist diese Zeit nicht. Sie vergeht nie. Karoline fährt fort: „Das ist bei uns Deutschen Schicksal geworden, die Trennung, das hängt uns heute noch an. Je größer ich wurde, um so mehr habe ich das als tragisch empfunden, für das eigene Leben und für das Leben der ganzen Gesellschaft.“ Ein richtiges Leben im falschen? Als Lebensprinzip? Auch noch in den 1970er Jahren? In der DDR? Wovon spricht Karoline? Von der nachhaltigen Wirkung der NS-Ideologie und des NS-Alltags im Heute der DDR, in der es das eigentlich nicht geben dürfte? Oder doch vom Alltag in der DDR? Worte einer Kaderleiterin?
Die Zukunft des Schmetterlings
Edeltraud Eckert (1930-1955) starb in Haft nach einem Arbeitsunfall. Gedichte schrieb sie erst während der Haft und schuf sich eine Gegenwelt. Sie hatte nichts zu verlieren. Vielleicht gelang es ihr deshalb zu sprechen, verpuppte Worte zum Schmetterling werden zu lassen? Ines Geipel in „Gesperrte Ablage“: „Was aber bedeutet das, wenn das Schreiben ein Schreiben hinter Mauern ist? Die eigene Sprache als Existenzbeweis. Der Versuch, die eigene Welt zu halten, zu behalten, zu verteidigen, die Gedanken, Gefühle, Werte in Schutz zu nehmen als das letzte Refugium des Selbst.“
Schreiben ohne Materie, ohne Papier. Ines Geipel dokumentiert die Haftbedingungen. „Üblicherweise erhielten die Häftlinge in den Zuchthäusern der frühen DDR kein einziges Stück Papier. Stattdessen memorierten sie ihre Texte während der Haftzeit im Kopf. Die gefangene Kopfsprache als ortlose Schrift.“ Es entsteht eine dystopisch-reale Szenerie, die an Ray Bradburys von François Truffaut verfilmten Roman „Fahrenheit 451“ erinnert. Der Mensch wird zu seinem eigenen Buch, der Mensch verwandelt sich in die Puppe, aus der vielleicht eines Tages der Schmetterling seiner Texte zu entfliehen vermag. Die Gedichte von Edeltraud Eckert wurden 50 Jahre nach ihrem tragischen Tod unter dem Titel „Jahr ohne Frühling“ in der Verschwiegenen Bibliothek zu Schmetterlingen.
Gabriele Stötzer bilanziert in „Ich bin die Frau von Gestern“ ihre Verhaftung, ihre Haftzeit. Durch die Gefangennahme des Körpers sollen Geist und Seele verschwinden: In ihrem Text „Das andere mir angetan“ lesen wir „Sie nahmen mir meine äußere Existenz. Sie zeigten mir ihre unendliche Macht über mich. Die Vernehmungen gingen dann zügig voran. Der Kampf hatte sich irgendwohin verflüchtigt. Es gab keine Kompromisse mehr. Ich war Unperson geworden und er auch.“ Einen Ausweg bietet in der Zelle das Erlernen der Klopfsprache: „Es war ein Annäherungsversuch an mich, an mein Verhalten und die ständige Ablehnung und Zurückhaltung, die ich erfuhr.“ Es wächst das Bewusstsein dessen, das geschieht, dessen, das durch andere „angetan“ wird: „Ich hatte mich nur immer mit ihnen gestritten, weil ich mich nicht in ihnen finden konnte. Ich hatte ihre Barrieren angenommen, ohne zu berücksichtigen, dass es die ihrigen waren und nicht die meinigen. Ich hatte gegen ihre Ordnung gekämpft, die übermächtig war und die mir überall begegnete, dass ich schon gar nicht mehr an eine andere Ordnung glaubte.“
Das, was wie ein Sündenbekenntnis, eine Beichte klingt, ist das Eingeständnis des Verlorenen. „Die Außenwelt war versunken. (…) Die Menschen wurden Namen, Beziehungen wurden Worte.“ Mit der Zeit verschwindet der Mensch, nicht nur die Gefangene, auch der Vernehmer, beide sind nur noch Rolle, Funktion in einem System, das nur die Worte zulässt, die das System verlangt, verflochten in einer komplexen Variante des Stockholm-Syndroms: „Es gab keine Kompromisse mehr. Ich war Unperson geworden und er auch.“ Ein Jahr Haft – so lautete das Urteil gegen Gabriele Stötzer. So lange dauerte es, dass das System Strafvollzug die Gefangene be- und verarbeitete: „Nach zwölf Monaten Eingeweide fand ich mich wieder in ihrem Abfallhaufen. Die erste freie Luft war scharf und kalt und fast unerträglich einsam.“ Und dann? Das Exil der Iphigenie oder die Wut der Medea?
Edeltraud Eckert wurde zu 25 Jahren Haft verurteilt. Sie war nicht die einzige, die dermaßen drakonisch betraft wurde. Ihre melancholisch hoffenden Verse, die mitunter an Rilke erinnern, aber immer ihren eigenen Ton haben, lassen Zukunft aus dem Eingeständnis entstehen, dass es niemandem hilft zu schweigen. Es gibt eine Welt jenseits des Schweigens, ein richtiges Leben jenseits des falschen, körperlos. Im Dezember 1953 schrieb sie den Text „Du bist nicht ganz verlassen“ (Jahr ohne Frühling, 2005 veröffentlicht in Die Verschwiegene Bibliothek):
„Du bist nicht ganz verlassen.
Wenn du dich selbst nicht fallen lässt.
Selbst von den blassen
Bildern, die du kaum empfunden,
Bleibt deinem Wesen
Immer noch ein Rest,
Der dir in deinen stillsten Stunden
Zurückruft, was du einst gewesen,
Der dich geformt, so wie du bist
Und wie ein Nachklang
Deines Lebens ist.
Der schwerste Gang
Wird leicht für deine Schritte,
Wenn du den Mut gefunden hast,
Dich loszulösen
Aus der fremden Mitte,
Mit denen du –
Als stummer Gast
Und immer suchend nach der Ruh
Und noch entfernt vom Gutsein
Und vom Bösen –
Geschwankt
Und oft gezweifelt hast.
Dein Schweigen ward dir nicht gedankt,
Es war sich selbst und andern
Eine Last.“
Norbert Reichel, Bonn
(Anmerkungen: Erstveröffentlichung im Dezember 2020, Internetlinks wurden am 15. September 2022 auf Richtigkeit überprüft. Titelbild: Hans Peter Schaefer.)