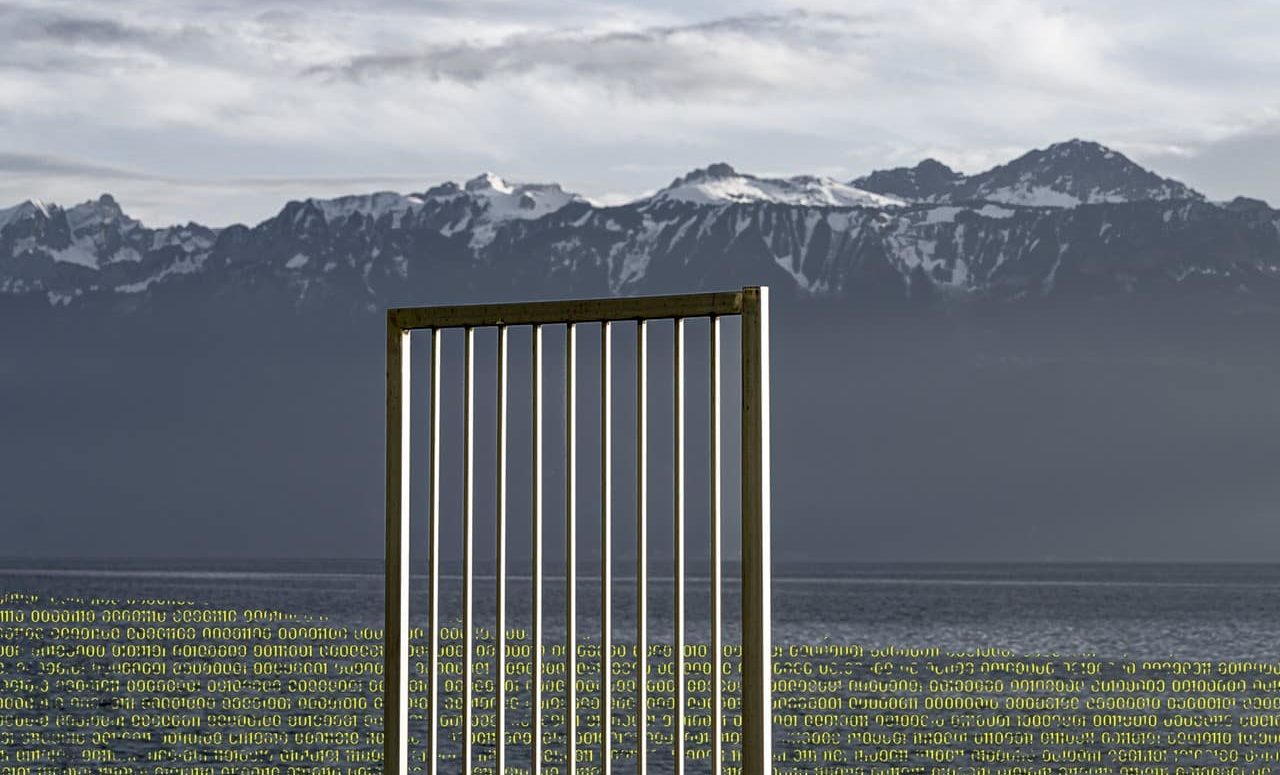Ein Plädoyer für Selbstwirksamkeit
Deutsche Debatten, ein paar Hoffnungsschimmer und ein klarer Auftrag
„Schon vor Jahren habe sie im Kommunalausschuss des Bundestages davor gewarnt, dass einige in ihrer Heimat nicht nur unzufrieden seien, sondern unversöhnlich, sagt Kerstin Kassner. Dass wieder Sündenböcke gesucht werden und es eine Partei gibt, die den Groll abfischt, und zwar mit Schleppnetzen. ‚Die haben das abgetan. Die dachten, ich erzähle Märchen.‘“ (Ulrike Nimz, Die Welle, in: Süddeutsche Zeitung 4. April 2025)
In ihrer Reportage „Die Welle“ zitiert Ulrike Nimz die Binzer Stadträtin Kerstin Kassner, die zehn Jahre lang Landrätin war, bis 2021 für die Linke im Bundestag saß und zurzeit als Fraktionsvorsitzende der Linken im Kreistag Vorpommern-Rügen arbeitet. Kerstin Kassner war eine der Gründerinnen des Bündnisses „Rügen für alle“. Anlass der Reportage war eine Meldung der Ostsee-Zeitung, viele Gäste aus dem Westen hätten angesichts des Wahlergebnisses der Bundestagswahl ihre Urlaubsreise nach Rügen storniert. Rügen war der Wahlkreis, den Angela Merkel acht Mal in Folge gewann. Jetzt gewann ihn ein AfD-Kandidat, der aus den Reihen der Jungen Nationaldemokraten kam. Aber warum Rügen? Rügen sei – so Ulrike Nimz – eine „Seelenlandschaft der Deutschen“, man denke an Caspar David Friedrich.
Bilder der Geschichte
Rügen, konkret Putbus, ist auch der Ort, aus dem der Antisemit und Franzosenhasser Ernst-Moritz Arndt kam, nach dem immer noch viele Gymnasien benannt sind und dessen Wohnhaus in Bonn nach wie vor in Reiseführern als touristisches Ziel genannt wird. Um ihn gab es in Putbus einen kommunalpolitischen Streit, der inzwischen zu seinen Gunsten entschieden sein dürfte. An der Universität Greifswald ging der Streit anders aus, sie trennte sich von dem ursprünglichen Namensgeber. Aber wem gehört die Geschichte? Michael Braun zitiert in seinem gleichnamigen Buch (2. Auflage: Münster, Aschendorff, 2013) eine Äußerung von Julia Franck aus dem Jahr 2009: „Wer kann erzählen, wer will sich erinnern, wer möchte seine Stimme erheben (…), wem gehört eine Geschichte? (Nur die Deutschen über ihre Geschichte, ihre Teilung und ihre Grenze? Nur das Opfer über Opfer? Nur der Zeitzeuge über seine Zeit? Wer kann, wer darf, wer muss – und wer erteilt wem ein Verbot?“ Das Cover des Buches von Michael Braun zeigt eine Screenshot aus dem ikonischen Film „Das Leben der anderen“ mit Ulrich Mühe als Stasi-Agend in Abhörposition, sodass man den Eindruck erhalten könne, die Stasi sei der zentrale Gegenstand der Erinnerung an die DDR. Es gibt viele Organisationen, Initiativen und sogar immer wieder Parteien, die behaupten, dass nur sie die einzig wahre Geschichte erzählten, nur sie die wahren Opfer, die wahren Zeitzeug:innen verträten, oft genug in anmaßender Täter-Opfer-Umkehr. Michael Braun nennt vier Aspekte der Erinnerung, wer sich wann wie und wo erinnere. Und letztlich stellt sich die Frage, wer sich auf welche mehr oder weniger zuverlässigen Quellen und Erzählungen berufen kann.
Autoritäre Regierungen schreiben Geschichtsbücher um und das ist auch die Absicht von Donald Trump. Dabei kann er sich auf manche Vorbilder berufen, nicht nur in der Türkei, in Ungarn, im von der PiS regierten Polen, in Florida, auch im Land des ihm offenbar nicht unsympathischen russländischen Diktators. Wer Schulen und Hochschulen beherrscht, hat gute Chancen, seine eigene Machtposition möglichst lange zu bewahren. Allerdings muss man in Zeiten des Internets und der sozialen Netzwerke – allen Manipulationen der Algorithmen zum Trotz – parallel dazu die Dosis der Gewalt immer weiter erhöhen. Finanzielle Sanktionen reichen irgendwann nicht mehr. Das russländische Beispiel hat Irina Rastorgueva in ihrem in der Leipziger Buchmesse 2025 mit dem Sachbuchpreis ausgezeichneten Buch „Pop-Up-Propaganda“ (Berlin, Matthes & Seitz, 2025) ausführlich dokumentiert. Es ist vielleicht eine Chance der digitalen Netzwerke, dass manch umstrittenes soziales Netzwerk nicht nur von rechten Verschwörungserzählern, sondern auch von demokratisch gesinnten Oppositionellen in Diktaturen genutzt wird. Und dann gibt es ja noch VPN.
Geschichte – das ist auch ein Thema in den ostdeutschen Bundesländern, den Regionen Deutschlands, die der ehemaligen DDR angehörten. Auf die Friedliche Revolution berufen sich alle, aber aus unterschiedlichen Gründen und in unterschiedlichen Kontexten, denn die jeweiligen Bilder der Geschichte beruhen auf mehr oder weniger individuellen und kollektiven Erfahrungen oder besser gesagt der jeweiligen Interpretation von Erfahrungen. Aber was wollten die Bürgerinnen und Bürger der DDR eigentlich (sofern der bestimmte Artikel im Plural überhaupt gerechtfertigt ist)? Was stellten sie sich unter dem „Wirtschaftswunderland“ vor, von dem bei Demonstrationen auf manchen der damaligen Transparente zu lesen war. Solche Transparente und die Drohung, wenn die D-Mark nicht käme, kämen die Demonstrierenden in den Westen, ließen den damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl schon Mitte Dezember 1989 erkennen, dass er nicht die Zeit hatte, „zusammenwachsen zu lassen, was zusammengehört“, wie Willy Brandt es formuliert hatte, sondern die „Deutsche Einheit“ unverzüglich durchziehen musste. Koste es was es wolle. So entstand Kohls Ankündigung der „blühenden Landschaften“.
Heute sehen wir bei Wahlen im Osten Plakate einer in weiten Teilen neo-faschistischen Partei, auf denen gefordert wird: „Vollende die Wende“. Was damit gemeint ist, bleibt mehr oder weniger bewusst unklar, aber eine solche Parole scheint die Gefühle einer großen Zahl von Menschen heute ebenso anzusprechen wie vor 35 Jahren das Versprechen der „blühenden Landschaften“. Die AfD hat ihr eigenes Verständnis der Geschichte. Laut Programm soll beispielsweise das Kaiserreich in den Schulen wieder als etwas Positives gelehrt werden. Die Partei stellt sich damit gegen eine deutsche Erinnerungskultur, die die beiden Diktaturen in den Mittelpunkt stelle. Vor allem die NS-Diktatur ist dieser Partei als Gegenstand deutscher Erinnerungskultur ein Dorn im Auge. Das Verhältnis zur DDR hingegen ist ambivalent. Die Erfolgsgeschichten des freiheitlich-demokratischen Rechtsstaats der Bundesrepublik Deutschland und der Integration Deutschlands in Europa werden im schulischen Geschichtsunterricht jedoch nur beiläufig behandelt. Die aus der DDR-Geschichte erklärbare allgemeine Skepsis gegen die in staatlichen Lehrplänen enthaltenen Bilder von Vergangenheit und Gegenwart tut das Ihre dazu.
Gedächtniskriege
Es ist jedoch ein Problem, eine gefährliche Geschichtspolitik nur im Osten zu verorten. Andreas Kötzing forderte in seinem das Themenheft „Fokus Ostdeutschland“ der Zeitschrift: „Aus Politik und Zeitgeschichte“ vom 10. August 2024 einleitenden Essay „ein Ende pauschaler Ostdeutschland-Debatten“: „Noch mehr Talkshows, warum ‚der Osten anders tickt‘, braucht niemand. Politische Empörung, die die Erfolge der AfD auf ‚den Osten‘ reduziert, ohne Gemeinsamkeiten und Unterschiede mit anderen Regionen im Westen und generell in Europa zu betrachten, macht es sich viel zu leicht. Mit den Nachwirkungen der SED-Diktatur kann man jedenfalls schwerlich den Aufstieg rechtspopulistischer Bewegungen in Italien, Frankreich oder in den Niederlanden erklären.“ Die Bundestagswahl vom 23. Februar 2025 ließ eine solche differenzierte Debatte nicht erkennen. Stattdessen verstärkten sich die Spiralen der Eskalation.
Die DDR verstand sich als „Arbeiter- und Bauernstaat“. Die AfD vertritt jedoch ein wirtschafts- und sozialpolitisches Programm, das mit seiner Steuerpolitik von unten nach oben verteilen, zahlreiche Arbeitskräfte abschrecken beziehungsweise, sofern sie schon da sind, zur Abwanderung zwingen und damit die Gesamtwirtschaft zerstören würde. Klaus Dörre, einer der renommiertesten Arbeiterforscher in Deutschland, analysierte in der Süddeutschen Zeitung die scheinbare Paradoxie der Attraktivität der AfD für die Gruppen der Arbeiterinnen und Arbeiter sowie der Arbeitslosen. „Bei der Wahl zum Europaparlament waren es noch 33 Prozent, jetzt sind es bei der Bundeswahl 38 Prozent. Bei den Arbeitslosen kam die AfD auf 34 Prozent, fast das Dreifache der SPD. Bei den Landtagswahlen in Thüringen haben 49 Prozent der Arbeiter AfD gewählt, in Brandenburg 46 Prozent, in Sachsen 45 Prozent. Nicht nur der Wahlerfolg der AfD in dieser Gruppe ist überdurchschnittlich hoch, sondern auch der Zuwachs seit den letzten Wahlen.“ Vielen Wähler:innen der AfD gehe es auch noch nicht einmal schlecht, aber sie hätten – so das Ergebnis seiner Studien – das Gefühl „nicht angenommen und ernst genommen zu werden“. Sie befürchten schlichtweg Statusverlust beziehungsweise stellen diesen bereits fest, ohne sich auf weitere Fakten und Perspektiven einzulassen. Es gehe – so Klaus Dörre – bei der Wahlentscheidung offenbar weniger um wirtschaftliche Entwicklungen als um „Lebensformen“, denn „man kann sich auch kulturell missachtet fühlen.“ Man fühle sich „bevormundet“. Hinzu komme, dass „Selbstaufwertung“ nur gefühlt werde, wenn andere abgewertet würden, Migranten, queere Menschen, Grüne, wer auch immer eine Lebensform zu vertreten scheint, die man für sich selbst und seine Familie nicht akzeptieren will. So entstehe auch eine „Ethnisierung sozialer Konflikte“.
Gefährlich sei aber – so Klaus Dörre –, dass die demokratischen Parteien seit einiger Zeit Wahlen durchweg als „Defensivwahlen“ inszeniert hätten: Die einen gegen die Rechten, die anderen gegen die angeblichen Eliten, die verordneten, welche Schlüsse man aus der Vergangenheit zu ziehen habe, aber (fast) alle gemeinsam gegen Migranten. Die Migranten – in der allgemeinen Polemik wird nicht gegendert – sind inzwischen in Ost und West zum gängigen Feindbild geworden. Deutsche West und Deutsche Ost neigen gleichermaßen dazu, sich auch nach 35 Jahren Friedliche Revolution wie zwei feindliche Lager zu verstehen und dies – so Tobias Adler-Bartels in seinem Beitrag „Nach der Ko(h)lonisation“ im Merkur vom März 2025 – in „Erlösungsfantasien“ aufzulösen. Die Migranten werden dann so etwas wie der kleinste gemeinsame Nenner der in West und Ost gepflegten Feindbilder. Till Hilmar hat in derselben Ausgabe des Merkur auf den „Doppelaspekt der Opfererzählung“ hingewiesen, „explizit die Ermächtigung und implizit die Kränkung“. Dies lässt sich auch nicht kurzfristig auflösen. Till Hilmar zitiert in derselben Ausgabe des Merkur in seinem Beitrag „Ökonomische Opfer im Osten?“ eine plausible These von Philip Manow (Die Politische Ökonomie des Populismus, Berlin, Suhrkamp, 2018): „Nicht die aktuelle Arbeitslosigkeit, sondern vergangene Erfahrungen von Arbeitslosigkeit erklären laut seiner Studie die Wahlabsicht für die AfD unter Ostdeutschen.“ Erfahrungen von gestern oder gar von vorgestern überlagern die Gegenwart.
Martin Sabrow formulierte in dem von ihm herausgegebenen Band „Erinnerungsorte der DDR“ (München, C.H. Beck, 2009) die Typologie von „Arrangementgedächtnis“, „Diktaturgedächtnis“ und „Fortschrittsgedächtnis“. Schon das Titelbild zeigt die Konflikte zwischen den drei Formen des Gedächtnisses . Eine scheinbar friedliche Straßenszene, dahinter die noch nicht abgerissene Volkskammer an dem Platz, an dem heute der Nachbau des Berliner Stadtschlosses steht, der Fernsehturm vom Alexanderplatz, dem Ort der großen Demonstration vom 4. November 1989, und der Dom, darunter vier Erinnerungszeichen wie Trabi, Sandmännchen, Plattenbau und Parteilogo. Wir erleben zurzeit sozusagen eine Rückkehr ins „Arrangementgedächtnis“, das das „Diktaturgedächtnis“ überlagert und in Umdeutung der Vorzeichen das in der DDR gepflegte „Fortschrittsgedächtnis“ wiederbelebt. Volker Weiß sprach in seinem Essay „Volkes Wille im gelobten Land“ (Aprilausgabe 2025 der Blätter für deutsche und internationale Politik) von dem „Paradox einer anti-kommunistischen DDR-Nostalgie“. Im Untertitel formulierte er mahnend: „Wie die Geschichtspolitik der AfD rechte Regierungen in Ostdeutschland vorbereitet“.
In diesem Kontext wirkt es gar nicht mehr so absurd, wenn Alice Weidel aus Hitler einen Kommunisten macht. Die Popularität Putins in der DDR entsteht sozusagen aus der Ablehnung der als „Kolonialerfahrung“ geframten 35 Jahre im neuen Gesamtdeutschland. Der Rückblick auf die sowjetische Präsenz im Land hat sich unter diesen Bedingungen verändert. Berthold Franke spricht in der Märzausgabe 2025 der Blätter für deutsche und internationale Politik von einer „Dialektik der Unterwerfung“. Er sieht aufgrund „der Erfahrung dauerhaft etablierter, erheblich überlegener (sowjetischer, NR) Fremdherrschaft als spezifische Überlebensstrategie eine Art ‚Stockholm-Syndrom‘“, das sich unter anderem in der Positionierung zur Ukraine fortsetze. Er fährt fort: „Tatsächlich gibt es gute Gründe, die DDR als sowjetische Kolonie zu begreifen (jedenfalls handfestere als Ostdeutschland als westdeutsche Kolonie). Und hinter dem noch frischen Schmerz der zweiten, kulturellen Kolonisierung erscheint im ostalgischen Licht die erste als weniger schlimm.“ Putin wird mitunter sogar zu einer Erlösergestalt stilisiert. Auf Demonstrationen von PEGIDA gab es Plakate, in denen Putin aufgefordert wurde, helfend einzugreifen. Bei den sogenannten „Querdenker“-Demonstrationen während der Pandemie kam Trump als zweite Erlösergestalt hinzu. Trump wurde sogar am Tag des versuchten Sturms auf das Reichstagsgebäude in Berlin vermutet, um die bundesdeutsche Regierung abzusetzen.
Aber vielleicht ist alles viel einfacher: Max Muth konstatierte in einem Gastbeitrag für die Süddeutsche Zeitung: „Deutschland ist süchtig nach vermeintlich einfachen Lösungen“, die das Land in immer neue Abhängigkeiten führten, bis 2022 in der Energieversorgung von Russland, in der Digitalisierung nach wie vor von den USA. Und dann erschrecken manche, wenn sie merken, dass es die Lieferanten gar nicht so gut mit uns meinen: „Deutschlands Geschäftsmodell ist die Abhängigkeit“. Aber wie gesagt, die Abhängigkeit wird von manchen gar nicht mal als unangenehm empfunden.
Fünf Kommunen in Ostdeutschland
Manche sehen die Lösung in einer Art Linksfront, nicht nur gegen die AfD, sondern auch gegen CDU, CSU und FDP, denen von Linken, SPD und Grünen vorgeworfen wird, sie betrieben mit ihrer Politik das Spiel der AfD. Winfried Thaa bezeichnet dies in der Aprilausgabe 2025 der Blätter für deutsche und internationale Politik als „Polarisierungsfalle“. Er bezieht sich auf Chantal Mouffe (unter anderem in: „Für einen linken Populismus“, deutsche Ausgabe: Berlin, edition suhrkamp, 2018), auf Nancy Fraser (in: Hannah Ketterer / Karin Becker, Hg., Was stimmt nicht mit der Demokratie? Berlin, Suhrkamp, 2019) oder kürzlich auf den Beitrag „Das Ende der Mitte – Zur Lage vor der Bundestagswahl“ von Florian Meinel und Maximilian Steinbeis nach dem Desaster der Abstimmung im Deutschen Bundestag vom 29. Januar 2025 im Verfassungsblog. Wer dem rechten Populismus einen linken Populismus entgegensetze, handele getreu „der Freund-Feind-Unterscheidung im Sinne Carl Schmitts.“ Diesen Kampf könne die Linke nicht gewinnen.
Rechter wie linker Populismus ergeben eine höchst gefährliche Mischung. Aber man könnte das Thema auch von einer anderen Seite beleuchten, indem man sich die Praxis in einzelnen Kommunen etwas genauer anschaut. Hier zeigt sich sogar ein merkwürdiger Widerspruch: Die AfD hat es nicht geschafft, ihren Wahlergebnissen entsprechend kommunale Spitzenämter zu besetzen, dies gelang ihr nur in drei Gemeinden, einer größeren Stadt, einer Kleinstadt und einem kleinen Landkreis. Die Ergebnisse bei Europa- und Bundestagswahlen, zum Teil auch bei den Landtagswahlen, sprechen eine andere Sprache. Das aus Sicht der AfD unzureichende Ergebnis in Kommunalwahlen kann nicht nur an der sogenannten „Brandmauer“ liegen, die die Partei gerne nennt, um sich als Opfer der anderen Parteien zu positionieren.
Es lohnt sich daher, die Praxis von Kommunalpolitik in Ostdeutschland einmal näher anzuschauen. Der Berliner Tagesspiegel hat mehrere Reportagen über Kommunen nach und vor der Bundestagswahl veröffentlicht, in denen die örtliche Politik und die Wahlentscheidung bei Europa- und Bundestagswahlen erheblich voneinander abweichen. Er berichtete zum Beispiel über einen Landrat im Landkreis Görlitz, eine Bürgermeisterin in Heringsdorf, einen jungen Bürgermeister in der Uckermark und den Erfolg der SPD in einer sächsischen Gemeinde. Der Rückblick auf eine weitere Reportage im Tagesspiegel aus Hoyerswerda vom Dezember 2023 zeigt jedoch auch, was sich seit dieser Zeit bis zum Februar 2025 verändert hat. Ideologie und Geschichtspolitik verschwinden hinter alltäglichen Problemen.
Stephan Meyer (CDU), Landrat in Görlitz, plädiert für Pragmatismus. Er hält den Begriff der „Brandmauer“ für kontraproduktiv, „weil er nur die Stimmung anheizt und der AfD noch mehr Auftrieb gibt. In der kommunalen Praxis gibt es die Brandmauer nicht, weil gewählte Bürgermeister und Abgeordnete zusammenarbeiten müssen. Das bedeutet aber, dass ich klar eigene Werte vertrete und mich von gewissen Leuten und Ideologien abgrenze. Das gilt besonders für Vertreter der AfD.“ Für das Wahlergebnis der AfD in Görlitz – 49 Prozent bei der Bundestagswahl – gebe es eine einfache Erklärung: „Die Leute haben keine Lösungen gewählt, sondern Protest.“ Er nennt Beispiele für wirksame Lösungen, die sich kommunalpolitisch auszahlten. Dazu gehören die temporären Grenzkontrollen, die es inzwischen gebe. Gleichzeitig brauche man Zuwanderung, da in den Landkreisen Bautzen und Görlitz mit etwa 550.000 Einwohnern bis 2030 etwa 55.000 Menschen in den Ruhestand gingen. Stefan Meyer plädiert für schnellere Verfahren zur Arbeitsaufnahme von Kriegsflüchtlingen, die in Polen sofort arbeiten dürfen und nicht auf die Anerkennung zahlreicher Zertifikate warten müssen. Im Landkreis gibt es ein „Welcome Center“, nicht nur für tschechisches und polnisches Personal in Pflege und Gesundheit, sondern auch für die Anwerbung von Menschen aus Vietnam.
Laura Isabelle Marisken, parteilose Bürgermeisterin Heringsdorf, sieht wirtschaftliche Gründe für die aktuellen Wahlentscheidungen vieler Menschen: „Wenn ich nachfrage, woher die Unzufriedenheit kommt, dann werden die massiv gestiegenen Preise und im Speziellen der Gaspreise genannt. Die hohen Energiepreise haben natürlich massive Auswirkungen auf die Kosten anderer Produkte. Viele verstehen nicht, wieso sie hier den Preis dafür zahlen müssen. Dabei ist auch die Vergangenheit nicht unerheblich, viele Bürgerinnen und Bürger sind zum Beispiel sehr russlandfreundlich aufgewachsen.“ Viele Maßnahmen, gerade zum Klimaschutz, werden als von oben diktiert wahrgenommen. Eine Stornierungwelle für Ostseeurlaube sei nicht wahrnehmbar. Der Umgang mit der Region sei „nicht fair“. Ihr Fazit: „Meine Angst ist, dass die ländlichen Regionen und die Metropolen, was politische Ansichten angeht, immer weiter auseinanderdriften. Entweder steht man auf der einen Seite oder der anderen. Ich empfinde da eine tiefe Spaltung. Wir müssen wieder mehr aufeinander zugehen. Das sollten wir ernst nehmen.“
Luca Piwodda hat in Gartz in der Uckermark eine eigene Partei gegründet, die Freiparlamentarische Allianz. Er ist 25 Jahre alt und leitete eine kleine Gemeinde. Sein Erfolgsgeheimnis: eine gelungene Beteiligung der Bürger:innen, Partizipation im besten Sinne: „‚Ich habe die Menschen erst zum Mitmachen animieren müssen – inzwischen gibt es dafür einen digitalen Prozess und einen analogen Prozess.‘ Für die Jüngeren hat er mit ein paar Freunden ein digitales Parteiparlament eingerichtet, in dem jede und jeder auch nur projektweise mitmachen kann. Für die Älteren gibt es jeden Dienstag um 14.30 Uhr einen kleinen Kaffeeklatsch; hier können sie Brettspiele und Karten spielen und ein bisschen quatschen. Zudem biete er Bürgersprechstunden an, schreibt einen Wochenrückblick in den sozialen Netzwerken, ‚für die Älteren auch bei Facebook und in meinem WhatsApp-Status‘.“ Die in traditionellen Parteien übliche Ochsentour – er hatte es in der SPD versucht – habe ihn abgeschreckt. Die Zukunft der Lausitz sei noch offen, man wartet bereits drei Jahre auf eine Entscheidung zur Umrüstung der PCK-Raffinerie in Schwedt von russischem Erdgas auf Wasserstofftechnologie.
Im sächsischen Großhartau (Landkreis Bautzen) erhielt die SPD bei der letzten Kommunalwahl 46 Prozent der Stimmen. Jens Krauße ist Bürgermeister in seiner vierten Amtszeit. Die Kommunalwahlergebnisse unterscheiden sich deutlich von den Ergebnissen bei bundesweiten Wahlen. Der Frust in der Bevölkerung ist erheblich, das gute Kommunalwahlergebnis ist auf viel persönlichen Einsatz zurückzuführen: Jens Krauße sagt: „Mich nervt es maßlos, diese sinnlosen Debatten im Fernsehen zu sehen, in denen sich Vertreter der Koalitionsparteien keine 24 Stunden nach einem Kompromiss schon wieder beharken. Das geht nicht, das ist kein Stil. Gleichzeitig wünsche ich mir vom Kanzler mehr Durchsetzungsfähigkeit. Ich bin in dieser Angelegenheit bekennender Schröder-Fan. Wenn er etwas gesagt hat, hat er das auch konsequent durchgesetzt. Bei Herrn Scholz fehlt mir das.“
Hoyerswerda ist einer der Orte der Pogrome gegen Geflüchtete zu Beginn der 1990er Jahre. Am 20. September 2020 wurde dort der Sozialdemokrat Thorsten Ruban-Zeh für sieben Jahre mit 44,3 Prozent zum Oberbürgermeister gewählt. Seine Gegenkandidatin war die von Linken, Grünen und einer Bürgerinitiative unterstützte Dorit Baumeister. Sie erhielt 33,4 Prozent der Stimmen. „Auch bei den Bundestagswahlen erhielt die SPD in Hoyerswerda 2021 immerhin 24,7 Prozent. ‚Heute, nach zweieinhalb Jahrzehnten Strukturwandel, gibt es Baumeister zufolge in Hoyerswerda eine ganz neue Generation an Leuten, die sich selbst organisieren und etwas auf die Beine stellen ‚Selbstwirksamkeit ist Demokratieerfahrung.‘ Der Populismus der Rechtsextremen lebe letztlich davon, dass die Menschen unzufrieden, aber apathisch seien. ‚Eine aktive, kritische Bevölkerung, die selber macht und die nicht passiv bleibt, ist das Wertvollste, was eine Gemeinschaft haben kann.‘ Die AfD spielt keine Rolle bei der Mehrheitsbildung im Rat, ungeachtet ihrer acht Ratsmitglieder (von 30). Sie spielte auch keine Rolle bei den kommunalen Projekten, die auf den Weg gebracht wurden, darunter eine Unterkunft für Asylbewerber, die als ‚offenes Haus‘ konzipiert und umgesetzt wurde.“ Bei den sächsischen Kommunalwahlen im Jahr 2024 konnte die AfD gerade einmal einen Sitz hinzugewinnen. Bei der Bundestagswahl sah es anders aus. Die SPD stürzte von 24,7 Prozent auf 9,5 Prozent ab. Das Direktmandat gewann mit über 40 Prozent der Kandidat der AfD, die auch bei den Zweitstimmen etwa 40 Prozent der Stimmen erreichte. Die CDU erhielt etwa 19 Prozent der Stimmen, die Linke 11 Prozent, das BSW 10 Prozent. Der Direktkandidat der Linken erreichte sogar 14,5 Prozent der Erststimmen.
Es ließe sich aus diesen Reportagen der Schluss ziehen, dass die Bundesregierung von manchen Kommunalpolitiker:innen lernen könnte. Mehr örtliche Präsenz, Orientierung an konkreten Problemen – das wäre vielleicht eine Lösung für demokratische Mehrheiten. Eben dies lässt sich aus dem Kommentar von Pascal Beucker zum überraschenden Erfolg der Linken bei den Bundestagswahlen am 23. Februar 2025 ableiten (in der April-Ausgabe 2025 der Blätter für deutsche und internationale Politik). Offenbar ist der Linken etwas gelungen, das ihren Wähler:innen die Botschaft vermittelte, die Partei kümmere sich um ihre alltäglichen Sorgen: „Mit einer Mietwucher-App und einem Onlineheizkostencheck gelang es ihnen dabei, ganz praktisch zu vermitteln, dass es der Partei nicht mehr nur um sich selbst, sondern um die Verbesserung des Lebens aller geht, ‚die nicht mit einem goldenen Löffel im Mund geboren wurden‘, wie es van Aken formuliert.“ Dem entsprach auch die „großangelegte Haustürkampagne“. Dies waren wesentliche Elemente des geänderten Politikstils. Die hohe Social-Media-Präsenz von Heidi Reichinnek und die „Mission Silberlocke“ sorgten für weitere mediale Aufmerksamkeit.
Wie stark ist die Zivilgesellschaft?
So weit, so gut, oder auch nicht? Ein anderes Bild bietet Elisa Pfleger, Studentin der Internationalen Beziehungen an der TU Dresden und freie Journalistin, in ihrem Beitrag „Rechte Gewalt, leere Kassen: Ostdeutsche Zivilgesellschaft unter Druck“ (ebenfalls in der Aprilausgabe 2025 der Blätter für deutsche und internationale Politik). Sie beschrieb die Lage in der sächsischen Gemeinde Limbach-Oberfrohna. Dort bieten die „‚soziale und politische Bildungsvereinigungen Limbach-Oberfrohna‘ politische Infoveranstaltungen, Konzerte, Filmvorführungen und Sprachcafés mit Geflüchteten.“ Nicht nur das: Es gibt eine Bildungsvereinigung, den die sich dort treffenden jungen Leute „Die Doro“ nennen. Rechtsextremisten haben den Club bereits einmal abgefackelt. Und sie haben ihre eigenen Begegnungsorte geschaffen: „So richtet sich die neonazistische Kleinstpartei ‚Der III. Weg‘ mit Treffpunkten, Nachhilfe, Kampfsporttraining und einer eigenen Jugendorganisation gezielt an junge Leute im Landkreis Zwickau, in dem auch Limbach-Oberfrohna liegt.“
Die AfD weiß genau was sie tut, wenn sie in den Kommunen, in den Ländern, nicht nur in Ostdeutschland, zum Beispiel auch in Bayern, durchweg Demokratieprojekte, beispielsweise aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben“, angreift und beantragt, diesen die kommunalen Eigenmittel zu entziehen. So geschah es im Landkreis Sonneberg nach dem Erfolg des AfD-Kandidaten bei der Landratswahl. Gleichzeitig war feststellbar, dass „rechte Gewalttaten in die Höhe schnellten“. Umso gefährlicher ist es, wenn in Bundes- und Landeshaushalten die Mittel für Demokratiebildung und den Kampf gegen Extremismus gekürzt werden. Sogar die Bundeszentrale für politische Bildung und die Landeszentralen sind betroffen. Ein schon lange geplantes Demokratiefördergesetz wurde in den beiden letzten Legislaturperioden des Bundestages verhandelt. Zu einem Beschluss kam es nicht.
In der taz berichtete Joscha Frahm in seiner Reportage „Die gekürzte Demokratie“: „Viele zivilgesellschaftliche Initiativen, die Demokratieschutz betreiben, fürchten um ihre Existenz.“ Er verweist beispielhaft auf Einsparziele in Nordrhein-Westfalen und in Sachsen: „Dem Netzwerk Tolerantes Sachsen mit 150 Initiativen drohen massive Einsparungen.“ Dazu gehören die mobilen Beratungsstellen, organisiert vom Kulturbüro Sachsen e.V. Fünf Teams, bestehend aus Soziolog:innen, Jurist:innen, Historiker:innen fahren über die Dörfer, um mit den Menschen vor Ort zu reden.
Wenn jetzt im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD zwar der Bestand des Programms „Demokratie Leben“ befürwortet, aber gleichzeitig eine Evaluation angekündigt wird, ist durchaus Misstrauen angezeigt. Denn der Erfolg solcher Maßnahmen ist bereits jetzt nachweisbar. In der Zeitschrift des Arbeitskreises Deutscher Bildungsstätten (Ausgabe 2 / 2023) stellten Katrin Reimer-Gordinskaya, Stefanie Kummer, Judith Linde-Kleiner und Achmad Shtewa eine solche Untersuchung, bezogen auf „prekarisierte Stadtteile Ostdeutschlands“, vor. Es gibt gut angenommene Projekte wie die „StadtseeGeschichten“ in Stendal, die in dem Untersuchungsbericht ausführlich vorgestellt werden. Aber der Aufwand für ein solches Verfahren ist hoch, sehr hoch. Fehlen die Haushaltsmittel, lässt sich absehen, was dann geschieht beziehungsweise nicht (mehr) geschehen kann. Gefährlich ist allerdings – so die Untersuchung – auch ein paternalistischer Ansatz, der den Eindruck erwecke, es handele sich bei den Projekten um Belehrung oder gar Kontrolle. „Die unterprivilegierten Milieus werden als ‚politische Laien‘ abgewertet, deren Habitus den Ansprüchen politischer Kompetenz nicht entsprechen und werden somit aus politischen Institutionen ausgegrenzt.“
Die AfD pflegt eine Art Doppelstrategie, einerseits gibt sie sich betont bürgerlich – ungeachtet so manch verbalen Unflats in Räten und Parlamenten – andererseits spielt sie rechte Straßengewalt bewusst herunter, sodass man fast schon von bewusster Akzeptanz sprechen könnte. Wenn Gewalt angeprangert wird, ist es immer nur die Gewalt von Migranten. Demokratiebildende Projekte und Projekte gegen Extremismus hingegen werden bewusst delegitimiert, indem behauptet wird, sie wären nicht „neutral“. Anastasia Tikhomirova hat in der ZEIT einen solchen Fall aus einem Gymnasium im Allgäu dokumentiert. Ein Neutralitätsgebot gibt es allerdings nicht, im Gegenteil: Die Grundrechte sind nicht verhandelbar, weder in der Schule noch in der außerschulischen Bildung. Andreas Voßkuhle hat zum 100jährigen Jubiläum des Deutschen Volkshochschulverbandes (veröffentlicht in „Aus Politik und Zeitgeschichte“ vom 15. April 2019) klar formuliert, dass das Grundgesetz „den kritischen und informierten, vor allem aber neugierigen Bürger“ verlangt, ein Anliegen, das sich auch in den Landesverfassungen ausdrücklich wiederfindet.
Auch die KMK hat im November 2018 einen entsprechenden Beschluss gefasst, der die Grundlagen des freiheitlich-demokratischen Rechtsstaats für unverhandelbar erklärt und von Lehrkräften fordert, sich aktiv für sie einzusetzen. Finanzzusagen waren damit nicht verbunden, sodass ein Dilemma entsteht. Auf der einen Seite betonen viele Politiker:innen in Bund, Ländern und Kommunen, Regierungschef:innen, Minister:innen, Bürgermeister:innen, Landrät:innen die Bedeutung von Engagement für die Demokratie, auf der anderen Seite arbeiten viele Demokratieprojekte in äußerst prekären Verhältnissen, weil sie jedes Jahr erneut die benötigten Mittel beantragen müssen. Jede Kürzung in diesem Bereich spielt der AfD in die Karten.
Der Weg in die Zukunft
Ohne eine aktive Zivilgesellschaft sind partizipative, demokratische Aktivitäten in Kommunen bedroht. Ohne kommunale Unterstützung, ohne Zuschüsse aus Landes- und Bundesmitteln, ist die Zivilgesellschaft machtlos. Bürgermeister:innen, Landrät:innen, Abgeordnete in Landtagen und Bundestagen können und sollten sich mit der Zivilgesellschaft verbünden, ungeachtet von Meinungsverschiedenheiten im Detail. Viele lokale Projekte sind einfach nur lokale Projekte und wenn Bürger:innen wissen, dass man mit ihnen spricht, sie wahrnimmt, sicherlich nicht alles umsetzt, was sie fordern, aber begründet, warum das eine machbar ist und das andere nicht, entsteht ein Gefühl für gelebte Demokratie. Marina Weisband hat dies im aula-Projekt, Sandro Witt in dem Projekt „Betriebliche Demokratiekompetenz“ dokumentiert. Die oben beschriebenen kommunalen Beispiele zeigen, wie eine bürgernahe Politik aussieht. Steffen Mau hat in seinem Buch „Ungleich vereint“ (Berlin, edition suhrkamp, 2024) nicht nur erklärt, was Ost und West nach wie vor unterscheidet, sondern auch das Potenzial beschrieben, das 1990 in der Aufbruchstimmung der Runden Tische lag und das in der Form von Bürgerräten neu entdeckt und ausgestaltet werden könnte. Er konstatiert, „dass Bürgerräte im Osten an Erfahrungen mit Runden Tischen und Bürgerdialogen anknüpfen könnten, die bei den meisten Ostdeutschen mit positiven Erinnerungen an politische Selbstwirksamkeit verbunden sind.“ Das Netzwerk „Mehr Demokratie e.V.“ pflegt auf seiner Seite eine Datenbank für Bürgerräte.
Die demokratischen Parteien, zu denen die CDU endlich auch die Linke zählen sollte, die mit dem SED-Erbe nun wirklich nichts mehr zu tun hat, stehen vor einer großen Aufgabe. Sie müssen Präsenz zeigen, sich kümmern, nicht nur in Ostdeutschland, auch in so manchen westdeutschen Städten und Stadtteilen, in Kaiserslautern, in Gelsenkirchen, in Köln-Chorweiler, in den Stadtteilen nördlich der A 40. Marina Weisband plädierte zuletzt gegen die „Selbstentmächtigung“ und für die Ermöglichung der Erfahrung von „Selbstwirksamkeit“ und sagte: „Die Lösung ist, den Menschen annehmen und seine Ideologie ablehnen. Beides in einer radikalen Art. Ich rede nicht über deinen Rassismus, aber ich werde dich fragen, wie es dir geht. Und ich werde dich ernst nehmen.“ Wir haben die Chance, die leider nach wie vor treffende Typologie Martin Sabrows aufzulösen. Wer Demokratie mitgestalten kann, muss sich mit nichts mehr arrangieren, sorgt für Fortschritt und wird in der Immunität gegen autoritäre Versuchungen gestärkt.
Norbert Reichel, Bonn
(Anmerkungen: Erstveröffentlichung im April 2025, aktualisiert am 24. Juni 2025. Internetzugriffe zuletzt am 18. April 2025. Titelbild: Hans Peter Schaefer aus der Serie „Deciphering Photography“.)