Poetik der Queerness
Ein Gespräch mit Aiki Mira über Science Fiction
„So wertvoll unser Bewusstsein auch ist, es bleibt eine Interpretation der Realität und wie alle Interpretationen ist sie subjektiv. Vergiss das nicht, wenn du da drin bist und erlebst, dass ein Neurobiest nicht nur ein Organ, sondern auch eine Verbindung ist – ein Tor.“ (Aiki Mira, Neurobiest)
Ist Science Fiction Prophezeiung, Extrapolation des Vorhandenen oder ein erkenntnistheoretisches, ontologisches Spiel der Möglichkeiten? Ein Genre des Sprachspiels im Sinne von Ludwig Wittgenstein? Wohin gelange ich, wenn ich mich auf Science Fiction einlasse, auf die Romane, Erzählungen und Essays von Aiki Mira beispielsweise? Aiki denkt über solche Dinge immer wieder nach, schreibt Science Fiction, Romane und Erzählungen, reflektiert in Essays, Podcasts und Interviews, auf Kongressen. Im Demokratischen Salon hat Aiki im Februar 2024 das programmatische Manifest „Post-Cli-Fi“ veröffentlicht. Für den Roman „Neongrau“ erhielt Aiki den Kurd Laßwitz Preis. Für den SWR co-hostet Aiki den Podcast „Das war morgen“.

Aiki Mira. Foto: Miguel Ferraz, Rechte bei Aiki Mira.
Aiki bezeichnet sich als nicht-binäre Person, spricht gelegentlich von Queer*-Science-Fiction. Aikis Vorname ist Programm, es erinnert an Figuren aus der populären Welt des japanischen Manga, die es mit eigenen Foren auf beide deutsche Buchmessen geschafft hat, ist aber auch ganz einfach eine Zusammensetzung aus AI = Artificial Intelligence und KI = Künstliche Intelligenz. Im Grunde sind Menschen, die Literatur schaffen, selbst eine Art (heißt in manchen Sprachen „Kunst“) weiterentwickelte Lebensform und in „artificial“ finden wir, was Literatur ist, eine Kunst, leicht verändert mit dem Umlaut der deutschen Übersetzung „künstlich“. Vielleicht ist Science Fiction auch eine spirituell-literarische Variante des Cosplay, indem wir mit Identitäten spielen, weil wir uns ohnehin ständig neu orientieren müssen? Aber in welcher Welt? In „Neongrau“ gibt es eine vorläufige Antwort: „Die Welt ist ein verwackeltes Video.“ Und auf die Literatur bezogen schrieb Aiki im Februar 2024 in der ZEIT-Reihe „10 nach 8“: „Ein schreibender Körper ist ein utopischer Körper, weil er zum Ort wird, an dem Utopien entstehen. Nicht-Orte, die wir im Schreiben bereisen.“ Wer ist wer, was ist was? Was ist wirklich? Was könnte wirklich sein oder wirklich werden, was eher nicht?
Geschichten schreiben
Norbert Reichel: Deine Romane „Titans Kinder“, „Neongrau“ und „Neurobiest“ sind kurz hintereinander veröffentlicht worden. Im Herbst 2024 kommt mit „Proxi“ der vierte Roman in die Buchläden. Die Bücher haben doch sicherlich eine längere Geschichte.
Aiki Mira: Sobald ich schreiben konnte, habe ich geschrieben – Geschichten. In der Grundschule habe ich mein erstes Buch geschrieben, für meine Geschwister, es war ein interaktiver Roman, in dem sie entscheiden konnten, wie es weitergehen sollte. Schon als Kind habe ich manche Nächte durchgeschrieben und hatte auf meinem Finger immer so eine Schwiele, dort, wo der Stift auflag. Schreiben ist bis heute etwas, das ich machen muss. Bis zum Abitur habe ich in vielen Nächten lieber an meinen Geschichten geschrieben als den Schulstoff zu lernen. Im Studium musste ich das unterdrücken, weil ich jetzt wissenschaftlich schreiben wollte. Kreatives Schreiben empfand ich damals wie eine Sucht. Aber eigentlich ist es für mich wie Atmen. Ich kann es unterdrücken, aber eben nur für gewisse Zeit. Und wenn ich es unterdrücke kommt es zu allen möglichen und unmöglichen Gelegenheiten wieder raus. Das habe ich auch meinem damaligen Professor gesagt. Er meinte, das hänge wohl damit zusammen, dass das wissenschaftliche Schreiben mich von mir selbst entfremde. Irgendwann habe ich mich dann entschieden, in einem Moment, in dem sich auch viele Dinge änderten, in denen es ein Vorher und ein Nachher gab. Ich habe mir gesagt, du wolltest immer schon schreiben, jetzt mach es endlich voll und ganz.
Das erste Manuskript war „Neongrau“. Verlage wussten nicht, was es war. Ich auch nicht. Zeitgleich begann ich, meine ersten kurzen Science-Fiction-Erzählungen zu schreiben. Jetzt, da ich regelmäßig schreibe, atme, kommt das Schreiben nicht mehr so unkontrolliert über mich und das fühlt sich sehr gut an.
Norbert Reichel: Dein Studium hatte mit dem, was du heute schreibst, einiges zu tun.
Aiki Mira: Medienkommunikation und besonders Computerspielforschung interessiert mich sehr – wie wir Medien nutzen und was das mit uns macht, wie Technologien unsere Beziehungen und unser Zusammenleben verändern. Das sind die Themen, zu denen ich im Studium geforscht habe. Meine Science Fiction kann daran anknüpfen.
Norbert Reichel: Beim Lesen deiner Romane, vor allem von „Neongrau“ hatte ich den Eindruck, dass das Gaming irgendwie doch eine Allegorie unserer Welt sein könnte.
Aiki Mira: So weit habe ich jetzt gar nicht gedacht. Es war klar, dass ich etwas zu E-Sports schreiben wollte, weil ich mich damit so lange beschäftigt hatte. Zudem wollte ich den Körper in das wettkampfmäßige Gaming hineinbringen, daher auch das „Neurosubstrat“. Gaming wird dadurch eine Mixed Reality. Du musst in einen „Tank“ gefüllt mit „Neurosubstrat“. Gaming als lebensgefährlicher Tauchsport und gleichzeitig ein virtueller Kampf, den du durch die VR-Brille erlebst. Diese verschiedenen Realitätsebenen haben mich fasziniert.
Norbert Reichel: Die Idee gefällt mir auch, körperliche Erfahrungen verschiedener Realitäten, alles gleichzeitig, irgendwie „Everything Everywhere All at Once“.
Aiki Mira: Dadurch steht etwas auf dem Spiel. Körper und Virtualität sind für mich ein wichtiges Thema. In „Proxi“ wird das auch eine Rolle spielen, dieses Ineinandergehen von virtuellen Welten und Post-Klima-Landschaften, das Ineinandergehen von KIs und Körpern.
Norbert Reichel: Dein Manifest „Post-Cli-Fi“ fasst meines Erachtens im Grunde all diese Entwicklungen sehr prägnant zusammen. Es hat etwas Inspirierendes und zugleich etwas Bedrückendes. Du sagst, du schreibst „posthuman, postanthropozentrisch, postmigrantisch, postapokalyptisch“, eine „politische Literatur“.
Aiki Mira: Ich glaube, das ist momentan eine verbreitete Stimmung bei jungen Leuten. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass alles von selbst gut wird, daher will ich nicht versuchen zu beschwichtigen. Stattdessen nehme ich diese Stimmung auf und denke darüber nach, was wir damit Konstruktives machen können. Das Schreiben ist das Medium, in dem ich mich mit der Welt auseinandersetze.
Entgrenzend Schreiben
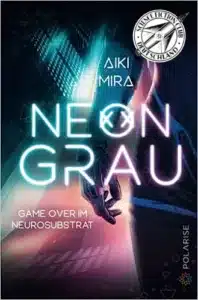 Norbert Reichel: In deinen Romanen und Erzählungen spielt das Thema der Identität eine zentrale Rolle. In einem durchaus erweiterten Sinne. Es gibt die klassischen Gender-Themen, es gibt nicht-binäre Personen mit einer – wie du gelegentlich schreibst – „fluiden“ Identität. In „Neongrau“ oder in der Erzählung „Utopie 27“ gibt es je eine asexuelle Person, in „Neongrau“ lebt jemand „als Mädchen und als Junge“. Aber es geht noch weiter: Personen sind mit Maschinen verbunden, sie sind mit anderen Personen verbunden, teilen sich zumindest Teile ihrer Identität mit anderen. Sie sind – meines Erachtens passt am besten der englische Begriff – „enhanced“. Sie sind – das wären nicht ganz so gut passende deutsche Begriffe, die aber immerhin die Richtung zeigen – „verbessert“, „weiterentwickelt“, im lateinisch inspirierten Wissenschaftsjargon der Gentechnik: „optimiert“. Im Star-Trek-Universum gibt es die „Augments“, auch das wäre meines Erachtens ein passender Begriff. In deiner Erzählung „Die Grenze der Welt“ (ausgezeichnet mit dem Deutschen Science Fiction Preis) gibt es sogar das Werbeversprechen „Ein Robokind für alle“, ein Wesen mit symmetrischen Gesichtszügen und dem Gedächtnis eines Computers.
Norbert Reichel: In deinen Romanen und Erzählungen spielt das Thema der Identität eine zentrale Rolle. In einem durchaus erweiterten Sinne. Es gibt die klassischen Gender-Themen, es gibt nicht-binäre Personen mit einer – wie du gelegentlich schreibst – „fluiden“ Identität. In „Neongrau“ oder in der Erzählung „Utopie 27“ gibt es je eine asexuelle Person, in „Neongrau“ lebt jemand „als Mädchen und als Junge“. Aber es geht noch weiter: Personen sind mit Maschinen verbunden, sie sind mit anderen Personen verbunden, teilen sich zumindest Teile ihrer Identität mit anderen. Sie sind – meines Erachtens passt am besten der englische Begriff – „enhanced“. Sie sind – das wären nicht ganz so gut passende deutsche Begriffe, die aber immerhin die Richtung zeigen – „verbessert“, „weiterentwickelt“, im lateinisch inspirierten Wissenschaftsjargon der Gentechnik: „optimiert“. Im Star-Trek-Universum gibt es die „Augments“, auch das wäre meines Erachtens ein passender Begriff. In deiner Erzählung „Die Grenze der Welt“ (ausgezeichnet mit dem Deutschen Science Fiction Preis) gibt es sogar das Werbeversprechen „Ein Robokind für alle“, ein Wesen mit symmetrischen Gesichtszügen und dem Gedächtnis eines Computers.
Aiki Mira: Für mich ist das Andere, das Fremde ein wichtiges Thema. Mich fasziniert die Science Fiction als ein Genre, das sich schon sehr lange mit dem Anderen auseinandergesetzt hat. Schauen wir uns einen Klassiker an, Mary Shelleys „Frankenstein or The Modern Prometheus“, der oft als der erste Science-Fiction-Roman angesehen wird. Hier schafft Wissenschaft einen anderen Menschen. Es geht mir aber nicht nur um Menschen, es geht um Maschinen, um Künstliche Intelligenzen. In „Neongrau“ finden wir dies bei Ctrl und in der Emanzipation von Ctrl. Mich interessieren Möglichkeiten, das Fremde zu erzählen, ohne in die Falle des „Othering“, der „VerAnderung“ des Fremden hineinzutappen. Ich will anerkennen, dass das Fremde, das Andere anders ist, aber gleichzeitig verhindern, dass Hierarchien entstehen. Ich will stattdessen Empathie ermöglichen, also einen Zugang zum Anderen, zu etwas, das uns erst einmal fremd erscheint. Ich will Grenzen überschreiten.
Norbert Reichel: Deine Methodik ließe sich auch mit Queer-Theorien begründen. Ich habe Judith Butler – ungeachtet ihrer politisch doch sehr merkwürdigen Äußerungen, die aber nichts mit ihrer wissenschaftlichen Arbeit zu tun haben – immer als Theoretikerin einer Methode gelesen, sich die Welt in ihrer Vielfalt zu erschließen.
Aiki Mika: Mir geht es nicht nur darum, Queerness darzustellen, sondern auch über die Frage nachzudenken: Wie kann ich im Schreiben andere Zukünfte erschließen? Ein solches Verständnis von Queerness erfordert ein anderes Schreiben, andere Erzählweisen, als wir das gewohnt sind. Queerness ist dann mehr als Identität, es ist – wie du sagst – eine Methode. Queer Schreiben habe ich gerade in einem Essay thematisiert, der im kommenden „Science Fiction Jahr 2024“ (herausgegeben von Melanie Wylutzki / Hardy Kettlitz) erscheinen wird.
Queer schreiben bedeutet für mich zum Beispiel statt von einzelnen Held:innen von Teams, von Kollektiven zu schreiben, wie die Familienkonstellationen in „Neongrau“ oder „Die Unerschütterlichen“ in „Neurobiest“. Damit zusammenhängend greife ich gern auf multiperspektivisches Erzählen zurück. In meinen Texten gibt es Perspektivwechsel, auch innerhalb einer Szene, oder wie in „Neurobiest“ Perspektivwechsel über verschiedene Erzählzeiten und Orte hinweg, die ich versuche ineinanderfließen zu lassen, zu entgrenzen. Das dient auch dazu, Hierarchien abzubauen. Das Multiperspektivische entspricht zudem einer feministischen Ethik. Es gibt bei mir nicht die eine zentrale Perspektive. Es kommen immer auch andere Stimmen zu Wort.
Norbert Reichel: In einem anderen Essay schreibst du: „In der feministischen Space Opera wird das Weltraum-Abenteuer schon früh zur existenziellen Identitätsfrage umgedeutet und als eine Reise erzählt, die auch nach innen führen kann.“ Als Star-Trek-Fan – du erlaubst mir diese kleinen Ausflüge, die ich nicht lassen kann – denke ich an Personen wie Seven of Nine, B’Elanna Torres, Michael Burnham oder Laan Noonien Singh, auf die das durchweg zutrifft. Sie reisen alle zu sich selbst. Ähnliches gilt im Marvel-Universum für die X-Men. Da werden nicht nur Welten gerettet, sie retten sich selbst. Aber was bedeutet die Multiperspektivität deiner Texte konkret?
Aiki Mira: Ich versuche immer eine Gruppe zu beschreiben. In „Neongrau“ liest sich das so: „Alle haben einen Platz darin und zusammen ergeben sie ein Muster, das vielleicht das Leben selbst abbildet: ein Netz aus Beziehungen. Wie Spielfiguren in einem Game, das sich Leben nennt.“ In „Proxi“ gibt es drei Personen, die so etwas wie eine Familie bilden. In „Titans Kinder“ gibt es nicht nur einen Spannungsbogen, sondern mehrere, um immer wieder neu ansetzen zu können. Meine Bücher enden immer so, dass es weitergehen könnte, dass darüber spekuliert werden kann, wie es weitergeht, was als nächstes passiert.
Norbert Reichel: Fast schon „interaktiv“, wie die Geschichte, die du als Kind geschrieben hast?
Aiki Mira: Es muss immer klar werden, es geht nicht zu Ende, die Welt dreht sich weiter. Das ist für mich auch eine Form, Narrative zu entgrenzen. Ich versuche, aus der eigenen Schreibpraxis heraus dann auch Theorien zu entwickeln, also darüber zu reflektieren, wie ich schreibe und warum. Was queer schreiben letztendlich bedeuten kann. Dazu habe ich keine endgültigen Antworten und das ist gut so – denn es kann vieles sein und ich möchte im Schreiben noch vieles ausprobieren.
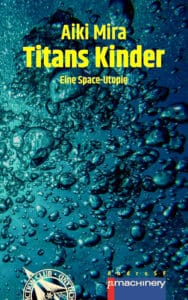 Norbert Reichel: Das ist doch eigentlich der Kern von Science Fiction: Science Fiction bietet keine Prophezeiungen, sondern Möglichkeitswelten, reflektiert auch Ängste, die überwunden werden müssen, um sich auf Zukünfte und Gegenwarten einzulassen. In „Neongrau“ erfahren wir schon zu Beginn von den „Magenschmerzen“ einer der Hauptpersonen ELLL, „weil sie chronische Angst vor dem Untergang des Planeten hat, was seit 2017 eine anerkannte psychische Störung ist.“ Ist das nur eine Depression, eine Identitätsstörung oder vielleicht einfach eine Frage der Perspektive? In „Titans Kinder“ fand ich den Hinweis, den eine der Hauptpersonen, Rain, ausspricht, nicht die Aliens, die sie auf Titan anträfen, sondern sie selbst seien die Aliens. Und schon sind wir beim Kolonialismusthema.
Norbert Reichel: Das ist doch eigentlich der Kern von Science Fiction: Science Fiction bietet keine Prophezeiungen, sondern Möglichkeitswelten, reflektiert auch Ängste, die überwunden werden müssen, um sich auf Zukünfte und Gegenwarten einzulassen. In „Neongrau“ erfahren wir schon zu Beginn von den „Magenschmerzen“ einer der Hauptpersonen ELLL, „weil sie chronische Angst vor dem Untergang des Planeten hat, was seit 2017 eine anerkannte psychische Störung ist.“ Ist das nur eine Depression, eine Identitätsstörung oder vielleicht einfach eine Frage der Perspektive? In „Titans Kinder“ fand ich den Hinweis, den eine der Hauptpersonen, Rain, ausspricht, nicht die Aliens, die sie auf Titan anträfen, sondern sie selbst seien die Aliens. Und schon sind wir beim Kolonialismusthema.
Aiki Mira: Auf jeden Fall. Wenn man über Reisen zu anderen Planeten schreibt, kann das Kolonialismusthema nicht ignoriert werden. Ich möchte darüber nachdenken und schreiben, was wir eigentlich tun, wenn wir andere Planeten, andere Welten betreten und besiedeln. Wer sind wir da eigentlich? In einem Essay über die vielen Space Operas unserer Zeit habe ich geschrieben: „Fazit bleibt: es ist kein Zufall, dass Weltraumopern oft als Western im Weltraum bezeichnet werden. Gerade durch ihr Mindset sind sie das Nonplusultra einer Grenzfiktion, getragen von einer offen kolonialen Agenda der Erforschung, Kolonisierung und Eroberung. Viele Weltraumopern verkünden das sogar wortwörtlich. Star Treks Eröffnungsmonolog ist das bekannteste Beispiel: ‚Space: the final frontier‘ (der Weltraum: die letzte Grenze), wird uns gesagt, und weiter, dass die Star-Trek-Mission darin besteht, ‚to boldly go where no man has gone before.‘“
Norbert Reichel: Auch dieser „man“ wird in gewisser Weise später queer, Patrick Stewart hat – wie er in seiner Autobiographie „Making it so“ schreibt – „no man“ gegendert. Er sagt im Vorspann „no one“. Es ist in der Tat immer die Frage der „Manifest Destiny“. Wer will, mag darin noch einmal „man“ lesen, ganz manifest. Die Frage nach der Kolonisierung bezieht Rain in „Titans Kinder“ auf eine nicht humanoide Lebensform. Wie nehmen das deine Leser:innen wahr?
Aiki Mira: Ich glaube, das ist ganz individuell. Es gibt Leute, die meine Texte gern mehrfach lesen, gerade die Kurzgeschichten, weil sie dann immer wieder etwas Neues entdecken. Andere freuen sich, wenn sie Personen treffen, die sonst in der Literatur nicht oft vorkommen, beispielsweise wenn es wie in „Neongrau“ eine asexuelle Person gibt. Wiederum andere mögen die Sprache, andere den Weltenbau. Ich glaube, es ist sehr verschieden, was Menschen in Texten suchen und finden.
Postkapitalistisch schreiben
Norbert Reichel: In der Lektüre konstruieren die Leser:innen im Grunde alle einen neuen, ihren eigenen Text. In einem Essay schreibst du „Während der Postkolonialismus bereits als Space Opera angekommen ist, bleibt der Postkapitalismus noch nicht denkbar.“ Eine postkoloniale Identität siehst du beispielsweise bei den Beltern in „The Expanse“. Etwas spöttisch schreibst du auch, es sei wohl einfacher, sich Lichtgeschwindigkeit vorzustellen als das Ende des Kapitalismus.
Aiki Mira: In der Science Fiction fehlt es meines Erachtens noch an Visionen für einen Postkapitalismus. Aber was bedeutet das „post“ hier überhaupt? Zur „Post-Climate-Fiction“ habe ich geschrieben: Hier bedeutet das „post“, dass der Klimawandel nicht irgendetwas in der Zukunft, sondern unser Alltag ist. Aber was bedeutet „postkapitalistisch“? Für mich kann das ein unsichtbarer Kapitalismus sein. Denken und handeln wir in Zukunft vielleicht alle so kapitalistisch, dass das gar nicht mehr thematisiert wird? Oder können wir Kapitalismus eines Tages wirklich überwinden und zu einem anderen System kommen?
Ursula K. LeGuin hat das zum Beispiel in „Freie Geister“ („The Dispossessed“, 1974) versucht. Auf der einen Seite haben wir den Mond Anarres mit Anarchie und einer Form von selbst organisiertem Kommunismus, zunächst ohne Hierarchien, auf der anderen Seite haben wir den Planeten Urras mit einer kapitalistischen Gesellschaft. Sie zeigt in beiden Systemen die Schrecken. In der Science Fiction fehlt es noch an Visionen, wie es anders oder ohne Kapitalismus sein könnte.
Norbert Reichel: Und „Neongrau“ mit der Gaming-Szene mit ihren „Legenden“, die vom Publikum verehrt werden?
Aiki Mira: „Neongrau“ ist sehr kapitalistisch. Das liegt daran, dass ich selbst zu E-Sports geforscht und auch zu solchen Events gegangen bin. Ein Punkt ist die Kommerzialisierung der E-Sports mit der Funktion der Influencer:innen als Marketing-Tool für die Unternehmen, die zu diesem Zweck ihre eigenen E-Sport-Teams haben.
Norbert Reichel: Interessant fand ich die Darstellung der Chinesin, die eine der „Legenden“ ist: „Über die Chinesin werden die merkwürdigsten Geschichten erzählt: dass sie eine in Menschenhaut eingenähte Maschine ist, dass sie die Welt regiert, dass sie das reichste Individuum des Planeten ist.“ Aus meiner Sicht ganz schön rassistisch, auch Antisemitismus ist drin, ein Hauch der Verschwörungserzählungen um George Soros. Ich habe „Neongrau“ so verstanden, dass die „Legenden“, die Protagonist:innen der E-Sports alle mehr oder weniger solche Projektionen und somit Gegenstand von Verschwörungserzählungen sind.
Aiki Mira: Du hast recht, das kann im aktuellen Klima als rassistische Verschwörungserzählung gelesen werden. Die eigene Erzählung wird den „Legenden“ auch weggenommen. Sie können nicht mehr ihre eigenen Geschichten erzählen, sondern es werden Geschichten für sie entworfen. „Unternehmen wie ZONE oder NYGMA bestimmen, wie die Welt zu funktionieren hat. Sie sperren uns in Knebelverträge und verdienen mit unseren Fans furchtbar viel Geld.“ Gerade bei Ash: Für ihn wurde eine neue Geschichte und Identität entworfen. Er hat keine Wahl. Das ist schon sehr krass übergriffig. Ich habe mich hier von koreanischen Pop-Stars inspirieren lassen, die Verträge haben, in denen ihnen vorgeschrieben wird, welche Beziehungen sie eingehen dürfen, welche Sexualität sie nach außen zeigen dürfen, ob sie Single sein dürfen oder nicht. Ich versuche immer zu schauen, was es in der Gegenwart gibt. Auch das ist ein Merkmal von Science Fiction, unsere Gegenwart noch einmal anders zu zeigen.
Norbert Reichel: Und zeigen muss. Ich darf aus deinem Text „Utopie 27“ zitieren: „Verschwörungsmythen, VR-Spielwelten, Echtzeit-Simulationen – statistisch gesehen ist es heutzutage wahrscheinlicher in einer fabrizierten Wirklichkeit zu leben als in der rohen Realität.“ Ich bin ja ein großer Fan der Romane „The Circle“ und „Every“ von Dave Eggers, in denen es kein einziges technologisches Element gibt, das nicht jetzt schon existiert. Es fehlen eigentlich nur Marktreife und öffentlich geförderte Verbreitung. Eggers zeigt im Grunde nur, wie mit jedem einzelnen dieser technologischen Elemente und erst recht in der Kombination all dieser Elemente eine totalitäre Gesellschaft geschaffen werden kann, in der die Individuen normiert werden und der sie nicht mehr entkommen können, und das noch nicht einmal merken.
Aiki Mira: Ich schätze die Romane von Dave Eggers so wie du. Eben das kann Science Fiction: Eigentlich ist Science Fiction eine Form von Gegenwartsliteratur. Das liebe ich an ihr. Oft wird gesagt, das Genre sehe Zukunft voraus, aber ich finde es interessanter zu entdecken, wie die Gegenwart aussieht und was sich daraus entwickeln kann, könnte.
Posthumanistisch und solastalgisch
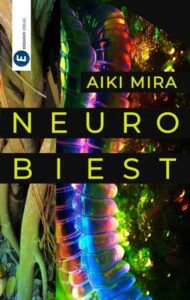 Norbert Reichel: Landen wir jetzt beim Transhumanismus? Den Eindruck hatte ich am Ende von „Neurobiest“.
Norbert Reichel: Landen wir jetzt beim Transhumanismus? Den Eindruck hatte ich am Ende von „Neurobiest“.
Aiki Mira: Wenn ich Transhumanismus verstehe, als das Überwinden, Entgrenzen der Kategorie Mensch, dann ja. Das ist meines Erachtens auch schon geschehen. Denn ich denke, es ist eine Illusion, „Mensch“ als eine stabile Kategorie zu verstehen. Wenn wir genau hinschauen, sehen wir, wie wir mit neuen Technologien andauernd über uns hinaus gehen. Das kann ich mithilfe von Science Fiction zeigen, auf die Spitze treiben. Ich denke daher auch, wir sind bereits posthuman. Wir leben mit einer Vielzahl von Mikroben und Technologien zusammen, angefangen mit Brillen, Kontaktlinsen, Hörgeräten – das sind bereits Cyborg-Elemente. In dem Essay „Wovon träumen Androiden? Von Queer*Science Fiction“ (erschienen im Queer*Welten Magazin) schreibe ich, dass Menschlichkeit wie Gender eine Performance ist, die wir einüben. Und im neuen Roman Proxi erkennt eine Figur, dass wir Menschen verdammt gut darin sind Menschlichkeit für uns zu beanspruchen und sie zugleich anderen Lebewesen abzusprechen.
Norbert Reichel: Was ist mit der Verbindung von biologischem Körper und Maschine? Manche träumen davon, Menschen, zumindest Kinder zu chippen so wie wir bereits Hunde, Katzen und Pferde chippen, damit wir immer wissen, wo sie sind. Smart-Watches mit einer solchen Funktion gibt es schon. Bei Star Trek sind die Borg der Extremfall einer solchen Verbindung, inclusive eines kollektiven Bewusstseins. Miriam Meckel und Léa Steinacker sprechen in ihrem Buch „Alles überall auf einmal“ (Hamburg, Rowohlt, 2024) von der „Mensch-Maschine-Kollaboration“ als einer zentralen Perspektive der Künstlichen Intelligenz.
Aiki Mira: Das ist auch eine Form von Entgrenzung. Ich statte die menschlichen Körper in meinen Romanen und Erzählungen gerne mit Technik aus, auch mit biologischen Enhancements. Sie leben das als Menschen, aber sind sie es noch? Zumindest junge Menschen wie Soho in „Neurobiest“ verstehen sich bereits als neue Spezies oder sie werden wie in „Neongrau“ von älteren Menschen so wahrgenommen.
Norbert Reichel: Dazu gehört dann auch das entsprechende Ambiente. In deiner Widmung in „Neurobiest“ hast du mir hineingeschrieben „Verirre dich nicht im Synbiom“. Wie kann ein Mensch sich dort verirren?
Aiki Mira: Einerseits ist das SynBiom ein Wald, eine Landschaft, oder konkreter: es erinnert uns an einen Wald. Andererseits ist es eine künstliche Umgebung, die sich auch in ihrer Künstlichkeit selbstständig weiterentwickelt. Die Umgebung beeinflusst die beiden Protagonistinnen, das hat auch etwas Psychedelisches. Es geht um die Frage, was sehe ich eigentlich? Was nimmt mein Bewusstsein wahr? Wie interagiere ich mit der Umwelt? Ich glaube, wir Menschen sind Umweltwesen. Die Umwelt prägt uns sehr – prägt, was wir eigentlich sind: gebunden an einen Planeten, wo wir immer wieder mit allem um uns, unter uns, über uns Kontakt haben. Wir sind Teil unserer Umwelt und das macht etwas mit uns. In einer biosynthetischen Umwelt macht das vielleicht auch etwas mit unserem Gehirn.
Gerade Klimawandel wirkt sich meiner Meinung auch auf unser Denken aus. Wir leben in Landschaften, die sich vor unseren Augen verändern, kaputtgehen, zerstört werden – anders werden, Arten verschwinden, Neozoen übernehmen. Das macht auch etwas mit unserer Psyche. In „Neurobiest“ wird über das Phänomen der „Solastalgie“ gesprochen, das Gegenteil von „Nostalgie“, ein Sich-Sehnen nach und trauern um verschwindende Landschaften. Riva sagt: „Das Gefühl, das mein Wohlbefinden untrennbar mit dem des Planeten und all den anderen Lebewesen verbunden ist. Mittlerweile gibt es Medikamente.“ Soho führt den Gedanken fort: „Mit dem Sterben unseres Planeten zu leben, ist unsere Aufgabe.“ Der Begriff Solastalgie stammt nicht von mir, sondern wird seit 2005 durch den australischen Naturphilosophen Glenn Albrecht geprägt. In gewisser Weise, ist das, was wir in unserer Umwelt im Klimawandel erleben, wie eine anhaltende psychedelische Droge. In „Proxi“ spreche ich bereits von einer Verschiebung des gesamten neurologischen Apparats als Folge des Klimawandels. In meinen Romanen hinterlässt Klimawandel nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich – in unserer Denkweise – bleibende Veränderungen.
Norbert Reichel: Wie viel Natur gibt es überhaupt noch? Oder bilden wir uns die nur noch ein?
Aiki Mira: Das ist die Frage. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch keine Natur erlebt. In Deutschland gibt es das gar nicht. Ich war noch nie in einer unkultivierten Landschaft oder wie auch immer wir das nennen wollen.
Norbert Reichel: Stimmt. Unsere Wälder sind Plantagen. Es gibt bei Robert Musil in „Der Mann ohne Eigenschaften“ die wunderbare Antwort auf das Lied „Wer hat dich du schöner Wald“: „Die niederösterreichische Bodengesellschaft“. Das ist die kapitalistische Version. Die Physik würde dem nicht widersprechen, es nur philosophischer formulieren, ich darf Werner Heisenberg zitieren: „Was wir beobachten ist nicht die Natur, sondern die Natur, die unserer Fragestellung ausgesetzt ist.“
Aiki Mira: Wir haben uns die Natur zurechtgebaut. Und darin sind wir aufgewachsen.
Norbert Reichel: Leben wir in einer „Matrix“, in der wir nur die Wahl haben, rote oder blaue Pillen zu schlucken?
Aiki Mira: Wir programmieren uns im Grunde gerade um. Eine Stelle aus „Neongrau“: „Manche nennen die Farbe das ZONE-Weiß. Schon komisch zu denken, dass unsere Generation nie einen klaren, blauen Himmel sehen wird, weil wir regelmäßig Schwefeldioxid in die Stratosphäre injizieren, um Sonnenstrahlen zu reflektieren und damit den Treibhauseffekt zu unterbrechen.“,
Utopisch – dystopisch – all at once
Norbert Reichel: Wir haben die beiden Organisationen ZONE und NYGMA schon kurz erwähnt. Die wirken zunächst ganz menschenfreundlich, aber wenn man genauer hinschaut, sieht es anders aus, nicht nur im Hinblick auf die Knebelverträge für die „Legenden“.
Aiki Mira: Das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt. In „Neongrau“ geben sich Unternehmen menschenfreundlich, aber handeln wie eigenständige geopolitische Einheiten. ZONE hat sogar einen eigenen Stadtteil, in dem beispielsweise für die Polizei andere Regeln gelten als außerhalb dieses Stadtteils. Ich will nicht einfach Schwarz-Weiß schreiben und nur das Gute oder nur das Schlechte zeigen. ZONE und NYGMA stehen für eine kapitalistische Menschenfreundlichkeit, die auch Vorteile für uns generiert, zugleich verfolgen solche Unternehme aber immer auch eigene kapitalistische Ziele, die sie totalitär durchsetzen können. Solche Unternehmensstädte gibt es ja bereits, nicht nur in den USA, auch gibt es Gated Communities.
Norbert Reichel: Wir könnten über die Personen nachdenken, die aus einer solchen quasi-totalitären Gesellschaft ausbrechen.
 Aiki Mira: Ich weiß gar nicht, ob ich solche Geschichten erzähle. Das ist eher das Übliche in Dystopien. Dystopien erzählen gern von einer Diktatur und davon, dass eine Person oder eine Gruppe ausbricht. Bei mir ist das nicht so eindeutig. Ich versuche Welten zu zeigen, die Schreckliches tun, aber in denen auch Wunderschönes möglich bleibt, in denen utopische und dystopische Momente nebeneinander existieren. Ich zeige Leute, die in diesen Welten leben, in ihren Beziehungen miteinander verkettet sind und versuchen mit ihren Welten zurechtzukommen. Es geht um gesellschaftliche Veränderungen innerhalb der Gesellschaft – nicht um Ausbruch. Nicht einmal in „Titans Kinder“: Da gehen Menschen auf einen anderen Planeten, aber trotzdem werden sie immer wieder mit der Erde konfrontiert, mit Abgesandten der Erde, und versuchen, auch damit zurechtzukommen, sich damit auseinanderzusetzen.
Aiki Mira: Ich weiß gar nicht, ob ich solche Geschichten erzähle. Das ist eher das Übliche in Dystopien. Dystopien erzählen gern von einer Diktatur und davon, dass eine Person oder eine Gruppe ausbricht. Bei mir ist das nicht so eindeutig. Ich versuche Welten zu zeigen, die Schreckliches tun, aber in denen auch Wunderschönes möglich bleibt, in denen utopische und dystopische Momente nebeneinander existieren. Ich zeige Leute, die in diesen Welten leben, in ihren Beziehungen miteinander verkettet sind und versuchen mit ihren Welten zurechtzukommen. Es geht um gesellschaftliche Veränderungen innerhalb der Gesellschaft – nicht um Ausbruch. Nicht einmal in „Titans Kinder“: Da gehen Menschen auf einen anderen Planeten, aber trotzdem werden sie immer wieder mit der Erde konfrontiert, mit Abgesandten der Erde, und versuchen, auch damit zurechtzukommen, sich damit auseinanderzusetzen.
Norbert Reichel: Darf ich noch einmal auf das Thema der Queerness zurückkommen. Kann diese Queerness in deinen Romanen und Erzählungen gelebt werden oder ist sie nur ein Programm?
Aiki Mira: Queerness kann in meinen Romanen gelebt werden. Ich versuche aber auch den Struggle zu zeigen, der damit zusammenhängt. In „Neongrau“ wird beispielsweise Go Stuntboi mit der Aufforderung konfrontiert sich für ein Gender zu entscheiden. Letztlich findet Go einen eigenen Weg und ein Vorbild in der KI, die Viele und Vieles sein kann. Am Ende erkennen beide, dass sie das teilen: viele sein zu wollen. Sie entwickeln füreinander Verständnis: „Zum ersten Mal kann sie (das ist Go) sehen, was das Leben bedeutet, und ist überwältigt davon. Alle haben einen Platz darin und zusammen ergeben sie ein Muster, das vielleicht das Leben selbst abbildet: ein Netz aus Beziehungen. Wie Spielfiguren in einem Game, das sich Leben nennt.“ (aus Neongrau).
Das Spiel, unser Leben, ist damit auch ein Versuch, sich gegenseitig zu sehen und zu erfahren. Phoenix entscheidet sich im Gegensatz zum eigenen Onkel dazu, ihre Queerness öffentlich zu leben und riskiert im Grunde alles. Phoenix sucht die Auseinandersetzung mit der Gesellschaft, die in den Körpern des Publikums ihr direkt gegenübersteht. Bei Go Stuntboi ist es die eigene Familie, aus der die Gesellschaft spricht. Eine Familie, die von Go fordert, sich zu entscheiden. Für mich ist das realistisch, dass Gesellschaft in uns eindringt und wir uns damit auseinandersetzen müssen. Science Fiction besitzt in diesem Sinne das Potential ein sehr realistisches Literaturgenre zu sein.
Norbert Reichel: Wie sieht es mit den Namen deiner Personen aus? Der Name „Stuntboi“ suggeriert, dass es sich um jemanden handelt, der nicht sich selbst spielt, sondern eine andere Person simuliert. Bei „Phoenix“ denke ich an die Figur des „Phoenix aus der Asche“. Wie kommen die Namen deiner Figuren zustande?
Aiki Mira: Ich recherchiere Namen und bekomme schnell ein Gefühl, ob ein Name passt. Es kann aber auch sein, dass der Name nur zu Beginn passt. Wenn ich dann weiterschreibe und die Person sich weiterentwickelt, muss ich manchmal wieder neu suchen. Einige Namen tragen Bilder in sich, wie „Phoenix“ und ihr Bruder „Ash“, der schon die Asche im Namen trägt. Phoenix kann ihre Queerness leben, Ash nicht mehr. Er wird dann auch wortwörtlich zu Asche. Aber aus der Asche entsteht dann wieder dieser Erinnerungsdiamant, den Phoenix am Ohr trägt. Die Geschichte, die Weiterentwicklung endet nie.
Das Genderparadox
Norbert Reichel: Hast du eine politische Vision? Nicht, dass Literat:innen eine haben müssten, sie können auch einfach beschreiben. Aus deinem Manifest „Post-Cli-Fi“ ließe sich aber durchaus so etwas wie eine Vision herauslesen.
Aiki Mira: Ich versuche immer unterschiedliche Stimmen zu Wort kommen zu lassen. Eine Person sagt dies, eine andere widerspricht, es entwickelt sich eine Diskussion. Als Vision würde ich queer zu schreiben sehen, für mich eine Art Poetik und zugleich Politik der Verbindungen. Durch das Queer-Schreiben versuche ich Verbindungen auch zu anderen Körpern herzustellen, nicht nur zu queeren Körpern, sondern auch zu Körpern, die von Rassismus betroffen sind, von Ableismus und vieles anderes mehr. Ich glaube, dass queer als Poetik viele neue Verbindungen erzeugen kann. Als Kategorie bringt sie bereits ganz unterschiedliche Identitäten zusammen: nicht nur unterschiedliche Sexualitäten, sondern auch Gender-Identitäten wie nichtbinär oder Beziehungsmodelle wie polyamor. Mir geht es darum, marginalisierte Stimmen und Körper zu Wort kommen zu lassen und dafür brauche ich auch neue, andere, queere Formen des Schreibens und Erzählens.
Norbert Reichel: In welche literarischen Traditionen würdest du dich einordnen?
Aiki Mira: Sehr gute Frage. Anknüpfen möchte ich mit meinen Romanen an die Science Fiction der 1970er Jahre, an die feministische Science Fiction, die das Politische in sich trägt. An Autor:innen, die auch über Sprache nachgedacht haben und darüber, wie sie schreiben wollen. Sie haben nicht nur nach neuen Inhalten, sondern auch nach neuen Schreibweisen gesucht. Große Vorbilder sind für mich Ursula K. LeGuin, James Tiptree Jr., Samuel R. Delany. Das sind Traditionen, die Mut machen, weil da Leute schon viel an dem gearbeitet haben, was uns auch Heute wichtig ist. Queer(feministische) Science Fiction knüpft ganz klar an feministische Science Fiction an.
Norbert Reichel: James Tiptree Jr. aka Alice B. Sheldon? Ist es die Geschichte eines Mädchens, einer Frau, die sich als Junge oder als Mann verkleidet, weil sie sonst nicht beachtet wird? So eine Art „Jentl the Jeshiwa Boy“? Oder ist es noch etwas anderes?
Aiki Mira: Ich lese Tiptree als queer, oder wie wir auch heute sagen würden, als nicht-binär und genderqueer. Aber das ist nur eine Leseweise, vermittelt durch die Lektüre der Tagebücher. Ich finde es toll, wie es der Sheldon gelungen ist, als James Tiptree Jr. anders maskulin zu schreiben, gleichzeitig aber auch feministisch. In den Texten nutzt Sheldon gern männliche Erzählstimmen, die vom Text selbst dann als sexistisch dekonstruiert werden. Da passiert viel über das männliche Pseudonym James Tiptree Jr.: Sheldon wurde dadurch als männlicher Autor wahrgenommen und verkörpert männliche Identität sowohl als Autor als auch durch Erzählstimmen. Zudem glänzt Tiptree mit einer Vielzahl sehr unterschiedlicher Stile. Ich denke, dass das männliche Pseudonym Sheldons Schreiben befreit hat. Und ich denke auch, dass mein eigenes Pseudonym mich befreit. In dem Essay „James Tiptree Jr. – das Pseudonym als Befreiungstechnologie“ mache ich mir weitere Gedanken dazu.
Norbert Reichel: Du nanntest eben einen meines Erachtens wichtigen Begriff: „dekonstruiert“. Ist gute Science Fiction dekonstruktivistisch?
Aiki Mira: Vielleicht. Das kann sie auf jeden Fall sein. Ich finde es immer spannend, bei einem Dekonstruktionsprozess darüber nachzudenken, was wir damit konstruieren. Bei einer Drag-Performance wird Gender dekonstruiert, übertrieben weiblich oder übertrieben männlich dargestellt, aber gleichzeitig wird Gender als Drag King oder als Drag Queen neu konstruiert.
Norbert Reichel: Das fällt vielen Menschen ja nun sehr schwer, sich mit solchen De- und Rekonstruktionserscheinungen zurechtzufinden. Wir erleben eine weltweite Debatte, in der oft genug alles, was irgendwie nach Queerness ausschaut, diffamiert, ausgeschlossen, verfolgt und für alles Unheil dieser Welt verantwortlich gemacht wird. Manchmal ist das sogar recht widersprüchlich: Markus Söder verkleidet sich zum Fasching als Marilyn Monroe, aber als ein Drag King in einer KiTa im Rahmen einer Vorlesewoche vorlesen wollte, fand er das auch nicht lustig. Die Lesung wurde abgesagt. Verkleidung im Karneval ist ok, Zeigen einer Identität wohl nicht.
Aiki Mira: Ich erkläre mir diese Widersprüche daraus, dass Queerness zurzeit sichtbarer wird. Darauf reagieren manche empfindlich. Das ist vielleicht auch kein schlechtes Zeichen, denn es markiert diesen Übergang, es verändert sich etwas in unserer Gesellschaft, es gibt immer wieder diese Widerstände, aber dann normalisiert sich das Neue.
Norbert Reichel: Das entspricht etwa der These von Aladin El-Mafaalani in seinem Buch „Das Integrationsparadox“. Fremden-, Ausländerfeindlichkeit, Rassismus – all dies sei eben auch ein Zeichen von Sichtbarkeit und der Tatsache, dass ein- und zugewanderte Menschen ihren berechtigten Anspruch äußern, auch am gemeinsamen gesellschaftlichen Tisch zu sitzen und sich nicht mit einer Rolle am sprichwörtlichen Katzentisch zufriedengeben. Analog ließe sich vom Genderparadox sprechen. Ich weiß allerdings nicht, ob ich so optimistisch sein sollte.
Aiki Mira: Ich versuche das auch optimistisch zu sehen – sonst geht es einfach nicht weiter.
Die Romane von Aiki Mira:
- Proxi, Frankfurt, Fischer Tor, 2024.
- Neurobiest, Bremen, Eridanus, 2023.
- Neongrau – Game Over im Neurosubstrat – Cyberpunk-Roman, Heidelberg, Polarise, 2022.
- Titans Kinder. Eine Space-Utopie SF-Roman, Winnert, p.machinery, 2022.
(Anmerkungen: Erstveröffentlichung im Mai 2024, Internetzugriffe zuletzt am 13. Mai 2024. Den Hinweis auf das Heisenberg-Zitat verdanke ich dem Essay „Trouble and Reality“ von Meghan O-Gieblyn in New York Review of Books vom 21. März 2024, Titelbild: Hans Peter Schaefer.)
