Vom Untertan zum Bürger
Programme und Projekte von Wadi e.V. im Nordirak und benachbarten Ländern
„Die Sorge um Familie, Land, Nation war in der bürgerlichen Gesellschaft eine Realität, die Achtung der Menschheit eine Ideologie. So lange aber ein einziger Mensch durch die bloße Einrichtung der Gesellschaft elend ist, enthält die Identifikation mit dieser Ordnung im Namen der Menschlichkeit einen Widersinn.“ (Max Horkheimer, in: Zeitschrift für Sozialforschung 8, 1939)
Vor elf Jahren, am 3. August 2014, begann im nordirakischen Sindschar (beziehungsweise Šingal oder Sindjar) der Genozid an den Êzîd:innen durch die Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS). Tausende wurden ermordet, Frauen und Mädchen verschleppt, versklavt, viele gelten bis heute als vermisst. Trotz offiziellen Gedenkens und der politischen Anerkennung der Massaker als Völkermord durch den Deutschen Bundestag hat sich für die Überlebenden nur wenig verbessert. Noch immer leben Hunderttausende in provisorischen Camps, in ständiger Angst und Unsicherheit. In Deutschland leben zurzeit etwa 400.000 Êzîd:innen, weltweit die größte êzîdische Gemeinschaft außerhalb ihrer Heimat. Insbesondere Baden-Württemberg und Brandenburg haben zahlreiche Êzîd:innen aufgenommen, einige Länder, beispielsweise Schleswig-Holstein, bieten Êzîd:innen besonderen Schutz. Doch dennoch leben viele Êzîd:innen in Deutschland seit Jahren mit unsicherem Aufenthaltsstatus und sind akut von Abschiebung bedroht – zurück in ein Land, in dem ihre Sicherheit nach wie vor nicht gewährleistet werden kann. Die Nicht-Regierungsorganisation Wadi e.V. und Pro Asyl haben sich am 2. August 2025 angesichts der nach wie vor fehlenden Sicherheitsgarantien für in Deutschland lebende Êzîd:innen mit einer gemeinsamen Presseerklärung für ein dauerhaftes Bleiberecht für êzîdische Geflüchtete eingesetzt. Die aktuelle Lage in den Camps im Irak ist dramatisch, die jüngste Abschiebung einer êzîdischen Familie in den Irak wurde in der deutschen Presse kritisch begleitet, doch eine Rückkehr scheint nicht in Sicht. Die Zerstörung des Hilfsprogramms USAID durch die US-Regierung verschärft die Lage erheblich.
Êzîd:innen – Eine ganze Gesellschaft wurde ihrer Rechte beraubt
(Auszug aus einer Rede von Basma Aldakhi, langjährige Mitarbeiterin von Wadi, Projektkoordinatorin von ADWI, Suleymaniah, auf einer Pressekonferenz in Erbil am 2. Juli 2025 zur Situation der Êzîd:innen)

êzîdisches Camp © Wadi e.V.
In den Vertriebenenlagern im Regierungsbezirk Dohuk leben die Menschen nicht einfach nur unter schwierigen Bedingungen. Sie leben auch in einem Schwebezustand zwischen einer Vergangenheit, die sie mit all ihren Schrecken verfolgt, und einer unbekannten Zukunft.
Das Leben in den Lagern ist kein Leben. Es ist ein Warten.
Warten auf eine Rückkehr, auf Würde, auf eine politische Entscheidung, die sie von einer Realität befreit, mit der sie sich niemals abfinden können. Dieses Warten dauert schon lange an. Es brauchte Jahre, bis aus dem Zelt ein Haus und aus dem Lager eine vorübergehende Heimstätte wurde. Das Leben im Lager wurde dauerhaft, jedoch ohne irgendwelche Garantien oder Rechte.
Bei der Vertreibung der Jesiden geht es nicht um eine vorübergehende humanitäre Krise, sondern um eine ganze Gesellschaft, die ihres Landes, ihrer Rechte, ihrer Geschichte und ihrer Sicherheit beraubt wurde, und deren Vertrauen von den Mächtigen, der Welt und manchmal sogar vom Leben selbst zerstört wurde.
Zurückkehren!?
Einige von Ihnen werden sich vielleicht fragen: „Warum kehren die Binnenvertriebenen nicht in ihre Heimat zurück?“ Eine scheinbar einfache Frage, doch die Antwort ist bitter und kompliziert.
Jede:r Vertriebene hat eine Geschichte, die sich nicht einfach zusammenfassen lässt, und die Gründe, nicht zurückzukehren, sind vielfältig. Vor allem sind die ursprünglichen Gebiete zu einem Schauplatz von Auseinandersetzungen geworden, zu einer Konfliktzone. Sie sind zu einem Spielball in den Händen von Parteien verkommen, die sich nicht um die Menschen in der Region scheren.
Gewiss, es gibt Menschen, die nach Šingal zurückgekehrt sind, aber sie sind immer noch Vertriebene. Denn in ihren ursprünglichen Dörfern gibt es nicht einmal das Nötigste für ein menschenwürdiges Leben. Die Infrastruktur ist zu 80 Prozent oder mehr zerstört, es gibt so gut wie keine Versorgung. Šingal ist der einzige Bezirk im Irak, der seit Jahren keine funktionierende Verwaltung mehr hat, und die Regierungen haben es versäumt, diese Krise zu lösen.
Das Entschädigungsverfahren ist eine weitere Katastrophe.
Letzten Monat habe ich mehrere Familien getroffen, die zurückgekehrt sind und vor vier Jahren Entschädigungsschecks von der Regierung erhalten haben. Aber diese Schecks sind bis heute nicht ausbezahlt worden.
Die Vertreibungen sind zu einem politischen Spiel geworden, von dem leider viele profitieren. Es gibt Familien, die sagen: „Wir sind bereit, morgen zurückzukehren. Wenn wir nur glauben könnten, dass das Land, in das wir zurückkehren werden, unsere Kinder nicht wieder verschlucken wird.“ Aber was sagen wir einer Mutter, die befürchtet, dass ihr Haus bombardiert wird? Was einem Vater, der die Überreste seiner Söhne, die in Massengräbern liegen, noch nicht begraben konnte? Was einer Familie, die ihr Haus verloren hat und kein Obdach hat? Was einem Vater, dessen Name nicht auf den Entschädigungslisten auftaucht? Das ist der bittere Widerspruch:
Die irakische Regierung verkündete, das Kapitel der Vertreibungen beenden zu wollen. Sie stellte die Hilfe für die Lager ein unter dem Vorwand, dass alle in Würde nach Hause zurückkehren könnten. Seit dieser Entscheidung ist mehr als ein Jahr vergangen, und die Menschen befinden sich immer noch unter schwierigsten humanitären Bedingungen in den Lagern.
Andererseits aber hat das Ministerium für Einwanderung die Ausstellung von „Rückkehrbriefen“ eingestellt, ohne die Binnenvertriebene nicht zurückkehren dürfen!
Auch die meisten humanitären Organisationen zogen sich nach dem Regierungsbeschluss zurück; ihre Projekte in den Lagern wurden nicht fortgeführt. Was das Problem noch verschlimmerte, war die Entscheidung der US-Regierung, die Unterstützung einzustellen. Das hat die Binnenvertriebenen sehr stark getroffen.
Der Umgang mit den Vertriebenen ist voller Fragezeichen. Sicher ist: Die Frauen tragen die Hauptlast. Es gibt keine Gesundheitsfürsorge, keine angemessene psychologische Unterstützung, und viele Frauen tragen Verantwortung für ganze Familien. Einige wurden frühverheiratet, andere mussten für Niedrigstlöhne in ausbeuterischen Verhältnissen arbeiten, einfach weil es keine Alternativen gibt. Die jüngste Entscheidung der US-Regierung, die Unterstützung von vielen humanitären Organisationen einzustellen, hatte erhebliche Auswirkungen auf Frauen und Kinder. In jedem Lager gab es mehr als 300 Menschen – meist Frauen und Kinder –, die von Projekten profitierten, die von US-Organisationen finanziert wurden. Nun sind diese Projekte fast vollständig zum Erliegen gekommen.
Da die irakische Regierung ihre Hilfe unter dem Vorwand eingestellt hat, „das Kapitel der Vertreibungen (zu) beenden“, liegt die einzige Hoffnung für die Binnenvertriebenen in dieser Situation auf der Zivilgesellschaft und humanitären Organisationen.
Und was ist mit der Umwelt? Sie leidet wie die Menschen. Abfälle häufen sich an. Einige Lager liegen in der Nähe von Erdölförderanlagen, was zu einer hohen Umweltbelastung führt. Man hat dort schwere Erkrankungen festgestellt, die auf das jahrelange Einatmen verschmutzter Luft zurückzuführen sind.
Psychosoziale Unterstützung? Sie ist schwach ausgestattet, nicht verlässlich vor Ort und nicht in der Lage, mit dem Ausmaß des kollektiven Traumas Schritt zu halten, unter dem die Menschen seit 2014 und bis heute dort leiden. Einige Organisationen arbeiten, aber ihre Projekte decken nur 20% des tatsächlichen Bedarfs ab. Selbst die Gesetze, die die Opfer eigentlich schützen sollten, sind zu Instrumenten geworden, um sie zu quälen.
Die „Rückkehrbriefe“ wurden eingestellt, die Entschädigungszahlungen ausgesetzt, und die fehlende Koordination zwischen Bagdad und Erbil hat ein Übriges dazu beigetragen, die Vertreibung zu einer dauerhaften Realität werden zu lassen, statt zu einer vorübergehenden.
Wissen Sie, was es bedeutet, zehn Jahre lang vertrieben zu sein?
Man verliert seine Jugend, die Kinder wachsen ohne Stabilität und ohne Identität auf. Die meisten Kinder im Lager wissen nicht, dass sie aus Sinjar stammen, und wenn man sie fragt „Woher kommt Ihr“, sagen sie, aus diesem oder jenem Lager. Wissen Sie, was es bedeutet, wenn Ihre Zukunft von Versprechungen abhängt, die sich nicht erfüllen?
Vertriebene Êzîd:innen verlangen nicht das Unmögliche.
Sie bitten nur um eine würdige, sichere und geordnete Rückkehr. In bewohnbare Häuser, in Gebiete mit einer echten Zivilverwaltung, mit einer Schule, einem Gesundheitszentrum und einer Arbeitsmöglichkeit. Sie wollen keine Subventionen. Sie wollen Gerechtigkeit.
Doch die Gerechtigkeit will nicht kommen. Das Warten selbst ist zu einem Zwang geworden, an dem sie ersticken. Ihre einzige Hoffnung ist heute, dass die Unterstützung der Zivilgesellschaft und der internationalen Gemeinschaft so lange anhält, bis die Zeit für eine echte Rückkehr in Würde gekommen ist.“
Prekärer Schutzstatus in Deutschland und ein kleiner Lichtblick
(Thomas von der Osten-Sacken, Geschäftsführer von WADI e.V., im Juli 2025)
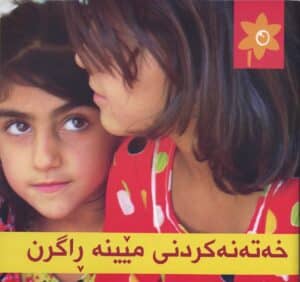 Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass ich vergangenes Jahr die Einleitung zu unserem Sommerrundbrief 2025 aus einem Park in Suleymaniah schrieb und darin unter anderem feststellte, dass viel zu früh die unerträgliche Hitze eingezogen sei. Es gab Zeiten, da versuchte man zu erklären, was es für Menschen heißt, unter solchen Temperaturen leben zu müssen. Nun, inzwischen kletterte das Thermometer auch im Rhein-Main-Gebiet auf annähernd 40 Grad und es bedarf keiner solchen Erklärungen mehr. Jede und jeder muss nun am eigenen Leib erleben, was solche Hitze bedeutet.
Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass ich vergangenes Jahr die Einleitung zu unserem Sommerrundbrief 2025 aus einem Park in Suleymaniah schrieb und darin unter anderem feststellte, dass viel zu früh die unerträgliche Hitze eingezogen sei. Es gab Zeiten, da versuchte man zu erklären, was es für Menschen heißt, unter solchen Temperaturen leben zu müssen. Nun, inzwischen kletterte das Thermometer auch im Rhein-Main-Gebiet auf annähernd 40 Grad und es bedarf keiner solchen Erklärungen mehr. Jede und jeder muss nun am eigenen Leib erleben, was solche Hitze bedeutet.
Wir erleben hautnah, dass der Klimawandel vor nationalen Grenzen keinen Halt macht, und diese alte Idee, dass es so etwas wie eine Menschheit gibt, die sich eben diesen Planeten irgendwie zu teilen hat und entweder eine Zukunft gemeinsam oder keine hat, stellt sich mit neuer Dringlichkeit – auch wenn sie gerade nicht einmal mehr in Sonntagsreden sonderlich populär ist. Zwar leiden die Menschen in Südostasien, dem Nahen Osten und großen Teilen Afrikas derzeit ungleich stärker unter den Folgen des Klimawandels als die Happy Few in den Industrienationen des Nordens, doch langsam wird auch diesen klar, dass auf Dauer die Lebensgrundlagen aller gefährdet sind. Wenn es so weitergeht, wird letztlich niemand ungeschoren davonkommen.
Umso wichtiger wäre es daher – nicht nur, wenn es ums Klima geht –, diese Idee von Menschheit wieder stark zu machen statt zu glauben, man könne sich auf Dauer erfolgreich abschotten, indem man Grenzen schließt und große Teile eben dieser Menschheit dem Elend überlässt. Leider aber steht genau dies gerade auf der Tagesordnung, und so trifft es am Ende mal wieder die am härtesten, die dringend auf Schutz und Unterstützung angewiesen wären.
Im Rahmen ihrer „Asyl- und Migrationswende“ stoppte die neue große Koalition gerade im Bundestag den, wie es im Fachjargon heißt, „Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte“. Genauer gesagt hatte bereits die Vorgängerregierung eine Obergrenze von jährlich maximal 12.000 Menschen verordnet. Unter „subsidiär Schutzberechtigte“ fallen in Deutschland auch geschätzt 30.000 Jesidinnen und Jesiden, die als Überlebende des vom „Islamischen Staat“ (IS) 2014 verübten Genozids in Deutschland um Asyl baten. Individuelle Verfolgung lag in der Regel nicht vor – dem IS ging es schließlich darum, die Êzîd:innen als Kollektiv zu vernichten (das ist das Wesen eines Genozids). Da deshalb zuständige Bundesbehörden und Gerichte bis Ende 2017 Êzîd:innen eine Gruppenverfolgung attestierten, bekamen diese in Deutschland einen Schutzstatus als so genannte subsidiär Schutzberechtigte. Dieser kann regelmäßig überprüft werden und ist weniger „stark“ als eine Anerkennung nach § 16a des deutschen Grundgesetzes.
Inzwischen wurde von einigen deutschen Gerichten entschieden, dass es keine Gruppenverfolgung für Êzîd:innen im Irak mehr gäbe. Das heißt für viele: Ihr Schutzstatus wird ihnen entzogen und es kommt immer häufiger zu Abschiebungen in ein Land, das keinerlei Zukunft für sie bereithält. Diejenigen, deren Status bis jetzt noch nicht revidiert wurde, hatten darauf gesetzt, dass ihre Familienangehörigen, die weiter in Camps im Irak leben müssen, nachgeholt werden können. Dafür warteten sie, ließen unzählige bürokratische Prozeduren über sich ergehen, nur um nun zu erfahren, dass aus all dem nichts wird, denn der Familiennachzug wird, wie es heißt, für zwei Jahre ausgesetzt. Was dies für Betroffene bedeutet, kann man sich nur schwer ausmalen.
Überhaupt, um beim Thema zu bleiben, sind es kleine Meldungen in den Medien, die dann große und verheerende Folgen haben, von denen kaum jemand etwas erfährt. Als eine seiner ersten Amtshandlungen strich US-Präsident Donald Trump einen Großteil der amerikanischen Entwicklungshilfe und kündigte an, USAID abwickeln zu wollen. Damit fielen quasi über Nacht weltweit 40 Prozent aller internationalen Hilfen weg – natürlich mit katastrophalen Auswirkungen in unzähligen Ländern.
Diese Entscheidung traf auch – fast möchte man sagen: wie sollte es anders ein? – all jene Êzîd:innen, die weiterhin, elf Jahre nach dem Genozid, in IDP-Camps leben müssen. Auf einen Schlag verschlechterte sich die Gesundheits- und Sozialversorgung noch einmal, Kindergärten wurden geschlossen, und selbst an der Müllabfuhr hapert es seitdem.
Unsere êzîdischen Kolleg:innen, die seit 2014 für Wadi in den Camps tätig sind, haben in den letzten Monaten eine Bestandsaufnahme der Lage gemacht. Wir haben dies zum Anlass genommen, in Erbil eine Konferenz zu organisieren, um lokale und internationale Medien, Regierungsvertreter:innen aus dem Irak und Mitarbeiter:innen europäischer Konsulate über die Lage vor Ort zu informieren und zu besprechen, was man nach Wegfall der US-amerikanischen Gelder unternehmen könnte, damit sich die Lebensbedingungen der Campbewohner:innen nicht noch weiter verschlechtern.
Natürlich ist auch uns bewusst, dass Konferenzen, Appelle und Berichte in der Regel wenig ändern, ja oft nur aktivistischer Ausdruck der eigenen Ohnmacht sind. Diese Konferenz allerdings war ein ausdrücklicher Wunsch, geäußert von den Partrnerorganisationen der „Active Citizenship“-Kampagne, die wir gerade mit großer Resonanz im Nordirak umsetzen. Im Zentrum dieser Kampagne steht, wie wir schon im vergangenen Rundbrief länger ausgeführt haben, das Konzept von aktiver bürgergesellschaftlicher Organisation und Partizipation, wie etwa der Anspruch, dass alle Bürgerinnen und Bürger vor dem Gesetz gleich und mit gleichen Rechten ausgestattet sind.
Dies gilt sowohl für heimatvertriebene Êzîd:innen wie auch für alle anderen Iraker:innen. So war es der Wunsch und Anspruch der „Active Citizenship“-Kampagne, das Elend in den Camps als eines von Mitbürger:innen zu adressieren und nicht etwa als humanitäres Problem einer bedauernswerten Minderheit.
Diesen Ansatz und Anspruch hatten wir schon immer, und wir haben in allen Projekten versucht, ihn umzusetzen. Daher ist es in so trüben Zeiten wie den heutigen sehr erfreulich, zu sehen, welche Bedeutung inzwischen dieses Konzept von Citizenship gerade unter jüngeren Menschen nicht nur in Irakisch-Kurdistan und dem Irak hat.
Nach dem überraschenden Sturz der furchtbaren Assad-Diktatur durch Milizen der islamistischen HTS waren viele Syrerinnen und Syrer, die das Ende dieses Regimes überall feierten, nicht nur konfrontiert mit all dem Horror, der sich ihnen zeigte, als sich die Türen der berüchtigten Foltergefängnisse öffneten. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten gab es auch Freiräume, sich zu organisieren, und die Menschen nutzten das ausgiebig. In Damaskus gründete sich vor einiger Zeit die „Syrian Equal Citizenship Alliance“, eine Plattform aus verschiedenen zivilgesellschaftlichen Gruppen, kleineren Parteien und anderen Akteuren. „Die Religion gehört Gott und die Heimat gehört allen“ ist einer ihrer Slogans. Seit Jahren schon stehen wir mit unterschiedlichen Partnern aus der syrischen Opposition in Kontakt, haben unter anderem das Projekt „Vom Untertan zum Bürger“ mit ihnen durchgeführt und sind nun froh, das im Irak gesammelte Wissen und Know How erneut in Syrien nutzbar machen zu können. So haben Wadi-Mitarbeiter:innen im Januar eine Reise nach Syrien unternommen und sich dort mit Partnern ausgetauscht. Nun arbeiten wir daran, das Active Citizenship Konzept auch dort umzusetzen. Die syrische Gesellschaft steht vor schier unbewältigbaren Herausforderungen, das Land ist weitgehend zerstört, die Infrastruktur liegt am Boden, 80 Prozent der Menschen leben unter dem Existenzminimum. Dazu kommen all die politischen und sozialen Spannungen sowie das tiefe Misstrauen vieler Menschen, darunter auch unserer Partner, ob die neue Regierung ihre Versprechen einhält oder das Land doch schleichend in einen islamischen Staat verwandeln will.
Wir jedenfalls werden, wie wir das im Irak seit nunmehr fast 35 Jahren tun, im Rahmen unserer Möglichkeiten versuchen, Initiativen und Projekte zu unterstützen, die Entwicklung und Citizenship miteinander verbinden.
Ebenso führen wir unsere Kampagnen gegen Gewalt und Genitalverstümmelung und für Umwelt- und Klimaschutz gemeinsam mit unseren Partnern vor Ort im Irak fort – auch wenn sich angesichts der allgemeinen Entwicklung vieles noch einmal schwerer gestaltet, denn der Wegfall amerikanischer Hilfsgelder macht sich überall bemerkbar. Natürlich verändern sich dadurch auch Prioritäten: Wo Menschen akut von Hunger, Krankheit oder dem Verlust ihrer Wohnungen bedroht sind, muss geholfen werden. Da Geld knapp ist, geht dies auf Kosten all jener Projekte und Programme, die wie unsere nicht auf Nothilfe, sondern langfristige Entwicklung und Veränderung zielen.
Kinderrechte, Frauenrechte, Menschenrechte – eine Kampagne von Wadi e.V.

Gemeinsam Demokratie lernen © Wadi e.V.
Im Sommer begann Wadi e.V zusammen mit seinen lokalen Partnerorganisationen eine Kampagne zur Stärkung der Rechte von Kindern und Jugendlichen. Es ging dabei um die sowohl international als auch in der irakischen Verfassung verbrieften Rechte auf Bildung und das Aufwachsen ohne Gewalt. Die Mitarbeiter:innen, die regelmäßig Kinder in Dörfern und Schulen besuchen, waren entsetzt, dass viele von ihnen noch nie davon gehört hatten, dass sie Rechte haben und diese sogar einklagbar sein sollten. Immerhin stellten sie auch fest, dass in jenen Schulen, mit denen wir seit einigen Jahren im Rahmen unserer Anti-Gewalt Kampagne kooperieren, das Wissen um solche Rechte deutlich ausgeprägter war. Das ist ein kleiner Trost in Zeiten, die insgesamt so wenig tröstlich sind.
Die Kinder und Jugendlichen, die durch diese Kampagne zum ersten Mal von ihren Rechten hörten, sind keineswegs Ausnahmen. Ganz im Gegenteil, erst langsam wird bekannt, wie wenig die Rechte von Kindern, auf die so gerne und oft in Sonntagsreden verwiesen wird, weltweit überhaupt zählen. Auch hier bleibt der Glaube an Fortschritt leider Illusion.
Einem jüngst veröffentlichten Bericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zufolge erlebt „insgesamt mehr als eine Milliarde Minderjährige jedes Jahr Gewalt. Bei drei von fünf Kindern und Jugendlichen sei es körperliche Gewalt zu Hause, bei jedem fünften Mädchen und jedem siebten Jungen sexuelle Gewalt.“ Zudem leidet laut UNICEF im Jahr 2024 eines von vier Kindern weltweit unter schwerer Unter- beziehungsweise Mangelernährung während, so die Organisation weiter, mehr als 250 Millionen Kinder an keinerlei Schulunterricht teilnehmen.
Das sind die nüchternen Zahlen und sie sprechen Bände davon, wie alle vollmundigen Erklärungen sich als Makulatur erweisen, man wolle zumindest den Hunger von Kindern in Zeiten, in denen eigentlich genug für alle da wäre, beenden oder allen wenigstens die Teilnahme an Grundbildung ermöglichen.
Erinnert man heute den John F. Kennedy zugeschriebenen Satz, Kinder seien „die lebendige Botschaft, die wir in eine Zeit senden, die wir nicht mehr erleben werden“, so spricht aus ihm, anders als vor über vierzig Jahren, nicht Hoffnung, sondern er ist eher Ausdruck kläglichen Scheiterns. So nämlich haben die Zeiten sich geändert. Nicht nur in den USA. In Deutschland machten einst die Grünen mit dem etwas kitschigen Slogan, man habe diesen Planeten von seinen Kindern nur geborgt, Wahlkampf, so wie überhaupt die bessere Zukunft für „unsere“ oder „die“ Kinder in aller Munde war. Diese Idee kann man vermutlich sogar als grundsätzlichen Glaubenssatz der Moderne auffassen, der lange klassenübergreifend geteilt wurde und den mittelalterlichen Glauben ans Seelenheil im Jenseits quasi ablöste.
Schon dieser kleine, aber feine Unterschied, ob es denn „unseren“ oder „allen“ Kindern besser gehen solle, verweist auf jenen Widersinn, von dem Max Horkheimer 1939 schrieb. Denn, man kennt es aus unzähligen US-Filmen, der Kampf ums Überleben oder Wohlergehen der eigenen Familie kann oft aus ganz egoistischen Motiven geführt werden, ja ganz bewusst die Schädigung anderer in Kauf nehmen. Schnell kann die Sorge um „unsere“ Kinder umschlagen in die Idee, es müssten dann notfalls eben „andere“ den Kürzeren ziehen. Anders ausgedrückt, der Citoyen, der einst mit dem Versprechen von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit für alle Menschen und damit auch alle zukünftigen antrat, verwandelt sich schnell in den Bourgeois, dem ein Wohlergehen vornehmlich des eigenen Nachwuchses zum zentralen Anliegen wird.
Nun scheint es dieser Tage so, als sei, zumindest in der westlichen Welt, diesem selbst der Glaube an die Zukunft der eigenen Kinder abhandengekommen, denn fast alle Länder Europas gelten inzwischen als so genannte „aging societies“ oder, um es mit John F. Kennedy auszudrücken, immer weniger potentielle lebendige Botschaften an eine zukünftige Zeit kommen hier überhaupt noch zur Welt. Noch mehr aber fällt auf, dass in den USA, wo Kinder und Familie einstmals von der Politik und der Populärkultur sehr ins Zentrum gestellt wurden, Töne wie die von John F. Kennedy eigentlich nicht mehr vernehmbar sind.
Ausgerechnet in dem Land also, dessen Bewohner, gerade auch im Vergleich mit Europa, früher zu notorischem Optimismus neigten und wo in Hollywood das Happy End erfunden wurde, gewann nun ein Kandidat die Wahl, der die Zukunft meist in düsteren Farben zeichnet und sich in seinen Reden vornehmlich in dystopischen Visionen ergeht. Ausgerechnet in den USA, die früher vom unerschütterlichen Vertrauen in ein stetig lebenswerteres Morgen geprägt war, versprach dieser Kandidat im Wahlkampf, vergangene Größe wiederherzustellen. So stellt der linksliberale britische Guardian in einem Kommentar zur Wahl auch treffend fest, ausgerechnet den Amerikanern sei offenbar der Glaube an die Zukunft verloren gegangen.
Wenn aber der Blick nach vorn sich eigentlich rückwärts wendet, man, was vergangen ist, wiederbeleben möchte – und genau dies erträumen momentan global immer mehr Regierende –, so ist es um reale Zukunft und damit auch die von denen, die ihr Leben noch vor sich haben, schlecht bestellt. Und das ist die überwältigende Mehrheit der Weltbevölkerung im so genannten Globalen Süden, denn dort sind, obwohl dort ebenfalls die Geburten zurückgehen, die meisten Menschen jünger als dreißig Jahre.
Wäre der Glaube an Menschheit mehr als nur Ideologie und die Sorge um Kinder eine, die alle auf der Welt umschlösse, gälte es stattdessen gerade jetzt, mit allen Mitteln jenem Slogan vom geborgten Planeten zu seinem Recht zu verhelfen und alles zu tun, auf dass denen, die heute jung sind, wenn schon nicht eine bessere, so doch wenigstens irgendeine lebenswerte Zukunft geboten wird.
Von etwas, das auch nur annähernd nach einfachem und grundvernünftigem Programm klingt, scheint die Menschheit heute allerdings weiter entfernt als zuvor. Eigentlich nichts spricht nämlich dafür, dass in den kommenden Jahren weniger gehungert, geschlagen oder die natürlichen Ressourcen geplündert würden.
Zugleich werden, wie es schon jetzt überall geschieht, die vergleichsweise geringen Gelder, die global dazu aufgewendet werden, um diese Missstände zu bekämpfen, weiter gekürzt. Dazu muss man nicht über den Atlantik schauen, auch der Bundeshaushalt für 2025 sah drastische Einschnitte in diesem Bereich vor. Während Hilfsgelder gekürzt wurden, stiegen die Ausgaben für Grenzsicherung erneut massiv an. Denn Kriege, Armut, Klimawandel und Unterdrückung nehmen, wie gesagt, nicht ab, sondern zu, und deshalb auch globale Fluchtbewegungen. Die Zahl derer, die von der UN als Flüchtlinge oder Binnenvertriebene (IDPs) registriert sind, übersteigt inzwischen 120 Millionen, fast doppelt so viele wie noch vor zehn Jahren.
Kurzum, die Entwicklungen sind so, dass man einmal mehr resigniert aufgeben möchte. Umso wichtiger ist es deshalb, all dem ohne große Attitüde ein Trotzdem entgegenzustellen, indem, zum Thema passend, ja auch der Trotz zum Ausdruck kommt, mit dem Kinder sich gegen Zustände oder Vorschriften wehren, die sie als Zumutung empfinden.
Es ist trotzdem möglich, auch innerhalb der herrschenden Verhältnisse, die so wenig Anlass zur Hoffnung geben, nicht nur im Kleinen für Veränderungen zu sorgen, sondern auch weiterhin an jener Idee festzuhalten, die im Begriff Menschheit aufgehoben ist. Dies gilt ganz besonders für die neue „Active Citizenship- Kampagne“ von Wadi e.V., ebenso wie im Rückblick, etwa auf zwanzig Jahre rollende Spielmobile. Wadi e.V. wird gemeinsam mit allen lokalen Partnern auch im kommenden Jahr – eben trotzdem – weitermachen, immerhin im nunmehr 34ten Jahr seines Bestehens.
„Acitive Citizenship“ – basisdemokratisch, bürgerorientiert und interdisziplinär
(Isis Elgabali, Mitarbeiterin von Wadi Deutschland)

Green City Halabja © Wadi e.V.
Im letzten Jahr hat Wadi zusammen mit seinen Partnern eine neuen basisdemokratischen, bürgerorientierten und interdisziplinären Ansatz für unsere Arbeit entwickelt – das Konzept „Active Citizenship“. In diesen Ansatz fließen viele Jahre Erfahrung aus konkreter Projektarbeit vor Ort ein, vor allem auch die Erkenntnis, welche Konzepte funktionieren und welche nicht.
Es stellt sich immer wieder heraus, dass zwar in Entwicklungszusammenarbeit viel von Nachhaltigkeit, Grassroots und Zivilgesellschaft die Rede ist, die Praxis dann aber oft leider ganz anders aussieht. Das führt immer öfter auch dazu, dass Hilfsorganisationen vor Ort generell äußerst kritisch gesehen werden und eben nicht als der richtige Ansprechpartner, wenn es um basisdemokratische Veränderungen geht. Deshalb steht „Citizenship“, also die Idee aktiven bürgerschaftlichen Engagements, auch im Zentrum dieses neuen, auf mehrere Jahre angelegten, Programms.
2017 hatte Wadi für Nordsyrien und Irakisch-Kurdistan, auch als Reaktion auf die Umwälzungen in Folge des arabischen Frühlings in der Region, das damals sehr erfolgreiche Projekt „Vom Untertan zum Bürger“ entwickelt, das Menschen die lokale Demokratie und Formen bürgerschaftlicher Teilhabe näherbrachte. Jetzt wird dieser Faden noch einmal aufgenommen, aber mit einem etwas anderen Ansatz. Das neue Programm ist eher praktisch orientiert und konzentriert sich auf die Entwicklung eines selbstbewussten Bürgerrechtsverständnisses und den Aufbau von sinnvollen Netzwerken und Strukturen um bestimmte Themen herum, wie etwa „Umwelt“. Es geht darum, verschiedene Gruppen und Institutionen zusammenzubringen, um gemeinsam an einem Problem zu arbeiten. Im Jahr 2024 konnten der Ansatz auf viele lokale Partnerorganisationen ausgeweitet werden, unterstützt vom niederländischen Konsulat im Irak.
Langfristiges Ziel des Programms ist es, an einem neuen Verständnis von aktiver Bürgerschaft zu arbeiten. Es geht darum, verschiedene Teile der Gesellschaft – zivilgesellschaftliche Organisationen, lokale Gemeinden, Studenten, Schulen, Religionsgemeinschaften, verschiedene ethnische Gruppen, lokale Journalist:innen, Bürgerjournalist:innen, Gesundheitsexpert:innen und Aktivist:innen zusammenbringen, um Aktivitäten und Projekte zu entwickeln, bei denen die aktive Teilhabe als Bürger:innen im Mittelpunkt steht. Umwelt, öffentliche Gesundheit, bürgerschaftliches Engagement von Studenten, Bürgerjournalismus und Kampf gegen geschlechtsspezifische Gewalt sind die zentralen Themen dieses Programms. All diese Themen haben untereinander Berührungspunkte, und zum ersten Mal können wir sie auf kohärente Weise angehen, weil wir diese Berührungspunkte bewusst nutzen und auf dieser Grundlage Netzwerke schaffen.
Dies geschieht in einer kritischen Zeit in der kurdischen Autonomieregion; gerade haben Wahlen stattgefunden, und viele Menschen sind vollauf mit ihren eigenen Problemen beschäftigt. Spricht man mit einem durchschnittlichen Menschen auf der Straße, hört man häufig, dass die Dinge nicht gut laufen. Viele empfinden große Frustration, da sie das Gefühl haben, der Gesellschaftsvertrag sei gebrochen. In einem der Seminare brachte eine Teilnehmerin es zugespitzt so auf den Punkt: „Die Bürger betrachten den Staat als Feind und der Staat betrachtet die Bürger als Feind.“
Es mangelt an Vertrauen in die Regierung und auch in große internationale Hilfsorganisationen, die oft eher wie Megakonzerne daherkommen und so gar nicht als Akteure wahrgenommen werden, mit denen vor Ort Betroffene zusammenkommen und gemeinsam nach Lösungen suchen können. Nach einer langen Planungs- und Diskussionsphase, in der Wadi zusammen mit allen Partnern in einem über 80-seitigen Dokument die verschiedenen Probleme und mögliche Lösungen zu Papier brachten und intensiv mit den Kollegen vom niederländischen Konsulat diskutierten, die ihre, nämlich die staatliche, Sicht einbrachten, während wir die nicht-staatliche vertraten, begann im Sommer eine erste Pilotphase dieses Programms.
So begannen unter anderem in Halabja Aktivitäten der langjährigen Partnerorganisation NWE zur Umweltproblematik, und zwar in Form von Bürgerräten unter freiem Himmel, in denen die grundlegenden Ideen des Projekts über interaktive Spiele vorgestellt wurden. Außerdem gab es Präsentationen der örtlichen Jugendlichen über die Umweltprobleme in ihren Gemeinden sowie anschließende Diskussionen. Die Jugendlichen wurden in Teams aufgeteilt und mussten Lösungen für die Umweltprobleme der jeweils anderen erarbeiten. Die Idee bestand darin, konkret darüber nachzudenken, wie man lokale demokratische Strukturen in diesem Bereich schaffen kann. Es ging darum, mittels Debatten einen Einblick in die Perspektive und Denkweise einer anderen Gruppe zu gewinnen und so ein größeres Verständnis dafür zu entwickeln, wie ein und dasselbe Problem auf verschiedene Weise angegangen werden kann. Zukünftige Aktivitäten werden weiterhin auf diesem Konzept aufbauen; die von den Jugendteams vorgeschlagenen Ideen werden dabei in die Umweltprojekte mit einbezogen.
Im Vorfeld der kurdischen Parlamentswahlen am 20. Oktober 2024 gab es eine Kooperation von KirkukNow und ADWI („Awareness and Development for Women and Children in Iraq“), um einen Leitfaden für Neuwähler:innen, die mit achtzehn Jahren das erste Mal wählen dürfen, zu erstellen: „Deine erste Stimme“. Vielen fällt es schwer, das Wahlsystem und die vielen Ideologien und politischen Parteien, die zur Auswahl stehen, zu verstehen. Die Mitarbeiter:innen von Wadi haben sich die Zeit genommen, den Wahlprozess in Kurdistan ausführlich zu erklären – wohin ihre Stimme geht und wie sie sie richtig abgeben! Das zugehörige Video erläuterte ebenfalls wichtige Fragen. Der Produktionsprozess dieses Videos war bereits für sich genommen ein hervorragendes Beispiel für kreative Zusammenarbeit und „Networking“, für den Einsatz neuer Konzepte und neuer Medien.
Ein wichtiger Schwerpunkt des Projekts ist der Aufbau von Netzwerken zwischen Organisationen, um die gemeinsamen Fähigkeiten bestmöglich einzusetzen. Dafür wurden Schulungen zu organisatorischen Themen wie Dokumentation, Finanzmanagement, Budgetplanung und Berichterstattung durchgeführt. Außerdem fördert Wadi den Aufbau von Netzwerken und die Kommunikation zwischen allen Partnern, damit sie von den Fachkenntnissen der anderen lernen und als Organisationen weiterwachsen können.
Alle Partner haben bereits aktiv in ihrem jeweiligen Bereich gearbeitet. Sie berichteten als Journalist:innen über die Wahlen. Sie arbeiteten mit Schulen und Jugendlichen, um demokratische Prozesse und Partizipation zu fördern. Sie erweiterten die Recycling-Infrastruktur. Sie intensivieren bestehende Kampagnen gegen Gewalt und zur Stärkung von Kinder- und Jugendrechten. Sie engagierten sich für die Umwelt und förderten dafür die Selbstorganisation an Schulen, in Universitäten und Flüchtlingslagern. Im Jahr 2025 werden das Feedback der Teilnehmenden an den Aktivitäten vor Ort ausgewertet und mit den Netzwerkpartnern fortgesetzt. Der Erfolg lässt sich auch durchaus sehen. Beispielsweise meinte ein êzîdischer Teilnehmer eines Citizen-Workshops, es sei das erste Mal seit zehn Jahren – den Massakern des Islamischen Staates –, dass mit Wadi e.V. eine Organisation gekommen sei, um die Menschen über ihre Rechte als Bürger:innen aufzuklären, umso wichtiger sei dies, weil viele Menschen in den Flüchtlingslagern nicht wissen, wie sie ihre Rechte einfordern sollen und können, auch wenn sie ja auch irakische Staatsbürger:innen seien.
Ein zwanzigjähriges Jubiläum: Das Spielbusprogramm in Irakisch-Kurdistan
(Bakhan Jamal, Projektkoordinatorin von ADWI, Suleymaniah)

Gemeinsam Sport treiben © Wadi e.V.
2004 fuhr zum ersten Mal ein Wadi-Spielbus in entlegene Dörfer im Nordirak. Damals war die Idee Spielplätze- und -möglichkeiten an Orte zu bringen, an denen es so etwas nicht gab, noch völlig neuartig. Sie hat sich so bewährt, dass die Busse seit nunmehr zwanzig Jahren fahren und aus einem Bus vier geworden sind. Sie erfüllen dabei auch eine wichtige Rolle für Familien und lokale Gemeinschaften, deren Alltag oft nur wenig Raum für kindliche Bildung und Freizeitgestaltung lässt.
Das Spielbusprojekt wurde damals in der Region Germian unter der Leitung von Wadi ins Leben gerufen. Aufgrund des großen Erfolgs wurde es später auf die Regionen Ranya und Erbil ausgeweitet, wodurch noch mehr bedürftige Kinder erreicht werden konnten. Im Jahr 2019 wurde die Verantwortung für das Projekt an die lokale Organisation „Awareness and Development for Women and Children in Iraq“ (ADWI) übertragen. Diese Übergabe erfolgte im Rahmen einer langfristigen Strategie von Wadi, erfolgreiche Projekte auszugliedern und die Verantwortung an lokale Akteure zu übergeben. Inzwischen betreut Wadi’s Partner Jinda in Dohuk einen vierten Spielbus, der in den Flüchtlingslagern arbeitet, in denen Êzîd:innen leben, die 2014 vor dem Islamischen Staat geflohen sind.
Das Spielbus-Team besteht aus drei geschulten Mitarbeiter:innen, die mit einem Bus unterwegs sind, der mit zahlreichen Spielen und Spielzeugen beladen ist. Jeder Besuch gliedert sich in mehrere Phasen, die so gestaltet sind, dass sie Kinder verschiedener Altersgruppen und Interessen ansprechen, von 2 bis 16 Jahren. Nach der Ankunft in einem Dorf oder Stadtteil beginnt das Team mit energiegeladenen Bewegungsspielen, die den Kindern helfen, aktiv zu werden, Kontakte zu knüpfen und durch gemeinsames Toben sich zu öffnen und Verbindungen zu schaffen. Für viele Kinder ist dies eine seltene Gelegenheit, mit echten Spielsachen zu spielen, und ihre Begeisterung ist deutlich spürbar. Ein Kind sagte kürzlich: „Ich freue mich so darauf, mit einem richtigen Ball zu spielen und nicht mit Steinen oder einem kaputten Ball von meinen älteren Brüdern und Cousins.“
Nach dieser ersten aktiven Spielstunde versammelt das Team die Kinder zu ruhigeren, kreativen Aktivitäten wie Malen, Färben oder Perlenarbeiten. Bei diesen spielerischen Tätigkeiten haben die Kinder die Möglichkeit, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Dies ist auch eine Gelegenheit für die Teammitglieder, mit den Kindern über wichtige Themen zu sprechen. Dabei kann es sich um aktuelle Ereignisse, Missstände vor Ort, Gesundheitsprobleme oder auch umwelt- und sozialpolitische Fragen handeln. Auch erfahren unsere Teams so, ob unter Umständen Kinder Misshandlungen oder Vernachlässigungen zu Hause ausgesetzt sind und können dann, wenn nötig, intervenieren. Die Sozialarbeiterinnen schaffen einen geschützten Raum, um solche relevanten Themen auf altersgerechte Weise anzusprechen und den Kindern zu helfen, die Welt um sie herum zu verstehen und zu verarbeiten. Anschließend wird der Aufenthalt mit einer weiteren sportlichen Aktivität abgeschlossen, um die Kinder gestärkt und frisch in den Tag zu entlassen.
Wir hören hin und wieder schöne Geschichten darüber, wie der Spielbus wirken konnte. Der Vater eines Kindes mit Autismus drückte seine Dankbarkeit so aus: „Ich habe ein autistisches Kind, das normalerweise nicht mit anderen Kindern spielt. Dank des Spielbus-Teams kommt er endlich aus dem Haus und spielt jetzt gerne draußen. Das hilft ihm, mit anderen in Kontakt zu kommen. Wir freuen uns sehr. Das haben wir dem Spielbus zu verdanken. Es wäre toll, wenn Ihr öfter kommen könntet, damit er noch mehr Fortschritte macht.“
Das Spielbus-Team wählt die Spiele und Aktivitäten sorgfältig aus, um den Interessen und Bedürfnissen möglichst aller Kinder gerecht zu werden. Geschlecht, Alter und kulturelle Vorlieben werden dabei berücksichtigt. Dieser integrative Ansatz hat maßgeblich dazu beigetragen, dass das Programm in den Gemeinden so beliebt ist und großes Vertrauen genießt. Auch die Erwachsenen erkennen, dass der Spielbus den Kindern Spiel- und Lernmöglichkeiten bietet, die ihnen sonst möglicherweise nicht zugänglich wären. Dadurch erfährt das Projekt eine überwältigende Akzeptanz – der Schlüssel für jede erfolgreiche soziale Initiative.
Ein elfjähriges Mädchen aus einem Dorf erzählte einmal: „Wir sind Dorfleute. Wir haben noch nie etwas von Spielplätzen oder Vergnügungsparks gehört. Wir wissen nur, wie man sich um Tiere kümmert und die täglichen Aufgaben erledigt. Unsere Familie nimmt uns nirgendwohin mit, wo wir Spaß haben können.“ Kinder wie dieses Mädchen kennen es nicht, dass man sie nach ihren Wünschen oder Bedürfnissen fragt. Beim Spielbus ist das anders, hier wird auf sie eingegangen. Deshalb ist der Spielbus so etwas Besonderes für sie – hier können sie einfach nur Kind sein.
Das Spielbusprojekt bereitet den Kindern nicht nur Freude, sondern trägt auch zur Bildung bei und stärkt ihr Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Durch die Verbindung von Freizeitgestaltung mit kindgerechten Dialogen kann das Projekt niedrigschwellig Themen wie Gesundheit, soziales Wohlbefinden und Umweltbewusstsein ansprechen und bearbeiten. Der Spielbus bietet nicht nur einen Ort zum Spielen, sondern fördert auch eine Generation, die informiert, engagiert und ihrer Community positiv verbunden ist.
Die im Laufe der Zeit durch den Spielbus aufgebauten Kontakte und Netzwerke haben Wadi/ADWI dazu inspiriert, weiter gehende gemeinschaftsorientierte Initiativen zu starten, wie zum Beispiel die Kampagne „Nein zu Gewalt“. Die Mitarbeiterinnen der Spielbusse hörten von den Kindern immer wieder Berichte darüber, wie rüde und gewaltvoll Kinder von Lehrern oder anderen Autoritätspersonen behandelt werden. Zu diesem Programm passen auch die Initiativen gegen Genitalverstümmelung und zur Stärkung der reproduktiven Rechte von Frauen, Motto: „Der patriarchalen Kontrolle entkommen“. So nahm eine Kampagne ihren Anfang, die sich öffentlichkeitswirksam für einen positiven, respektvollen Umgang mit Kindern in Schulen und Familien einsetzt. Ein Kind fragte die Mitarbeiterinnen eines Spielbusses einmal: „Warum seid ihr Sozialarbeiterinnen so nett zu uns? Unsere Lehrer behandeln uns nicht so.“ Solche und ähnliche Reaktionen motivieren die Teams jeden Tag aufs Neue, in abgelegene Dörfer oder benachteiligte Stadtquartiere zu ziehen und dort neben freudigen Erlebnissen auch Mitgefühl, Verständnis und Würde zu fördern und vorzuleben.
Auf ähnliche Weise startete ADWI im Juni 2024 eine Kampagne für Kinderrechte. Diese Initiative entstand aus Gesprächen mit Kindern, die mit ihren Rechten nicht vertraut waren. „Wir hören von unseren Pflichten zu Hause, aber niemand spricht über unsere Rechte“, sagten viele Kinder. Daraufhin nahm ADWI die Aufklärung der Kinder über ihre Rechte in ihr laufendes Active Citizenship Program auf. Kinder in Irakisch-Kurdistan sollen ihre Rechte kennen und über Möglichkeiten, sich im Falle von Übergriffen und Grenzüberschreitungen zu schützen, Bescheid wissen.
Payam Ahmed, ADWI-Teammitglied und Rechtsanwältin aus Erbil, beschreibt die Wirkung des Projekts so: „Es wärmt mir immer wieder das Herz, zu sehen, wie diese Kinder, deren Leben wirklich nicht leicht ist, sich über die Spiele freuen, die wir ihnen bringen. Da spüre ich, wie heilig meine Arbeit ist! Alle Müdigkeit verfliegt, wenn ich sehe, wie die Kinder freudestrahlend auf unseren Spielbus zurennen und alles ausprobieren wollen. Die Dörfer sind oft weit entfernt und wir brauchen ein oder zwei Stunden, um sie zu erreichen, meist über holprige, staubige oder schlammige Straßen. Das erschwert unsere Arbeit. Aber diesen Kindern, die nur selten die Gelegenheit dazu haben, Spiel und Freude zu bringen, ist wichtiger als alle Mühen. Ein weiterer sinnvoller Aspekt unserer Arbeit besteht darin, die Kinder über ihre Rechte aufzuklären, selbst wenn es nur zehn Minuten sind. Als Juristin ist es mir ein besonderes Anliegen, dieses Wissen weiterzugeben, und ich sehe das auch als einen wichtigen Teil meiner Aufgabe an.“
Recyceln von Plastik in Germian – Neue Lösungen für alte Probleme
(Dieser Abschnitt ist ein Auszug aus einem Artikel, der im Oktober 2024 auf kurdisch vom viersprachigen Medienportal Kirkuk Now publiziert wurde. Er dokumentiert die Fortschritte der Umweltkampagne von Wadi und zeigt, dass sie auch in lokalen Medien auf breite Resonanz stößt.)

Recycling Projekt © Wadi e.V.
Das Sammeln und Recyceln von Plastikmüll – ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz – setzt sich in Germian immer mehr durch. Viele Projekte und Initiativen, die auf dieses Ziel hinarbeiten, wurden von kleinen Betrieben mit einfachsten Maschinen begonnen. Sie recyceln Plastik und schaffen damit nicht nur Arbeitsplätze für junge Menschen, sondern fördern auch das Bewusstsein für Umweltschutz in der Bevölkerung und sorgen ganz konkret für eine sauberere Umwelt.
Einer dieser Betriebe befindet sich in Kifri und ist in einem Haus auf nur 120 Quadratmetern untergebracht. Die Maschinen wurden lokal hergestellt; nur wenige Spezialteile wurden importiert. Beim Aufbau halfen verschiedene NGOs. Die Kosten für die Errichtung der Anlage beliefen sich auf 15.000 US-Dollar, die von Wadi und dem BMZ zur Verfügung gestellt wurden. Die Vorbereitungen begannen Ende 2022; mittlerweile ist auch ADWI in das Projekt eingebunden. Wadi hat bereits ähnliche Projekte in Halabja und in einem Lager für Binnenflüchtlinge (IDPs) in der Provinz Dohuk realisiert. Bakhan Jamal, Projektkoordinatorin von ADWI, berichtet, dass einer der Gründe für die Errichtung des Betriebs in Kifri „die mangelhafte Infrastruktur und die Vernachlässigung des Bezirks ist. Kifri ist eines der Gebiete, die zwischen der irakischen Regierung und der Regionalregierung Kurdistans umstritten sind. Die unklaren Zuständigkeiten betreffen auch den Umweltschutz. Wir sehen bereits schwere Umweltschäden.“
„Ich begann, zu Hause Plastik zu sammeln und es in den Betrieb zu bringen“, erzählt Sheni Hashem, die mit drei anderen in dem Betrieb arbeitet: „Wir komprimieren täglich 50 Kilogramm Plastikflaschen für Wasser, Shampoo und Speiseöl und verkaufen eine Tonne davon für 140 Dollar.“ Ein Teil des Plastikmülls wird recycelt und zu Stühlen und Tischen, Müllbehältern und Blumentöpfen verarbeitet. Dafür wird er zuerst auf hohe Temperaturen gebracht, damit er für die menschliche Gesundheit ungefährlich ist. Die Recyclinganlage in Kifri unterscheidet sich von anderen dadurch, dass sie Plastik nicht nur zerkleinert, sondern daraus auch noch Gebrauchsgegenstände herstellt. Sie kann recyclingfähige Kunststoffmaterialien vom Typ PET und HDPI verarbeiten.
In Kifri sammeln Menschen aus allen Bevölkerungsschichten, vor allem aber Schulkinder, den Plastikmüll und bringen ihn zu den Recyclinganlagen. Seit sechs Jahren hat Amina Abdullah, eine 56-jährige Frau aus dem Viertel Shahidan im Bezirk Kalar, keinen Plastikmüll mehr weggeworfen. Wenn sie Plastik verwenden muss, sammelt sie es und ruft alle ein bis zwei Monate einen jungen Mann an, der den Plastikmüll abholt und zu den Zerkleinerungsanlagen bringt: „Ich habe viel über die Gefahren von Plastik gehört. Ich verwende es selten, weil es die Umwelt verschmutzt und meine Gesundheit und die meiner Kinder beeinträchtigt.“ Als Umweltaktivistin sensibilisiert sie für das Thema, angefangen bei ihren Kindern. „Ich habe zwei verheiratete Töchter, denen ich auch gesagt habe, dass sie Plastikmüll sammeln und zur Recyclinganlage bringen lassen sollen.“ Sie glaubt, dass ohne die Recyclinganlagen der ganze Müll einfach in der Umwelt landen würde. „Täglich liefern mir Jugendliche mit ihren dreirädrigen Motorrädern Recyclingmaterial an. Wir haben sie dazu gebracht, altes Plastik einzusammeln, das auf den Straßen liegt. Damit verdienen sie bei uns etwas Geld,“ so Omid Ali. „Heute konkurrieren die jungen Männer darum, wer am meisten Plastikmüll sammelt und zu uns bringt; früher waren die Straßen voller Müll, vor allem in den Geschäftsvierteln.“ Der Recyclingbetrieb stellt große Eisenkörbe zur Verfügung, um den Müll zentral zu sammeln: „Die Menge des täglich gesammelten Plastiks ist gestiegen, und in Schulen und Kindergärten besteht eine große Nachfrage nach den Recyclingprodukten unseres Betriebs“, bestätigt auch Sheni Hashem, die ursprünglich zu Hause arbeitete und nun von all ihren Freunden und Verwandten beim Plastiksammeln unterstützt wird.
Bakhan Jamal berichtet, dass insgesamt 18 Sammelbehälter aufgestellt wurden, um Wasserflaschen in Schulen, vor Sportstudios und an öffentlichen Orten zu sammeln: „Wir haben auch im Nachbarbezirk Kalar 10 Behälter an Schulen und öffentlichen Plätzen aufgestellt.“ „Wenn der Plastikmüll in Kalar nicht verkauft wird, wird er zum Recyclingbetrieb nach Kifri transportiert,“ erklärt Jamal. Eines der Ziele ist dabei, ein Netzwerk von Schulen, Fitnessstudios, öffentlichen Gebäuden, Regierungsbehörden und Restaurants aufzubauen. „Wir wollen diese Einrichtungen miteinander verbinden und den Austausch unter ihnen fördern, um gemeinsam zum Schutz der Umwelt beizutragen. Unser Motto ist Green Germian!“ „Die Erziehung zu mehr Umweltbewusstsein ist einer der wichtigsten Aspekte unseres Projekts. Für uns ist es wichtig, Kindern von klein auf Plastikvermeidung beizubringen und sie über die Gefahren von Plastik und Möglichkeiten des Recyclings zu informieren“, sagt Jamal. Deshalb hat der Recyclingbetrieb in Kifri schon an 30 Schulen Aufklärungskampagnen organisiert; diese Aktivitäten wollen sie auf fast 100 Bildungszentren vom Kindergarten bis zur Mittelschule ausweiten. Bakhan Jamal bestätigt: „Die Bildungsdirektion arbeitet mit uns zusammen und hat uns erlaubt, Plastiksammelboxen in Schulen aufzustellen. Die Gemeinde und das Bildungsministerium sind von der Relevanz des Recyclingbetriebs überzeugt, aber darüber hinaus wurden bis jetzt noch keine weiteren Schritte unternommen.“ Sie glaubt, dass die für das Projekt und das Recycling von Plastikmüll nötige Überzeugungsarbeit noch viel Zeit in Anspruch nehmen wird: „Die Trennung von Müll ist für die Menschen hier noch lange keine Selbstverständlichkeit.“
Wadi unterstützt neben drei Recycling-Centern eine Fülle anderer Umweltprojekte, die im Internet unter „keep-kurdistan-green“ dokumentiert sind.
Die Selbstorganisation von Partnern unterstützen
(Beitrag von Wadi e.V.)

Erste Hilfe Kurs © Wadi e.V.
Wadi unterstützt seit je her die Selbstorganisation von Partnern. Ein ganz besonderes Beispiel ist die Organisation Zinobia, die seit diesem Jahr im Norden Syriens Binnenvertriebene unterstützt. Denn sie entstand als Initiative von einigen Syrerinnen und Syrern, die sich zuvor auf Lesbos in Griechenland bei den „Moria White Helmets“ engagiert hatten, einer der Flüchtlingsselbsthilfsorganisationen, denen Wadi bei der Gründung 2020 mitten im Corona-Chaos beigestanden haben und die seitdem als unsere Partner im Flüchtlingslager wichtige Arbeit leisten. Einige davon sind auch nach ihrer Anerkennung in Griechenland geblieben und haben nun ihre eigene Organisation gegründet – eben Zinobia, benannt nach der berühmten antiken Königin aus Palmyra. Sie organisieren nun Hilfe vor Ort für die nordsyrische Region Idlib, die weiterhin nicht unter Kontrolle des Assad-Regimes steht und in der hunderttausende Binnenvertriebene aus anderen Teilen des Landes unter katastrophalen Bedingungen leben müssen. So ist aus einem Partner, den „Moria White Helmets“, deren wichtige Arbeit Wadi auch weiterhin in Griechenland unterstützen will, ein neuer entstanden, und wir versuchen nach Kräften auch Zinobia dabei zu unterstützen, in den syrischen Camps zu helfen.
Ebenfalls aus der Arbeit in Griechenland kennt Wadi viele Flüchtlinge aus dem Gazastreifen, die sich 2020 in Leros selbst organisierten. Inzwischen leben die meisten in anderen europäischen Ländern. Einige waren in der Vergangenheit schon im Gaza Youth Movement (es gibt allerdings mehrere Gruppierungen, die diesen Namen beanspruchen) aktiv, einer Gruppe, die 2019 die Proteste gegen die Hamas in Gaza organisierte. Nun wollen sie auch in Europa weitermachen. Wie schon damals wünschen sie, gerade angesichts der jüngsten katastrophalen Entwicklung in ihrer ehemaligen Heimat, eine Zukunft ohne Krieg, Unterdrückung und Fanatismus. Es sind dies etwas andere Stimmen aus Gaza, die man viel zu selten vernimmt. Gemeinsam mit einer Gruppe von Israelis haben sie die Initiative „Freedom and Peace“ (inzwischen umbenannt in GazEl4Peace – Together for freedom and trust), ins Leben gerufen, um eine Plattform in Europa zu schaffen, auf der sich Palästinenser:innen und Israelis, die – der Name ist Programm – eine gemeinsame Zukunft in Frieden und Freiheit wünschen, treffen, austauschen und gemeinsame Aktionen und Projekte planen können.
Basma Aldikhi, Mitarbeiterin von Wadi e.V. in Dohuk, Ilis Eligabali, Mitarbeiterin von Wadi Deutschland, Bakhan Jamal, Projektkoordinatorin von ADWI, Suleymaniah, Thomas von der Osten-Sacken, Geschäftsführung von Wad, Frankfurt am Main / Suleymaniah (Anmoderation und Lektorat: Norbert Reichel, Bonn, Auswahl des Eingangszitats Thoms von der Osten-Sacken
(Anmerkungen: Der Beitrag beruht auf Informationen und Beiträgen der Rundbriefe von WADI vom Winter 2024 / 2025 und vom Sommer 2025. Die Beiträge wurden für die Veröffentlichung im Demokratischen Salon im September 2025 bearbeitet, Internetzugriffe zuletzt am 4. September 2025. Das Titelbild zeigt eine Demonstration im Lager Khanke für den Erhalt der dortigen Schule © Wadi e.V.)
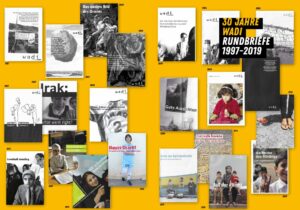
30 Jahre Wadi-Rundbriefe © Wadi e.V.
Weitere Beiträge im Demokratischen Salon zum Thema:
- Neues Syrien, neue Levante? Thomas von der Osten-Sacken über Chancen einer syrischen Demokratie, Februar 2025.
- Priorität Menschenrechte – ein Gespräch mit dem Außen- und Menschenrechtspolitiker Max Lucks, Januar 2025.
- Norbert Reichel, Weil sie Êzîd:innen sind – Der 74. Völkermord – Zehn Jahre nach dem 3. August 2014, August 2024.
- Irakischer Alltag und Europa – ein Gespräch mit Thomas von der Osten-Sacken, Geschäftsführer von Wadi e.V. Juli 2023.
Spenden für Wadi e.V.:
Wadi wird auf unterschiedlichen Wegen finanziell unterstützt, beispielsweise bei den Spielbussen durch das Deutsche Generalkonsulat in Erbil. Die Unterstützung bezieht sich jedoch oft nur auf wenige Monate und auf Anschaffungskosten (Anschubfinanzierung). Eine wichtige Grundlage für die Kontinuität der Arbeit sind Spenden. Wer für Wadi e.V. spenden möchte, kann dies über das Konto über das Konto Postbank Frankfurt, IBAN: DE43 5001 0060 0612 305602, BIC: PBNKDEFF tun.
