Das Bonner Zentrum für Versöhnungsforschung
Ein Gespräch mit dem Gründer und Soziologen Hans-Georg Soeffner
„Ambiguitätstoleranz ist eine Übung in Reflexivität. Was zunächst trivial klingen mag, erweist sich in heutigen, ebenso pluralen wie dissonanten Gesellschaften als enorme Herausforderung. Wie können Gesellschafen die unterschiedlichen Erfahrungswelten und sozialen Gegensätze überbrücken, wie mit konkurrierenden Vorstellungen des gelingenden Lebens so umgehen, dass sie nebeneinander Bestand haben können? Welche Rolle spielt hierbei das Erzählen und vor allem das kollektive Erinnern, sei es an die Gründungsmythen, an die Gewaltgeschichten oder an die diversen glücksversprechen sozialer Ordnungen.“ (Hans-Georg Soeffner, Benno Zabel im Vorwort zu dem gemeinsam mit Esther Gardei herausgegebenen Buch „Vergangenheitskonstruktionen – Erinnerungspolitik im Zeichen von Ambiguitätstoleranz“, Göttingen, Wallstein, 2023)
Ambiguitätstoleranz ist einer der zentralen Begriffe eines Forschungsansatzes, der sich mit der Vielfalt, den Unterschieden und Konflikten unterschiedlicher Ideengebäude befasst. Unterschiedliche Auffassungen von Geschichte, Erinnerung und Aufarbeitung können miteinander konkurrieren. „Versöhnung“ oder „Reconciliation“ werden dabei mitunter zu einem schwierigen und möglicherweise sogar aussichtslosen Unterfangen, nicht zuletzt, wenn politische Interessen im Spiel sind.
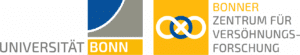 Das im Jahr 2023 gegründete Bonner Zentrum für Versöhnungsforschung hat sich das Ziel gesetzt, unterschiedliche Auffassungen und deren Hintergründe zu erforschen. Es sorgt dafür, dass das Thema mit all seinen Facetten in Wissenschaft und Forschung, in den Studienangeboten verschiedener Fakultäten sowie in der Bonner Stadtgesellschaft präsent ist. Im Frühjahr 2025 präsentierten die beteiligten Wissenschaftler:innen und Studierenden gemeinsam mit dem Schauspiel Bonn in mehreren Veranstaltungen ihre Ideen. Eine Veranstaltung befasste sich mit der Frage der Motivation und der Tragweite des Engagements von Frauen für den Frieden im ausgehenden 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Sie wurde von Victoria Fischer und Christine G. Krüger mit dem bewusst mit Fragezeichen versehenen Beitrag „Versöhnerinnen?“ im Demokratischen Salon dokumentiert. Die Reihe endete Anfang Mai 2025 mit einer Debatte zwischen Natan Sznaider und Hans-Georg Soeffner in der Bonner Werkstattbühne, moderiert von der Geschäftsführerin des Zentrums Esther Gardei.
Das im Jahr 2023 gegründete Bonner Zentrum für Versöhnungsforschung hat sich das Ziel gesetzt, unterschiedliche Auffassungen und deren Hintergründe zu erforschen. Es sorgt dafür, dass das Thema mit all seinen Facetten in Wissenschaft und Forschung, in den Studienangeboten verschiedener Fakultäten sowie in der Bonner Stadtgesellschaft präsent ist. Im Frühjahr 2025 präsentierten die beteiligten Wissenschaftler:innen und Studierenden gemeinsam mit dem Schauspiel Bonn in mehreren Veranstaltungen ihre Ideen. Eine Veranstaltung befasste sich mit der Frage der Motivation und der Tragweite des Engagements von Frauen für den Frieden im ausgehenden 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Sie wurde von Victoria Fischer und Christine G. Krüger mit dem bewusst mit Fragezeichen versehenen Beitrag „Versöhnerinnen?“ im Demokratischen Salon dokumentiert. Die Reihe endete Anfang Mai 2025 mit einer Debatte zwischen Natan Sznaider und Hans-Georg Soeffner in der Bonner Werkstattbühne, moderiert von der Geschäftsführerin des Zentrums Esther Gardei.
Die institutionellen Grundlagen

Hans-Georg Soeffner, Foto: Barbara Frommann, Uni Bonn.
Norbert Reichel: Was verbirgt sich hinter dem anspruchsvollen Namen eines Zentrums für Versöhnungsforschung?
Hans-Georg Soeffner: Das Zentrum für Versöhnungsforschung an der Universität Bonn wird seit seiner Einrichtung im Jahr 2023 von vier Fakultäten getragen, von der katholisch-theologischen, der evangelisch-theologischen und der philosophischen Fakultät sowie von den Rechts- und Staatswissenschaften. Wir haben es uns in Bonn einerseits relativ schwer gemacht, weil die Fakultäten jeweils unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Auf der anderen Seite machen wir es uns auch leicht, weil wir durch die Kooperation der Fakultäten unterschiedliche Perspektiven gewinnen und neue Problemfelder identifizieren können.
Zunächst wurde für einen Zeitraum von fünf Jahren geplant. Wir haben jetzt die Stelle einer Juniorprofessorin besetzen können, die mir als Sprecherin des Zentrums nachgefolgt ist: Frau Rosario Figari Layus, eine gebürtige Argentinierin. Das Zentrum hat nun einen Vorstand, dem ich nach wie vor angehöre. Mitglied ist unter anderen auch der Dekan der Philosophischen Fakultät.
Norbert Reichel: Wie wurde das Zentrum in den ersten beiden Jahren finanziert?
Hans-Georg Soeffner: Durch die Universität. Die Gründungsidee hatte bereits der frühere Rektor, der Literaturwissenschaftler Jürgen Fohrmann. Sein Nachfolger im Rektorat, Michael Hoch, ein Naturwissenschaftler, hat die Juniorprofessur aus dem Etat der Universität gestiftet. Die Professur wurde zwar zunächst als Juniorprofessur angelegt, aber Verstetigung und Höherstufung sind Teil der Universitätspolitik.
Norbert Reichel: Das kann man angesichts der Kürzungsabsichten von Seiten des Düsseldorfer Wissenschaftsministeriums nicht hoch genug bewerten.
Hans-Georg Soeffner: Die Bonner Universität ist in einer besonderen Situation, weil sie über sechs Exzellenzcluster verfügt. Wir haben Gelder, die wir unabhängig von der Wissenschaftspolitik in Düsseldorf nutzen können. Wir haben das Glück, dass Gelder aus dem einzigen geisteswissenschaftlichen Bonner Exzellenzcluster, „Beyond Slavery“, immer wieder einmal auch dem Zentrum zugutekommen können.
Norbert Reichel: Ein wichtiger Schritt ist ein Antrag an die Deutsche Forschungsgemeinschaft, über den – so hoffen wir – bald positiv entschieden wird.
Hans-Georg Soeffner: Es geht um ein Graduiertenkolleg. Sprecherin ist die Historikerin Christine G. Krüger. Die erste Runde der Vorauswahl haben wir überstanden. Ich habe nach verschiedenen Gesprächen den Eindruck, dass wir gute Chancen haben, weiter zu kommen, weil es bisher kein vergleichbares Projekt zu unserem komparativen Ansatz gibt, in dem nach Versöhnung und ihren Äquivalenten, in sehr unterschiedlichen Weltregionen, Religionen und Ideologien gefragt wird. Wir sind zuversichtlich, dass wir ab dem Jahr 2026 in Bonn Doktorandinnen und Doktoranden aus den unterschiedlichen Fakultäten und aus den verschiedenen Ländern, die ihrerseits Gegenstand der Untersuchung sind, im Austausch mit den dortigen Universitäten begleiten werden. Die Doktorandinnen und Doktoranden werden sich auch selbst – wie es verlangt wird – organisieren, sodass nicht nur geforscht wird, sondern auch innerhalb des Forschungszusammenhangs beobachtet werden kann, welche Auseinandersetzungen im Kolleg in welcher Form und mit welchen Argumenten stattfinden.
Multiperspektivität

Weitere Informationen des Verlags Vandenhoeck & Ruprecht über das Buch erhalten Sie mit einem Klick auf das Bild.
Norbert Reichel: „Versöhnung“ ist ein schwieriger Begriff oder vielleicht ließe sich auch sagen ein sehr hoher Anspruch. Der Begriff hat im Deutschen meines Wissens seine etymologische Herkunft aus der „Sühne“, die durch das Präfix „ver-“ abgegolten werden soll. Gleichzeitig wird mit der Endung „-ung“ deutlich, dass es sich um einen Prozess handelt, von dem vielleicht niemand weiß, ob er jemals abgeschlossen werden kann. Ich nenne zum Einstieg nur zwei der damit aus meiner Sicht entstehenden Fragen, über die wir uns austauschen könnten: Wer versöhnt sich wo und aus welchem Anlass mit wem? Wie nachhaltig ist ein Versöhnungsprozess?
Hans-Georg Soeffner: Zunächst ist der Begriff der Versöhnung ein christlicher Begriff, dessen spezifische Bedeutung von anderen Religionen nicht geteilt wird. Die Verbindung mit dem Ausdruck „Sühne“ ist eine deutsche Besonderheit, die es ebenfalls in anderen Sprachen, man vergleiche etwa den englischen Begriff „reconciliation, so nicht gibt.
Norbert Reichel: Mit „reconciliation“ wären wir eher bei Friedensschlüssen vorausgehenden Prozessen des Sich-Miteinander-Beratens, des Aushandelns und Verhandelns.
Hans-Georg Soeffner: Mit der Begrifflichkeit ergeben sich eine Reihe weiterer Probleme. In Bonn haben wir versucht, das Problem mit dem christlichen Versöhnungsbegriff unter anderem durch das geplante Graduiertenkolleg zu lösen. Hier geht es darum herauszufinden, welche Äquivalente sich in anderen Kulturen – so etwa im Buddhismus, im Islam oder im Shintō – zum Begriff der „Versöhnung“ finden.
Wenn Sie versuchen, einem Nicht-Christen aus einem anderen Kulturkreis den Inhalt des christlichen Versöhnungsbegriffs zu erklären, geraten Sie in enorme Schwierigkeiten. So etwa, wenn Sie erläutern, im Christentum entstehe die Versöhnung dadurch, dass Gottes Sohn, der selbst Gott und als solcher gleichzeitig Vater und Sohn sei, für diesen Gott sterbe, um die Menschheit mit Gott zu versöhnen, erzeugen Sie – nicht nur bei Nicht-Christen – zwangsläufig Verwirrung.
Das Graduiertenkolleg verfolgt daneben das Ziel herauszufinden, was Versöhnung von Friedensschlüssen unterscheidet. Friedensschlüsse beruhen meist auf Verträgen. Versöhnung ist in der Regel jedoch vertragsfrei. Stattdessen ist der Akt der Versöhnung meist hoch ritualisiert und gilt als Wert an sich. Worin besteht also gegenüber einem Friedensvertrag der Mehrwert? Wie steht es mit der ‚Haltbarkeit‘ von Versöhnung? Anders als in der Versöhnung sind in einem Friedensvertrag oft Elemente enthalten, die weitere oder neue Konflikte erwarten lassen. Zudem ist eine Versöhnung zwischen zwei Personen etwas völlig anderes als die Versöhnung zwischen Kollektiven, falls es so etwas überhaupt gibt. Eine entscheidende Frage lautet daher, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit es zu einer Versöhnung zwischen Gruppen, Staaten, Nationen oder gar Religionen kommen könnte.
Wir versuchen, die unterschiedlichen Perspektiven inhaltlich und organisatorisch zu nutzen. Dies beginnt schon im Vorstand des Zentrums: Frau Rosario Figari Layus ist Politologin, der Dekan ist Islamwissenschaftler, Frau Krüger ist Historikerin, ich bin Soziologe. Mit den theologischen Kollegen thematisieren wir ebenso unterschiedliche Perspektiven wie mit den Rechts- und Staatswissenschaftlern. Dort gibt es zum Beispiel ein Projekt zur Restitution: zur Rückgabe von Raubkunst. Das Zentrum koordiniert eine Vielzahl unterschiedlicher Projekte.
Norbert Reichel: Wie sieht es mit den Geschichtswissenschaften aus?
Hans-Georg Soeffner: Die Bonner Historiker sind eng mit dem Zentrum verbunden. Darüber hinaus besteht eine Kooperation mit dem Kollegen Constantin. Goschler von der Ruhruniversität Bochum. Hier geht es zum Beispiel um die die deutsch-französische Aussöhnung. Der Bonner Kollege Michael Rohrschneider befasst sich mit dem Westfälischen Frieden. Peter Geiss betreut ein Schulbuchprojekt, in dem deutsche, französische und polnische Perspektiven für eine komparative Geschichtsschreibung genutzt werden.
Norbert Reichel: Eine Kooperation mit dem Georg-Eckert-Institut in Braunschweig? Da gibt es ja auch durchaus leidvolle Erfahrungen.
Hans-Georg Soeffner: Ja, da gibt es eine Zusammenarbeit. Zudem zeigt es sich, dass sich der Prozess der Erstellung eines deutsch-polnischen Schulbuches wegen der innenpolitischen Entwicklung in Polen erheblich schwieriger gestaltet als das deutsch-französische Unternehmen.
Norbert Reichel: Damit wären wir bei dem Streit um das Museum des Zweiten Weltkriegs in Danzig. Der ehemalige Direktor Paweł Machcewicz hat diesen Streit in seinem Buch „Der umkämpfte Krieg“ ausführlich beschrieben (deutsche Ausgabe 2018 in Wiesbaden bei Harassowitz, die Übersetzung aus dem Polnischen besorgte der Direktor des Deutschen Polen-Instituts Peter-Oliver Loew). Der von der PiS-Regierung eingesetzte Nachfolger Karol Nawrocki wurde jetzt zum polnischen Staatspräsidenten gewählt. Von „Versöhnung“ ist da nicht viel zu spüren. Man sollte aber auch das zögerliche Verhalten der deutschen Bundesregierung im Hinblick auf die Anerkennung des von Deutschen über Polen gebrachten Leids oder die schleppende Einrichtung des Deutsch-Polnischen Hauses und anderer deutsch-polnischen Aktivitäten nicht vergessen.
Wie thematisieren Sie im Zentrum für Versöhnungsforschung solche Auseinandersetzungen um Erinnerung, um Pflege der Geschichte, um politische Relevanz von Geschichte, letztlich um Geschichtspolitik?
Hans-Georg Soeffner: Wir versuchen dies mit Publikationen. Neben dem von Ihnen eingangs erwähnten Sammelband wäre zu nennen: Esther Gardei, Michael Schulz, Hans-Georg Soeffner, Hg., „Versöhnung – Theorie und Empirie“ (Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2023). Gegenstand sind immer die konkurrierenden Erinnerungskulturen und -politiken. Es ist wichtig, hier den Plural zu benutzen. Wie geht man mit den unterschiedlichen Narrativen um? Diese repräsentieren oft hochgradig emotional besetzte Geschichten, und es ist ausgesprochen schwierig, mit dieser Emotionalisierung umzugehen Die Darstellung historischer Perspektiven hat grundsätzlich das Problem, dass letztere nicht einfach in Form einer sogenannten emotionsfreien Objektivität abgehandelt werden kann. Ich wüsste nicht, wie man dieses Problem anders als komparativ lösen könnte. In der Geschichtsschreibung, auch bei Schulbüchern, kommt es vor allem darauf an, die Vielfalt der Perspektiven so wiederzugeben, dass man vergleichen kann. Multiperspektivität ist das Gebot.
In Polen zum Beispiel zeigt sich deutlich, wie innerhalb eines Landes unterschiedliche Erinnerungspolitiken miteinander im Streit liegen. Dies ist in den meisten Ländern der Fall. Es gibt eben nicht die eine große Nationalerzählung, in Deutschland eh nicht. Wir haben durch unsere unheilvolle Geschichte nachträglich den Vorteil, dass wir durch die uns aufgezwungene Aufarbeitung dieser Geschichte in einer etwas besseren Situation sind als andere Nationen, die nicht dazu gezwungen wurden und immer noch ihre eigenen – mehr oder weniger einseitigen – Erinnerungspolitiken pflegen. In der jüngeren deutschen Geschichte konkurrieren die Erinnerungspolitiken der ehemaligen DDR und der BRD. Meine Kollegin Christine G. Krüger kämpft in ihrem Arbeitsbereich unter anderem mit diesen unterschiedlichen Erzählungen, die man als Historikerin darstellen und koordinieren muss. Das ist kein leichtes Unterfangen.
Ambiguitätstoleranz
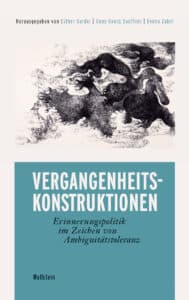
Weitere Informationen des Wallstein Verlags über das Buch erhalten Sie mit einem Klick auf das Bild.
Norbert Reichel: Zum Begriff der Multiperspektivität gehört meines Erachtens als Komplementärbegriff die Ambiguitätstoleranz. Ich darf vielleicht sagen, dass ich den von Ihnen gemeinsam mit Esther Gardei und Benno Zabel herausgegebenen Band „Vergangenheitskonstruktionen – Erinnerungspolitik im Zeichen von Ambiguitätstoleranz“ (Göttingen, Wallstein, 2023) mit all seinen Beiträgen für das Beste halte, das ich zu diesem Thema in den letzten zehn bis zwölf Jahren gelesen habe. Vielleicht darf ich es sogar in einem Atemzug mit dem Grundlagenwerk von Thomas Bauer nennen: „Die Kultur der Ambiguität – Eine andere Geschichte des Islams“ (Berlin, Suhrkamp / Insel, 2011). Sie zitieren ihn mit Recht im ersten Satz Ihres Vorworts.
Thomas Bauer benennt ein interessantes und meines Erachtens viel zu wenig beachtetes Faktum: Die Radikalisierung des Islam, die wir heute kennen, stammt eben nicht aus der Anfangszeit oder gar aus einem Mittelalter, dass es so wie wir es in Europa kennen für den Islam auch gar nicht gab, sondern aus dem 19. Jahrhundert, dem Jahrhundert, in dem in Europa der Nationalbegriff populär wurde. Das 19. Jahrhundert war in unterschiedlichen Konstellationen ein Jahrhundert, in dem sich viele Menschen in vielen Ländern offensichtlich für andere ausschließende Eindeutigkeiten begeisterte und diejenigen, die sich dem nicht anschlossen, pauschal verurteilten. In den Medien spielt meines Erachtens heute Ambiguitätstoleranz jedoch leider kaum eine Rolle. Stattdessen dominieren auch dort scheinbare Eindeutigkeiten.
Hans-Georg Soeffner: In den pluralistischen, modernen Gesellschaften bleibt uns aus soziologischer Sicht gar nichts anderes übrig als Ambiguitätstoleranz zum didaktischen Ziel der Erziehung in Schulen und Hochschulen zu machen. In der deutschen Gegenwartsgesellschaft, die sich aus unterschiedlichen Milieus, Religionen, Ethnie und, Zuwanderungen zusammensetzt, gibt es – allen politischen Schimären zum Trotz – keine sogenannte „Leitkultur“ und dementsprechend auch kein großes nationales Erziehungsziel. Pluralistische Gesellschaften widersetzen sich solchen Vereinheitlichungen strukturell. Deshalb müssen wir den Umgang mit Multiperspektivität trainieren und Ambiguitätstoleranz zu einem Lernziel machen. Wir müssen lernen und lehren, mit Mehrdeutigkeiten, Widersprüchen, unterschiedlichen Interessen umzugehen.
Norbert Reichel: Das ist in anderen Worten auch der Kern des Beutelsbacher Konsenses, den die KMK im Jahr 2018 in ihrem überarbeiteten Beschluss zur Demokratiebildung bestätigt und konkretisiert hat. Mit „Neutralität“, wie sie oft von Vertretern diverser Eindeutigkeiten gefordert wird, hat das nichts zu tun. Die unverhandelbare Richtschnur bleiben die Grund- und Menschenrechte. Aber wie setzt man die Forderung nach Multiperspektivität und Ambiguitätstoleranz im Studium um?
Hans-Georg Soeffner: Das ist vor allem ein Problem für die Philosophische Fakultät. Die Theologischen Fakultäten haben ihre jeweils eigenen Dogmatiken, die sie komparativ darstellen können und müssen. Die Rechts- und Staatswissenschaften bilden ihre unterschiedlichen Rechtssysteme ab. Die Philosophische Fakultät ist strukturell heterogen.
In den Literaturwissenschaften wird dies exemplarisch deutlich, wenn Sie zum Beispiel „wertfrei“ – wie es Max Weber gefordert hat – Nationalliteraturen oder literarische Epochen miteinander vergleichen wollen. Damit muss die Philosophische Fakultät leben. Zudem haben wir hier Studierende aus völlig verschiedenen Kulturen, mit unterschiedlichen Bildungsgeschichten und Wertmaßstäben. Wenn diese in einem Seminar aufeinandertreffen, erleben wir – auch hier zitiere ich Max Weber – einen „Polytheismus der Werte“. Es wird dementsprechend zur Aufgabe der Seminarleitung, diesen „Polytheismus“ zu konstatieren und gemeinsam zu erarbeiten, welche unterschiedlichen Wertsysteme aufeinandertreffen. Diese Vielfalt gilt es didaktisch zu nutzen.
Fundamentalisierungen
Norbert Reichel: Der „Polytheismus der Werte“ ist die eine Seite, die Gegenseite die Neigung zur Fundamentalisierung.
Hans-Georg Soeffner: Das ist ein grundlegendes Thema, gerade im Hinblick auf den Begriff der „Nation“: Was bedeutet Nationalismus? Woher kommt er? Spielt er in pluralistischen Gesellschaften tatsächlich eine bedeutsame Rolle und wenn ja, welche? Sie haben auf das 19. Jahrhundert hingewiesen und auf die Fundamentalisierung des Islams. Diese Radikalisierung ist dadurch entstanden, dass im 19. Jahrhundert Religion und Nation eine enge Verbindung miteinander eingegangen sind, die vorher so nicht bestanden hatte. So haben sich die Fundamentalismen wechselseitig gestützt und verstärkt.
Norbert Reichel: Religion und Nation erhielten im 19. Jahrhundert einen universalistischen Anspruch, den keine Neuauflage eines Augsburger Religionsfriedens mehr auflösen konnte. Haben wir Europäer im 19. Jahrhundert und auch noch im beginnenden 20. Jahrhundert den Nationalbegriff und damit den Aufstieg der Fundamentalismen möglicherweise exportiert? Wäre das vielleicht der Kern der europäischen Kolonialherrschaften?
Hans-Georg Soeffner: Ich denke schon. In der Zeit der Kolonisierung, ob in Lateinamerika, in Afrika oder wo auch immer, sind die kolonisierenden Nationen mit ihren jeweiligen Interessen aufeinandergestoßen. Dabei haben sie den Nationalismus und das Denken in nationalen Kategorien in ihre Kolonien exportiert.
Norbert Reichel: Ähnlich ist es sicherlich mit dem Antisemitismus, der für manche offenbar ein wesentliches Element ihrer eigenen Identität ist. Manche sagen heute, der Antisemitismus wäre etwa seit 2015 über Zugewanderte importiert worden. Ich antworte dann, es handele sich um einen Re-Import.
Hans-Georg Soeffner (lacht): Das ist, mit Fontanes ‚altem Briest‘ zu sprechen, ein weites Feld. In unserem Zentrum gab es von Anfang an eine enge Kooperation mit israelischen Kollegen, so mit Natan Sznaider, Moshe Zimmermann, Fania Oz-Salzberger und Gili Drori. Bei den genannten Kolleginnen und Kollegen handelt es sich um dezidiert liberale Israelis, die über Jahrzehnte versucht haben, im innerisraelischen Streit mit der arabischen Bevölkerung Israels und auch mit den Palästinensern zu vermitteln Heute werden selbst sie manchmal in Israel – und nicht nur dort – als Antisemiten beschimpft. .
Die Rede vom importierten Antisemitismus in Deutschland ist ein wohlfeiles Ablenkungsmanöver, mit dessen Hilfe man versucht, eigene antisemitische Vorurteile auf zugewanderte Menschen umzulenken…
Norbert Reichel: … und sich selbst für antisemitismusfrei zu erklären.
Hans-Georg Soeffner: Nach den Umfragen von Wilhelm Heitmeyer und anderen existiert in Deutschland seit Jahrzehnten ein fester Bodensatz von antisemitischen Einstellungen. Der Prozentsatz schwankt zwischen 12 und 18, manchmal auch 20 Prozent.
Norbert Reichel: Zu ähnlichen Ergebnissen kommen die Leipziger Autoritarismusstudien. Denen entnahm ich den Hinweis, dass es zwei Brückenideologien gibt, über die Rechtsextremisten ihre Anhänger finden, den Antisemitismus und den Antifeminismus. In dem Projekt „Betriebliche Demokratiekompetenz“ des DGB, gefördert vom Bundesarbeitsministerium, stellte der Leiter, Sandro Witt, fest, dass sich mit der Zeit eine ganze Menge antidemokratischer Einstellungen auflösen lassen, nicht aber der Antifeminismus, durchweg in den östlichen Bundesländern, in Brandenburg, Sachsen, Thüringen. Antisemitismus war kein eigenes Thema, aber aus den Leipziger und Bielefelder Studien lässt sich dies durchaus ablesen.
Hans-Georg Soeffner: Sie nennen östliche Bundesländer. Der dortige Antifeminismus resultiert zum Teil aus Strukturen der Arbeitswelt in der ehemaligen DDR. Dort wurde zwar Gleichberechtigung propagiert und manchmal auch praktiziert. Eine Debatte über den Feminismus gab es aber kaum. Erst mit der Wende wurde die westdeutsche Feminismus-Debatte in den Osten exportiert. Da stießen Ideologien und Mentalitätsformationen aufeinander, die sich in den beiden Staaten unabhängig voneinander entwickelt hatten.
Norbert Reichel: Es war allerdings auch eine Art Schein-Gleichberechtigung in der DDR. Spielt
Hans-Georg Soeffner: Ja! Man muss sich nur den Frauenanteil in Politbüro und Volkskammer anschauen.
Norbert Reichel: Spielt die Aufarbeitung der DDR eine Rolle im Zentrum für Versöhnungsforschung?
Hans-Georg Soeffner: Wir haben dieses Thema bisher noch nicht systematisch bearbeitet, werden es aber sicher aufgreifen, vor allem im Hinblick auf die Analyse der historischen Herausbildung der unterschiedlichen Mentalitätsformationen und Selbst- beziehungsweise Fremddeutungsmuster, die in den beiden deutschen Staaten entwickelt wurden und bis heute ihre Spuren hinterlassen.
Gegen gelebte Intoleranz
Norbert Reichel: Religion ist – wie Sie bereits sagten – ein zentraler Aspekt des Themas „Versöhnung“. Und Religionen triggern geradezu die Fundamentalisierungen, die wir eben ansprachen. Gibt es Ansätze, über dieses Thema den interreligiösen Dialog zu fördern? Mich interessiert beispielsweise Ihr Kontakt zum Judentum. Die israelischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Sie schon nannten, sind durchweg liberale Jüdinnen und Juden.
Hans-Georg Soeffner: Sie sind dezidiert liberale Jüdinnen und Juden. Daneben kooperieren wir in Deutschland mit dem Berliner Oberrabbiner Andreas Nachama, der sich in Berlin maßgeblich an dem Projekt des „House of One“ beteiligt, einem Ort, der eine Kirche, eine Moschee und eine Synagoge beherbergt. An diesem Projekt sind die beiden christlichen Bekenntnisse, das Judentum und der Islam beteiligt. Ein weiterer wichtiger Kontakt besteht zu Mouhanad Korchide, einem Kollegen an der Universität Münster. Mit ihm, den jüdischen und christlichen Kollegen organisieren wir gemeinsame Tagungen, bei denen wir die unterschiedlichen Debatten zusammenführen.
Das Judentum konzentriert sich nicht auf einen Versöhnungsgedanken, der sich auf die gesamte Menschheit bezieht, wie dies im Christentum der Fall ist, für das die Versöhnung aller Menschen mit Gott zentral ist, auch wenn dieser Gedanke für die innerjüdische Diskussion dennoch wichtig bleibt. Im Islam wiederum gibt es ein Versöhnungsgebot, das von Allah ausgeht und die muslimischen Gläubigen verpflichtet, sich miteinander zu versöhnen.
Der Religionsvergleich stellt für die Diskussionen im Zentrum eine besondere Herausforderung dar, der wir uns gern stellen, vor allem, wenn es um den Vergleich unterschiedlicher Dogmatiken sowie um die Entstehungsbedingungen und Folgen von Fundamentalismen geht. Für das Christentum etwa stellt sich – auch aus der Sicht anderer Religionen – die Frage, warum ein zentrales Element der christlichen Botschaft: die Beziehung des einzelnen Menschen zu Gott, die „Reichsunmittelbarkeit“ (Luther) des Individuums gegenüber Gott, so stark überlagert wird von Hierarchien, institutionellen Interessen, Regelsystemen und dogmatischen Spitzfindigkeiten der Kirchen und Kongregationen.
Norbert Reichel: In diese komplexe Frage passt vielleicht der Streit von JD Vance und Marco Rubio, beide Katholiken, kurz nach dessen Wahl mit Papst Leo XIV. Vance und Rubio vertraten die These, dass das Gebot der „Nächstenliebe“ (Moses III, 19,18) nur für die Menschen im unmittelbaren Umfeld gelte, nicht jedoch für diejenigen, die weiter entfernt wären. Papst Leo XIV. widersprach. Die Ansichten von Vance und Rubio haben ihren Grund in extrem konservativen katholischen wie evangelikalen Milieus, die schon seit längerer Zeit an Anhängerinnen und Anhängern gewinnen. „Versöhnung“ ist dann eigentlich nicht mehr möglich.
Hans-Georg Soeffner: Das ist richtig. Das betrifft den neuen Fundamentalismus des Katholizismus in den USA und seit langem schon die evangelikalen Gemeinden und Sekten. Beides resultiert aus der Geschichte der USA. Es waren oft religiöse Minderheiten, von denen die europäische Zuwanderung in die Vereinigten Staaten geprägt wurde. Diese Minderheiten pflegten eine starke Gemeinschafts- und Gemeindebildung. Das Verhältnis der Gemeinschaften zueinander wurde eher durch Abgrenzung und Ablehnung voneinander als durch wechselseitige Anerkennung oder gar Versöhnung bestimmt. In Donald Trumps Innenpolitik ist dieses Muster noch gut erkennbar.
Norbert Reichel: Dazu kommt eine starke Missionierung. In Lateinamerika, in Afrika gewinnen evangelikale Gruppierungen immer mehr Zuspruch.
Hans-Georg Soeffner: Peter L. Berger hat dieses Wachstum evangelikaler Gruppen in Afrika und in Lateinamerika schon vor 40 Jahren beobachtet. Die evangelikale Missionierung hat nichts zu schaffen mit Perspektivenvielfalt und Ambiguitätstoleranz. Erweckungsprediger wie beispielsweise ein William (Billy) Graham, der, wie auch andere, mit einem evangelikalen Programm durch die gesamte Welt zog, verfolgte ein inklusives Programm für alle, die sich der Gemeinschaft anschlossen, und Exklusion für alle, die sich nicht dieser Gemeinschaft anschließen wollten. Das ist gelebte Intoleranz.
Forschung, Politik und Stadtgesellschaft
Norbert Reichel: Meines Erachtens wäre all das, was Sie vertreten, wichtig für Politikerinnen und Politiker. Sind Sie auch in der Politikberatung tätig?
Hans-Georg Soeffner: Nein. Wir betreiben „Versöhnungsforschung“. Wir wollen nicht in Beratungszusammenhänge gezogen werden, weil wir dann die Interessen unserer ‚Kunden‘ berücksichtigen müssten. Damit verlören wir unsere analytische Perspektive. Uns geht es darum zu erforschen, wie sich Multiperspektivität und der „Polytheismus der Werte“ hier in Deutschland darstellen.
Norbert Reichel: Kann man Forschung und Politik wirklich so voneinander trennen?
Hans-Georg Soeffner: Wenn ich nach unserer Forschung und deren Ergebnissen gefragt werde, informiere ich selbstverständlich über unser Programm und unsere Arbeit. Aber ich möchte nicht selbst unter die Prediger geraten. Ich verstehe mich weder als Therapeut unserer Gesellschaft noch als politischer Berater.
Norbert Reichel: Ich würde mir schon wünschen, dass viele Menschen, auch Politikerinnen und Politiker, wahrnehmen, was Sie im Zentrum für Versöhnungsforschung herausfinden. In Ihrer Kooperation mit dem Schauspiel Bonn sorgen Sie für die Verbreitung Ihrer Forschung an ein Publikum, das sich nicht in den Seminaren der Universität findet. Das ist aus meiner Sicht eine Form von Popularisierung im besten Sinne.
Hans-Georg Soeffner: Das ist richtig. In der Kooperation mit dem Schauspiel Bonn stellen unsere Forscherinnen und Forscher ihre Arbeit in der Diskussion mit Bürgerinnen und Bürgern im Schauspielhaus vor. Jens Groß, der Schauspieldirektor, und die Dramaturgin Sarah Lena Tzscheppan, fördern unsere Arbeit sehr stark. Auch Studierende haben in Arbeitsgruppen ihre Projekte vorgestellt. So informieren wir ein nicht-wissenschaftliches Publikum über angenehme und weniger angenehme Aspekte unserer Gesellschaft.
Wir nennen unsere Arbeit ganz bewusst „Versöhnungsforschung“. Zugleich liegt uns aber auch daran, unsere Forschungsergebnisse so vorzustellen, dass sie, in die richtigen Hände geraten. Bei den Schulen als Nutznießern unserer Schulbuchprojekte ist dies der Fall. Und wenn es um die öffentliche Wahrnehmung unsere Arbeit geht, ist das Schauspiel Bonn als örtlicher Vertreter der Bretter, die die Welt bedeuten, der ideale Partner.
(Anmerkungen: Erstveröffentlichung im Juli 2025, Internetzugriffe zuletzt am 24. Juli 2025, Titelbild: Hans Peter Schaefer.)
