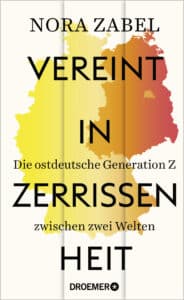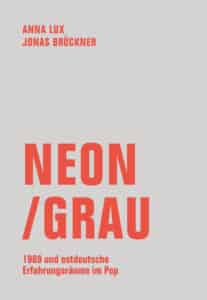Das Einheitspuzzle
Drei Bücher zum 35. Jahrestag des 3. Oktober 1990
„Der 4. November 1989 ist ein besonderer Tag. Maura hat sturmfrei. Die Geschichtsbücher freilich werden später berichten, dass sich an diesem Tag auf dem Alexanderplatz in Berlin auf Initiative einiger Theater hin eine Million Menschen versammelten: die erste offiziell genehmigte Demonstration des Landes, das es nur noch wenige Wochen geben wird. Gundi, der sich zwischen seinen Schichten auf dem Bagger nun öfter in Berliner Künstlerkrisen bewegt, hatte im Laden dafür mobilisiert. Ein paar sind seinem Aufruf gefolgt und haben früh die Sorbenschleuder in die Hauptstadt bestiegen. Wir anderen halten in Hoy die Stellung und sehen uns das erst mal aus der Ferne an. Und außerdem hat Maura sturmfrei.“ (Grit Lemke, Kinder von Hoy – Freiheit, Glück und Terror, Berlin, Suhrkamp, 2021)
35 Jahre Deutsche Einheit, 36 Jahre Friedliche Revolution. Eine Vorgeschichte mit sich überschlagenden Ereignissen vor und nach dem 40. Jahrestag der DDR am 7. Oktober 1989: 2. Juni Abbau der Grenzanlagen durch Ungarn, 27. Juni Durchschneiden des Grenzzauns zwischen Österreich und Ungarn, 19. August Paneuropäisches Picknick in Sopron – 700 Menschen aus der DDR erreichen den Westen, 9. November 1989 Öffnung der Grenze, „unverzüglich“. Das sind nur einige der Daten, an die wir uns erinnern könnten. Zu nennen wären auch der 4. Juni 1989, der Tag, an dem in Polen zum ersten Mal ein nicht kommunistischer Ministerpräsident gewählt wurde und an dem in Beijing friedliche Demonstrierende von der Staatsmacht niedergeschossen wurden, der 30. September, als der bundesdeutsche Außenminister vom Balkon der Deutschen Botschaft in Prag 13 Worte der Befreiung sprach, der 9. Oktober, als die DDR-Staatsmacht in Leipzig nicht schießen ließ, der 4. November, an dem die erste genehmigte Demonstration gegen die SED-Diktatur auf dem Berliner Alexanderplatz stattfand.
Der 3. Juni 1990, der Tag der „Vollendung der deutschen Einheit“ war das Ergebnis, aber kein Endpunkt. Er war nicht das „Ende der Geschichte“, das so manche vermuteten, er war auch der Anfang einer Erfolgsgeschichte, die zugleich – je nach Perspektive – eine Misserfolgsgeschichte wurde. Denn wie sieht es in unserem von Ines Geipel beschriebenen „Fabelland“ (Untertitel: „Der Osten, der Westen, der Zorn und das Glück“, Frankfurt am Main, 2024) wirklich aus? Durch welchen Kaninchenbau sind wir geschlüpft, hinter welchen Spiegeln finden wir uns wieder? Was fabulieren wir über das verschwundene Land und seine vergangenen Zeiten? Ist es überhaupt verschwunden, sind sie vergangen? Oder bleibt es bis auf Weiteres bei der Diagnose von Steffen Mau, der den heutigen Status Quo auf den Begriff „Ungleich vereint“ (Untertitel: „Warum der Osten anders bleibt“, Berlin, edition suhrkamp, 2024) brachte? Gehörte etwa das, was nach dem Wort von Willy Brandt zusammenwachsen würde, weil es zusammengehörte, doch nicht zusammen?
Fragmentierter Erinnerungskomplex
Grit Lemke lässt eine Gruppe Jugendlicher in ihrem dokumentarischen Roman „Kinder von Hoy“ (Berlin, Suhrkamp, 2021) den 4. November 1989 als etwas erleben, das sich noch nicht in Worte fassen lässt: „Dass aber auf dem Alexanderplatz Großes geschieht ist uns bewusst. Deshalb haben wir uns schon am Vormittag in Mauras elterlicher Wohnung getroffen. Wir belagern alle verfügbaren Sitzgelegenheiten im Wohnzimmer und starren auf die Schrankwand. Dort steht, gleich neben der Batterie Eierlikör, den in Hoy jeder Haushalt aus Grubenfusel selbst herstellt, der Fernseher. Aus der Schrankwand tönt es von Freiheit und Demokratie und immer wieder: ‚Wir sind das Volk.‘ An den Gedanken, zum gleichen Volk wie die Berliner zu gehören, müssen wir uns erst gewöhnen.“ Es dauerte nicht lange, da wurde aus dem „Wir sind das Volk“ ein anderer Satz: „Wir sind ein Volk“. Mit bekannten Konsequenzen.
Martin Sabrow schrieb von den drei Gedächtnissen, die miteinander konkurrieren, wenn Menschen versuchen, ihr Verhältnis zur DDR zu erklären. Die einen erzählen die Geschichte der DDR als Geschichte eines Fortschritts, andere als die Geschichte einer Diktatur, wiederum andere als Geschichte eines Arrangements, in dem sie die Fortschritte und die in einer Diktatur üblichen Repressionen zumindest für ihr persönliches Leben ausbalancierten. Paula Fürstenberg hat diese Trias in ihrem Essay „Das Wetter findet immer statt“ um einen vierten Begriff erweitert, das unauflösbare „Ambivalenzgedächtnis“: „Ja, ich halte den Reflex, Ambivalenzen auflösen zu wollen, für einen der fatalsten menschlichen Irrtümer.“ Anna Lux und Jonas Brückner definieren den Inhalt dieser „Ambivalenz“ konkret und schlagen in ihrem Buch „Neon / Grau“ (Berlin, Verbrecher Verlag, 2025) einen fünften Begriff vor: das „Umbruchsgedächtnis“. Letztlich signalisieren alle fünf Begriffe eine Fragmentierung von Erinnerung. Erinnerungen wirken als eine Art unvollständiges Puzzle. Einige Teile haben wir wohl in irgendeiner Schublade vergessen, verlegt, vielleicht sogar verloren. Und dann fordern Politiker:innen, Journalist:innen und manch andere uns in ihren Festreden und Leitartikeln auf, dass wir alle dieses gesamte Puzzle wieder vollständig zusammensetzen und darüber alle uns trennenden Kontroversen vergessen!
Drei im Jahr 2025 erschienene Bücher könnten uns helfen, einige der verlorenen Puzzlesteine wiederzuentdecken. Es mag eine subjektive Auswahl sein, doch jedes der drei Bücher, die ich neben den schon genannten von Ines Geipel, Grit Lemke und Steffen Mau (und manch anderen) empfehlen möchte, vermag ganz spezifische Puzzlesteine des uns so oft verwirrend erscheinenden Erinnerungskomplexes sichtbar zu machen. Es handelt sich um das bei Droemer-Knaur erschienene Buch „Vereint in Zerrissenheit – Die ostdeutsche Generation Z zwischen zwei Welten“ von Nora Zabel, das von Alexander Leistner, Manja Präkels, Tina Pruschmann und Barbara Thériault gemeinsam gestaltete Buch „Extremwetterlagen – Reportagen aus einem neuen Deutschland“, sowie das schon genannte Buch von Anna Lux und Jonas Brückner „Neon / Grau“ mit dem vielsagenden Untertitel „1989 und ostdeutsche Erfahrungsräume im Pop“. Diese beiden letztgenannten Bücher erschienen im Verbrecher Verlag.
Nora Zabel: „Vereint in Zerrissenheit“
Nora Zabel wurde 1996 in Hof Gallin, Mecklenburg-Vorpommern, geboren. Sie arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Bundestagsabgeordneten und Staatsministerin Serap Güler (CDU). Das Vorwort ihres Buches „Vereint in Zerrissenheit“ schrieb die Bundestagsabgeordnete und ehemalige Vorsitzende von Bündnis 90 / Die Grünen Ricarda Lang. Ricarda Lang verweist auf die Problematik des Begriffs der „Transformation“, die sie lange nicht erkannt habe. In der aktuellen „Krise der Demokratie“ sieht sie eine „Krise der Ungleichheit“ und denkt angesichts der gängigen „Kulturalisierung von materiellen Fragen“ darüber nach, wie der materielle Grund solcher „Kulturalisierung“ in den politischen und gesellschaftlichen Auseinandersetzungen wieder nach vorne auf die Agenda gebracht werden könnte. Dazu sei es erforderlich, „nicht blind zu sein für den biografischen und individuellen Teil der Ungleichheit.“ Es geht eben nicht nur um die abstrakte Geschichte eines (verschwundenen) Landes, sondern auch um die vielen konkreten Geschichten vieler Menschen, die sich mit diesem Land in welcher Form auch immer verbunden fühlen.
Ein Anlass des Buches waren die Wahlen vom 1. September 2024, in denen die AfD in Sachsen knapp hinter der CDU auf dem zweiten Platz landete, während sie in Thüringen zur stärksten Partei wurde. In beiden Ländern hat die jeweils von der CDU geführte Regierung keine Mehrheit im Parlament. Wenige Wochen später schaffte die AfD auch in Brandenburg den zweiten Platz. Dem sozialdemokratischen Ministerpräsidenten gelang es gleichwohl, eine Regierung zu bilden, die über eine Mehrheit im Landtag verfügt. Die Konfrontationen, Kontroversen und der Ton der Wahlkämpfe setzten sich in der Bundestagswahl vom 23. Februar 2025 fort. Die AfD lag in fast allen Wahlkreisen der ostdeutschen Bundesländer vorne. Die AfD ist jedoch kein ausschließliches Ost-Phänomen. Auch im Westen gewinnt die Partei an Zuspruch, so in den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen vom 14. September 2025. Im Jahr 2026 stehen Landtagswahlen in Baden-Württemberg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt, Kommunalwahlen in Bayern, Hessen und Niedersachsen an.
Nora Zabel wendet sich in ihrem Buch gegen jede Binarisierung der Debatte, es geht eben nicht nur um die AfD und die Anderen. Sie sucht jedoch nach den Hintergründen. Ein Ausgangspunkt ist die von David Goodhart beschriebene Opposition der „Anywheres“ und der „Somewheres“, die sie als Pole versteht, zwischen denen es eigentlich viele Mischformen geben sollte. Ihr Ziel: „Ich werbe in diesem Buch dafür, dass konservative Daheimgebliebene und kosmopolitische Zurückgekommene den jeweils anderen Lebensentwurf als gleichwertig ansehen und wertschätzen und sich gemeinsam für das Projekt Demokratie im Osten einsetzen, das gerade mächtig ins Wanken gerät.“ Sie will jedoch keine ein für allemal verbindliche Lösung anbieten: „Dieses Buch kann nur Fragen stellen; die Antworten beginnen dort, wo wir aufhören, uns in bequemen Erzählungen einzurichten.“
Nora Zabel schreibt, „dass Ostdeutschland nicht nur eine geografische Region ist, sondern ein Geflecht aus gelebten Geschichten, die bis heute weiterwirken.“ Es wachse ein „Generalzweifel am jetzigen demokratischen System“, der bereits große Teile der Bevölkerung erfasst habe. Aus westlicher Sicht sei ihr jedoch vorgehalten worden, dass so manches, beispielsweise die Straßen, in Ostdeutschland besser aussähen als im Westen: „Stimmt, die Straßen sehen oft besser aus, aber das liegt auch daran, dass hier viele andere Baustellen nie angegangen wurden. Wenn Infrastruktur der Trostpreis für verloren gegangene Arbeitsplätze, Perspektiven und Identität ist, dann danke dafür, doch schöne Straßen bringen alleine keine Zukunft.“
„Identität“ scheint ein passendes Stichwort zu sein. Rund um diesen schillernden Begriff gibt es viele „Geschichten“ (Geschichte gibt es nur im Plural!). Diese „Geschichten“ erkundet die Autorin in Gesprächen mit ihrer eigenen Familie und anderen Personen, einer Schulfreundin, mit Anne Drescher, der ehemaligen Landesbeauftragten in Mecklenburg-Vorpommern für die Aufarbeitung der SED-Diktatur, dem Publizisten und Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk, der Journalistin Mariam Lau, mit Heike Müller, der Vorsitzenden des LandFrauenverbandes Mecklenburg-Vorpommern, dem Soziologen Armin Nassehi, der Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern Manuela Schwesig, ihrem ehemaligen Sozialkundelehrer, der Mitglied der Linken ist, dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst sowie der stellvertretenden Generalsekretärin der Bundesschülerkonferenz Maja Zaubitzer aus Weimar. Sie berichtet, was sie bei Treffen mit Angela Merkel erfuhr und bezieht sich auf Analysen und Berichte von Thomas Bauer, Ines Geipel, Philip Manow und Steffen Mau oder – dies ist einer ihrer Lieblingsautoren – von Theodor W. Adorno. Das Buch endet mit Albert Camus und seinem „Mythos des Sisyphos“: Obwohl Sisyphos scheitert, wagt er immer wieder einen neuen Anfang und ist daher – so Camus – ein glücklicher Mensch. (Nur am Rande: Albert Camus ist auch einer der Lieblingsautoren von Franz Müntefering.) In früheren Zeiten hätte man Menschen wie Albert Camus, Franz Müntefering oder Nora Zabel als „Reformisten“ markiert und das war nicht nett gemeint!
Die Anerkennung von Vielfalt wäre die eine Seite, die Versuchungen zur Binarisierung, zur Schubladisierung, zur Schwarz-Weiß-Malerei sind die andere. Nichts ist eindeutig, alles ist ambivalent, sodass eigentlich eine Art von „Ambiguitätstoleranz“ gefördert werden müsste, wie sie der Islamwissenschaftler Thomas Bauer unter anderem in „Die Vereindeutigung der Welt – Über den Verlust an Mehrdeutigkeit und Vielfalt“ (Stuttgart, Reclam, 2018) forderte. Die Neigung zur Binarisierung belegt Nora Zeibel beispielsweise mit der Ostdeutschen zugeschriebenen (und bei manchen auch tatsächlich vorhandenen) Russlandfreundlichkeit: „Heike Müller erzählt mir, dass Selenskyj für viele Ostdeutsche zu Unrecht von den Medien glorifiziert wird, während Putin ebenso zu Unrecht als Dämon dargestellt werde: ‚(…) Viele sind mit Geschichten aufgewachsen, in denen es nur eine Wahrheit gab, nur eine moralisch richtige Seite. Das Misstrauen gegenüber einseitiger Berichterstattung oder moralischer Überhöhung ist kein Automatismus prorussischer Sympathie, sondern für viele auch eine historische Erfahrung. Propaganda funktioniert – das haben wir selbst erlebt. (…) Denn wenn die Geschichte uns etwas gelehrt hat, dann, dass Menschen, die sich bevormundet fühlen, irgendwann den Glauben an das System verlieren.‘“ So war es in der DDR und so scheint es 35 Jahre später wieder zu sein.
Es geht hier in keiner Weise um eine Rechtfertigung von Putin oder von Selenskyj, wohl aber um den Modus, in dem über Putin oder Selenskyj gesprochen und gestritten wird. Wer die dahinter liegenden „Geschichten“ der vergangenen 70 oder gar 100 Jahre nicht bedenkt, wird es nicht schaffen, „gezielte Manipulation“ und „gesellschaftliche Debatte“ zu unterscheiden. So erklären sich Sympathien für die Positionen von Sahra Wagenknecht oder für „den Sozialismus als beste Staatsform“. Immer wieder wird etwas Entscheidendes ignoriert. Dies gilt auch für die Popularität der Thesen von Dirk Oschmann. Nora Zabel stimmt ihm zu, „dass es im Westen eine große Bildungslücke gibt, die mit Vorurteilen und Klischees über Ostdeutsche aufgefüllt wird“, distanziert sich jedoch von ihm, weil „seine Zuspitzungen des Öfteren Bauchschmerzen bei mir auslösen. Seine binäre Denkweise in Ost und West, Weiß und Schwarz ist selbst mir, einer ostdeutschen Heimatverbundenen, zu abgefahren (…), wenn er sagt, dass der Westen oft als Norm begriffen werde und der Osten als Abweichung und Abnormität, als dauerhaft Schmerzen verursachendes Geschwür am Körper des Westens.“
Eben solche Denkweise findet Nora Zabel auch in ihrer eigenen Familie. Letztlich war eben „die DDR eine existenzielle Tatsache“. Dies wurde jedoch auch noch in den 2000er Jahren ignoriert, als die Autorin die Schule besuchte, die für sie durchaus „ein Zufluchtsort (war), an dem experimentiert wurde, an dem diskutiert wurde, an dem Widerspruch in einer Debatte als etwas Fruchtbares wertgeschätzt wurde.“: Aber etwas Wesentliches fehlte: „Was wir nie diskutiert haben, war das, in was wir hineingeboren wurden. Was direkt vor unserer Nase lag: das ehemalige Ostdeutschland.“ Durch diese Ignoranz konnte sich eine Art „DDR-Kult“ entwickeln, die so oft beschworene „Ostalgie“. Nora Zabels Freundin Paula versteht sich als „nicht politisch“: „Ganz ehrlich, ist doch geil! Unsere Dorffeste, Simson oder unsere Vereinstradition. Das ist doch Kultur. In Bayern haben sie das Oktoberfest und Semmeln. Wir haben das. Das sollten wir auch aufrechterhalten.“ Nora Zabel zweifelt jedoch: „Ich bin innerlich zerrissen zwischen Gedanken wie ‚Das Kultivieren dieser Überbleibsel verharmlost die Diktatur und die Menschenrechtsverbrechen‘ und ‚Es war nicht alles grau in der DDR‘.“ Letztlich lebe die Generation Z, zu der sich Nora Zabel zählt, „zwischen zwei Welten (…) einerseits mit der Vision einer modernen Gesellschaft, andererseits mit der Befürchtung des Rückfalls in alte Muster“. Dabei spiele auch eine Rolle, dass die gesellschaftlichen Räume in Ostdeutschland, in denen sich Menschen begegnen, überschaubar sind: „Je kleiner die Gemeinschaft, desto höher ist der soziale Druck.“ Das mag auch für ländliche Regionen in Bayern und Baden-Württemberg oder auch Stadtteile im nördlichen Ruhrgebiet gelten, nicht zuletzt angesichts der Tatsache, dass Menschen, die dort leben, nur selten in andere Stadtteile oder Gemeinden hinauskommen. Man bleibt in seiner Bubble, als „Somewheres“ auf relativ engem Raum. Die da draußen, wir da drinnen. Oder auch umgekehrt.
So wirkt – um mit dem französischen Historiker Fernand Braudel zu argumentieren – „die lange Dauer“, „la longue durée“, die sich in der Post-DDR bestätige. Es ließe sich auch mit Ivan Krastev und Stephen Holmes argumentieren, die in ihrem Buch „The Light that Failed“ (deutsche Ausgabe: „Das Licht, das erlosch“, Berlin, Ullstein, 2019) die These formulierten, dass in den osteuropäischen Ländern einer Phase der „Nachahmung des Westens“ Phasen der Skepsis bis hin zur Rückbesinnung auf die Zeiten vor 1989 folgten. Insofern lassen sich die Begegnungen, die Nora Zabel dokumentiert, durchaus in internationale Debatten einordnen, in Tschechien, in Polen, in der Slowakei, in Ungarn.
Die Geschichte der DDR und der Post-DDR ist kein Einzelfall. Aber wer sind die Akteure? Steffen Mau verweist auf „das sogenannte Phänomen der fragilen Männlichkeit“, das auch viel damit zu tun hat, dass viele Frauen aus dem Osten in den Westen abgewandert sind, sodass es in den ostdeutschen Bundesländern zu einem erheblichen Männerüberschuss gekommen ist. Armin Nassehi betont, dieses Faktum sei „ganz kulturunabhängig, egal wo, auch der Islamismus geht darauf zurück. Die Männer in den arabischen Ländern, die nichts zu tun haben, die fangen Sie nicht wieder ein.“ Gleichviel, in welchem Land: Rechtspopulisten, manche Konservative, propagieren in mehr oder weniger radikaler Form die Rückkehr zu einer Kultur männlicher und weißer Vorherrschaft. (Die jüngste Verfassungsänderung in der Slowakei, es gebe nur zwei Geschlechter, passt in diese Entwicklung, von den USA ganz zu schweigen.)
An dieser Stelle hätte Nora Zabel auf ein Dilemma der Grünen eingehen können. Einerseits haben die Grünen (und andere) mit ihrer feministischen Kritik an patriarchalischen Strukturen Recht, andererseits ist die Frage berechtigt, warum Gleichstellungsfragen von Frauen und Männern in kontroversen Debatten auf die Frage von Gendersternchen reduziert werden konnten. Die Leipziger Autoritarismusstudie von 2022 bezeichnete den Anti-Feminismus als „Brückenideologie“ zu rechtextremistischen Einstellungen, Sandro Witt, der für den DGB das Projekt „Betriebliche Demokratiekompetenz“ leitete, musste feststellen, dass sich im Projekt eine Reihe von Einstellungen zur freiheitlichen Demokratie nachhaltig veränderten, es jedoch offenbar kein Mittel gegen den Anti-Feminismus gab. Eine Erklärung gibt Nora Zabel, es herrscht ein ungeheurer Druck, der ein „Ventil“ braucht, um die unter dem Druck Leidenden zu entlasten: „Rechtsextremismus, Linksextremismus, Islamismus und andere fundamentalistische Strömungen, wie wir sie gerade bei den rechten Evangelikalen in den USA sehen, haben eines gemeinsam: Sie bieten ein Ventil für individuelle Frustration und vermeintliche Sicherheit durch eine Gemeinschaft, die oft durch Ablehnung von Andersdenkenden zusammengehalten wird und auf Unterdrückung basiert.“
Nora Zabel ist CDU-Mitglied. Sie sieht viele Äußerungen der CDU im Bundestagswahlkampf sehr kritisch, das, was dort geschah, war aus ihrer Sicht „keine Emanzipation von der Merkel-Ära, das ist ein strategisches Wagnis mit unberechenbaren Risiken“, andererseits begrüßt sie die Flexibilität von Friedrich Merz nach der Wahl. Sie zitiert Mariam Lau: „Wenn es die CDU nicht mehr gibt, wird auch Deutschland so in der jetzigen Form nicht mehr bestehen können.“ In der Tat geht es der AfD in erster Linie darum, die CDU als konservative Partei zu zerstören, so wie dies anderen rechtspopulistischen Parteien in Italien oder in Frankreich gelang und inzwischen auch in Großbritannien zu gelingen scheint. (Thomas Biebricher beschrieb diesen Prozess in seinem Buch „Mitte / Rechts – Die internationale Krise des Konservatismus“, Berlin, Suhrkamp, 2023.) Da helfen keine „Strategiepapiere oder Gipfeltreffen“. Es geht darum, „wie Informationen verarbeitet werden und wie Erzählungen gefolgt wird.“ Sind wir damit wieder bei Albert Camus? Nicht nur. Nach ihrem Verweis auf Albert Camus ruft Nora Zabel die Leute ihrer Generation, der sogenannten „Generation Z“, auf, sich in einer demokratischen Partei zu engagieren: „Die Zauberworte für dauerhafte Veränderung lauten also: Gremien, Fraktionen, Ausschüsse, Parlamente.“ Dies gilt auch angesichts einer von ihr zitierten Äußerung ihrer Chefin Serap Güler, die sagte, dass sich die Spielräume mit zunehmendem Aufstieg in der Partei verringerten. Aber das muss ja nicht so bleiben.
Anna Lux und Jonas Brückner: „Neon / Grau“
Die Historikerin Anna Lux (*1978) und der Kulturwissenschaftler Jonas Brückner (*1989) haben sich mit der Frage befasst, welche unterschiedlichen Geschichten und Debatten sich in Filmen, Romanen, Musik und Pop-Kultur zur DDR und zur Post-DDR finden. Sie verstehen ihr Buch als ein „Vexierspiel von Vorstellungen und Zuschreibungen“, in bewusster Abgrenzung zu Oschmanns These vom Osten als „Erfindung des Westens“ und Kowalczuks Diagnose, die Menschen im Osten seien letztlich mit all den Neuerungen „überfordert“. „Es braucht mehr Geschichte(n), so eine zentrale These unseres Buches, um diese Vielstimmigkeit zu hören und zu verstehen.“ Es geht Anna Lux und Jonas Brückner um die Möglichkeiten „populäre(r) Geschichtskultur“, um – im Sinne von Ursula K. Le Guin („The Carrier Bag Theory of Fiction“, 1986, wiederum unter Bezug auf Elizabeth Fisher in „Woman’s Creation“, 1975) – die Inhalte einer „kulturelle(n) Tragetasche“ (die deutsche Version von Anna Lux für Le Guins „carrier bag theory of fiction“), eine literarisch formulierte Variante des sprichwörtlichen Päckchens, das jede:r zu tragen hätte.
Das Buch enthält neben dem einleitenden Gespräch und einem resümierenden „Outro“ acht Kapitel, die sich mit dem Jahr 1989 selbst, dem schnellen Verschwinden der DDR, den Utopien und dem Abwürgen früher Demokratisierungsprozesse, nationalen Zugehörigkeiten, ethnokulturellen Zuschreibungen, den „Baseballschlägerjahren“, ostdeutschen Männlichkeiten und der „Peripherisierung“ des ländlichen Raums befassen. Jedem Kapitel folgen Antworten von insgesamt 17 Akteur:innen, Publizist:innen und Künstler:innen auf jeweils drei Fragen. Das Buch ist im Übrigen eine Fundgrube für alle, die Autor:innen, Filmemacher:innen, Musiker:innen kennenlernen möchten, mit deren Werken sie vielleicht einen anderen Blick entdecken wollen.
Mit Steffen Mau vertreten Anna Lux und Jonas Brückner die These: „Wer in der ostdeutschen Debatte einseitig nach Schuld fragt, ist auf dem Holzweg.“ Es gehe auch nicht um ein „Identitätsbedürfnis als Ostdeutsche“ – so Anna Lux. Jonas Brückner ergänzt, dass sie sich daher für den Begriff „Umbruch“ an Stelle von „Wende“ entschieden hätten, weil dieser Begriff, „das Zäsurhafte, die sozialen, kulturellen und mentalen Brüche besser fasst als beispielsweise ‚Wende‘.“ Abgesehen davon – dies eine kleine polemische Spitze – sei dieser „Begriff mit Egon Krenz verbunden“.
Was ging 1989/1990 verloren? Erstaunlicherweise ist dies die Frage, die öfter gestellt zu werden scheint als die Frage, was gewonnen wurde. Zur Sprache beziehungsweise zum Bild kommen der „Verlust der 1000 kleinen Dinge des Alltags“ und die Treuhand als Symbol all dessen, was abgeschafft beziehungsweise im damaligen Einheitsjargon „abgewickelt“ wurde. Die „Treuhand“ wurde geradezu zum „negativen Gründungsmythos“. Jana Hensel schreibt in „Zonenkinder“ (Rowohlt, 2012): „Die Wende traf uns wie ins Mark. Sie fuhr uns in die Knochen und machte, dass sich alles um uns drehte. Wir waren zu jung, um zu verstehen, was vor sich ging, und zu alt, um wegzusehen, und wurden unserer Kindheit entrissen, bevor wir wussten, dass es so etwas überhaupt gab. (…) Eine ganze Generation entstand im Verschwinden.“ Jutta Voigt spitzt zu: „Das Neue entsteht unter Verwesungsgestank.“
Es entstand ein unspezifisches „Ostgefühl“, das – so Gerta Hartmann und Alexander Leistner vom Forschungsverbund „Das umstrittene Erbe von 1989“ – sich in einer Art „Widerstandsnarrativ“ verdichtete, dessen vorwiegend männliche Apologeten sich zunächst in den „Baseballschlägerjahren“ (Christian Bangel) auslebten: „In dieser, von Pegida über die AfD bis zu den Freien Sachsen repräsentierten Vorstellung, ist der Osten eine ethnisch und interessenhomogene Gesellschaft, innerhalb derer Kritik an sozialer Ungleichheit, Peripherisierung, Migrationspolitik oder medialer Berichterstattung zu einem Grundkonflikt zwischen ‚Ost‘ und ‚West‘, ‚unten‘ und ‚oben‘, ‚wir‘ und ‚ihr‘ verallgemeinert wird.“ Manja Präkels, Autorin von „Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß“ (2017) sagt am Ende des Kapitels „Nationale Zugehörigkeiten in der Ost-Westdeutschen Mehrheitsgesellschaft“: „Das ostdeutsche Wetterleuchten der Möglichkeit einer anderen Welt hingegen, das sich durch die Geschichte und Geschichten zieht, das nenne ich meinen roten Faden. Da hängt auch 1989 dran. Leider steckt in mir eher die Erfahrung in den Knochen, wie es ist, wenn eine Menge Meute wird.“
Der „Umbruch“ wurde auch als „Rausch“ erlebt, denn es „entstand ein Möglichkeitsraum für Gewalt an sich, vor allem als rechte Gewalt. Sie gehört unmittelbar zur Umbruchszeit. Und alle waren involviert: als Opfer, Täter, ängstliche Beobachter, Claqueure.“ Rechtextremismus gab es schon in der DDR, auch wenn die Partei dies immer leugnete, wie beispielsweise nach dem rechtextremistischen Angriff auf ein Konzert der Westberliner Gruppe „Element of Crime“ im Jahr 1988 in der Zionskirche am Prenzlauer Berg. Der Rechtsextremismus wurde mit dem Mauerfall gleich mit befreit. (Mich erinnert dies auch an Nebenwirkungen der sexuellen Befreiung in den 1960er Jahren. Einer der damaligen Gewinner war die Pornoindustrie.) Die Frage mag erlaubt sein, ob und wann solche Nebenwirkungen als Problem wahrgenommen werden. „Dass die Baseballschläger Jahre lange ignoriert wurden, hat eine politische Kultur befördert, die offen für Rechtspopulismus ist und in der verbale und körperliche Gewalt erscheinen. Viele der damaligen Täter wurden nicht belangt. Sie sind heute erwachsen, haben selbst Kinder, sind anerkannte Mitglieder ihrer Gemeinden.“ In Sport- und Heimatvereinen, in der Freiwilligen Feuerwehr etc.
Am Anfang gab es eine große Hoffnung, eine Wiederholung des bundesrepublikanischen „Wirtschaftswunders“ im Osten. Zunächst erzählte man sich den der „Mauerfall als Wundererzählung“. Natürlich gab es „Erfolgsgeschichten“, die als Gegensatz zur „Kolonisierungsgeschichte“ erzählt wurden. Aber warum setzten sich die negativen Versionen durch? Vielleicht bietet der im Buch mehrfach erwähnte Roman „Als wir träumten“ von Clemens Meyer (Frankfurt am Main, S. Fischer, 2006, verfilmt von Andreas Dresen nach einem Drehbuch von Wolfgang Kohlhaase, 2015) Antworten?
Letztlich verfestigt sich eine Summe individueller Einzelschicksale, die sich nach dem Grundsatz, dass die Summe immer mehr ist als die bloße Summe ihrer Teile, in mystifizierenden Großerzählungen, in denen versucht wird, das Geschehene auf einen einfachen und konsensualen Begriff zu bringen. Eine dieser Großerzählungen ist der „Anpassungsschock“ – eine Formulierung von Steffen Mau. Kowalczuk spricht von einem „Freiheitsschock“, so der Titel seines 2024 bei C.H. Beck erschienen Buches. Schockstarre. Viele schweigen. Dies ist jedoch kein spezifisches ostdeutsches Problem. Anna Lux und Jonas Brückner verweisen auf „Streulicht“ von Deniz Ohde (2020) und „Dschinns“ von Fatma Aydemir (2023). „Bei ihr ist das Schweigen in der Familie der Ausgangspunkt der Erzählung. Es ist vielleicht sogar die Grundlage für die Existenz dieser Familie, denn das Schweigen macht es möglich, etwas in der Balance zu halten. Bis es kippt.“ In den Worten Fatma Aydemirs: „Vielleicht ist Familie ja nichts anderes als das, ein Gebilde aus Geschichten und Geschichten und Geschichten. Aber was bedeuten dann die Leerstellen in ihnen, das Schweigen?“
Paula Fürstenberg sagt: „Ich stolpere ständig über die Worte, die sich durchgesetzt haben, um über den Osten zu sprechen.“ Jonas Brückner konstatiert: „‚Friedliche Revolution‘ hat sich im Alltag ebenso wenig durchgesetzt wie der technisch klingende ‚Transformationsprozess‘. Begriffe wie ‚Anschluss‘ oder ‚Kolonialisierung‘, die zuletzt verstärkt verwendet werden, sind wiederum stark wertend und analytisch eher zur Beschreibung der Debatte hilfreich als für den historischen Prozess.“ So oder so bleibt eine Art Sprachlosigkeit, vielleicht aber eröffnen künstlerische Wege einen Weg, sich mit DDR und Post-DDR auseinanderzusetzen? So verstehe ich den Grundtenor von „Neon / Grau“. Damit ist natürlich noch nichts darüber gesagt, wer was wie rezipiert. Anders gesagt: „Wer erzählt eigentlich wann was über wen?“
Kann es „gemeinsame Erzählungen“ geben, deren Perspektiven vielleicht doch (fast) alle teilen? Manche Debatten und Ereignisse dienen jedoch eher als Belege für den Bedarf einer solchen verbindenden Großerzählung. Dazu gehören – so Anja Lux und Jonas Brückner im Kapitel „Nationale Zugehörigkeiten in der ost-westdeutschen Mehrheitsgesellschaft“ – die seit etwa dem Jahr 2000 immer wieder neu aufflammende Debatte um eine sogenannte „Leitkultur“, die Fußballweltmeisterschaft 2006 mit dem „massenhaften Flagge-Zeigen im Land“, die Debatte um Thilo Sarrazin, dessen Buch „Deutschland schafft sich ab“ im Jahr 2010 zu einer Art Bibel des Rechtspopulismus wurde, die Rede des damaligen Bundespräsidenten Christian Wulff aus dem gleichen Jahr, in der er sagte, dass der Islam zu Deutschland gehöre, die Beschlüsse des „Bundestages zum Abriss des Palasts der Republik und zur Rekonstruktion des Stadtschlosses im Jahr 2006“. Erfolgreich waren diese Versuche alle nicht: „Re-Nationalisierung“ (zum Beispiel Sarrazin) und „gesellschaftliche Liberalisierungen“ (zum Beispiel Wulff“) standen und stehen nach wie vor unversöhnlich einander gegenüber. Einheit wurde zur „Fiktion“, sodass „legitime ostdeutsche Selbstverständigungsdiskurse stets mit ihren offenen Flanken in rechtsidentitäre Erzählungen ringen müssen und das (teilweise) auch tun.“ Für westdeutsche Diskurse gilt dies durchaus genauso, denn manche Debatte, die Ostdeutschland zugeschrieben wird, ist letztlich eine gesamtdeutsche Debatte, die sich je nach Raum und Zeit mit unterschiedlichen Inhalten füllt, aber letztlich Kontroversen in Konfrontationen zuspitzt. Westdeutsche erklären sich gerne für unschuldig, indem sie mit dem Finger nach Osten zeigen. Wiederum Manja Präkels: „Wer wurde und wird aus welchen Gründen (wofür / wogegen) ausgegrenzt?“
Der Film „Good bye, Lenin“ von Wolfgang Becker (2003) ist ein Film über Trauer und Abschiednehmen. Thomas Brussig kommentierte: „Einen Abschied von der DDR, so wie man von einem Menschen Abschied nimmt, eine Trauer, das hat es im Herbst 90 einfach nicht gegeben. Das war eine so rastlose, vorwärtshastende Zeit“. Der Film zeigte, „wie die Welt der kleinen Dinge unser (Über-)Leben (mit)prägt.“ Der Hauptakteur Alex gewinnt den Eindruck, dass er für seine Mutter eine DDR schuf, wie er sie sich eigentlich gewünscht hätte. Als seine Mutter die vielen Westautos sieht, erklärt er dies mit einer Massenflucht von West nach Ost, weil viele im Westen eben den Kapitalismus leid wären. Vergleichbar sind die vielen Alltäglichkeiten im Film „Gundermann“ von Andreas Dresen (2018), der ebenso wie „Regina Scheers Roman ‚Machandel‘ oder die zeitgenössischen Beobachtungen von Jutta Voigt (…) Orte des Sich-den-Verlusten-Stellens“ zeige (Link im Zitat: NR). Regina Scheer sagt: „Die Offenheit dieses kurzen historischen Moments von 1989/1990 ist eine kostbare Erinnerung.“ Zu den „Illusionen“ der Zeit gehörten auch der Runde Tisch, sein Verfassungsentwurf und die von Christina Morina in ihrem Buch „1000 Aufbruche“ (München, C.H. Beck 2024) dokumentierten Ideen vieler DDR-Bürger:innen, die diese – nicht zuletzt in Kontinuität des in der DDR populären Eingabewesens – schriftlich vorbrachten.
Im achten Kapitel von „Neon / Grau“ wird der ländliche Raum als „Poetik der Ödnis“ Thema, ein Begriff der Literaturwissenschaftlerin Rainette Lange (2020). Manches lässt an andere Öden der Literaturgeschichte denken, beispielsweise an Schweizer Dorfgeschichten aus dem 19. Jahrhundert und den dort beschriebenen Pauperismus. Zu nennen wären Gottfried Keller und seine Novelle „Romeo und Julia auf dem Dorfe“ oder Romane von Jeremias Gotthelf. Allerdings geht es nicht nur um die bloße Anklage unhaltbarer Verhältnisse. „Die Ödnis bleibt so nicht Kulisse, vor deren Hintergrund sich Geschichten von Aufbruch und Ausbruch abspielen, sondern wird als Lebensraum mit Grautönen und Nuancen sichtbar. Als Handlungsort gewinnt er an Vielschichtigkeit und Tiefe, manches erscheint gar existenzieller – neon / grauer – als im urbanen Raum, die Beziehungen, die Träume, die Abgründe.“ Als Beispiele zitieren Anna Lux und Jonas Brückner die Romane „Dinge, die wir heute sagten“ von Judith Zander (2012), „Mit der Geschwindigkeit des Sommers“ von Julia Schoch (2009) oder „Der Hals der Giraffe“ von Judith Schalansky (2011). Komödiantisch wird die „Ödnis“ in der rbb-Serie „Warten auf’n Bus“ persifliert. Juli Zeh lässt in „Unterleuten“ (2016) die Romanfiguren selbst sprechen, sodass verschiedene Perspektiven sichtbar werden, wie sie sich die Gestaltung ihrer Umwelt vorstellen, der Vogelschützer und Alt68er, der undurchsichtige Automechaniker, die Pferdezüchterin, das Energieunternehmen, die alten LPG-Genossen. „Die Peripherie wird hier nicht als eine sozial-kulturelle und wirtschaftliche Abhängigkeit erzählt, sondern als ein Ort, der nach eigenen Regeln funktioniert. Dabei ist Unterleuten keineswegs ein unsympathischer Un-Ort oder eine Dystopie. Im Gegenteil treffen hier utopische Vorstellungen von Welt und Miteinanderleben aufeinander und treten gegeneinander an.“ Ganz ähnlich funktioniert die Welt in „Über Menschen“ (2021) dem folgenden Roman von Juli Zeh, in dem sie den „Dorf-Nazi“ (so bezeichnet er sich selbst), ein schwules, aber gar nicht unbedingt fortschrittliches Pärchen oder eine mehr oder weniger zivilisationsmüde Großstädterin einander begegnen lässt.
Mit Erich Kästner ließe sich fragen, wo denn das Positive bleibe. Grit Lemke, Autorin der „Kinder von Hoy“ (2021) sieht Hoffnungen in den als „abgehängt“ markierten Regionen. „Wir hatten eine Vision für das Land. (…) Heute ist die Lausitz eine entvölkerte Region, abgehängt vom Rest des Landes. Aber seit ein paar Jahren wieder mit Potenzial, Hoffnung und Aufbruchstimmung. Wir könnten da etwas Neues, Großes schaffen. Da sind Visionen, da ist Bewegung drin.“ Es kann sich durchaus etwas ändern wie auch Charly Hübner in seinem Film „Wildes Herz“ (2018) über Monchi und die Punk-Band „Feine Sahne Fischfilet“ zeigt. Auch in diesem Film spielen Bushaltestellen eine Rolle. Zum Schluss fragen Anna Lux und Jonas Brückner, ob so etwas wie „eine gesamtdeutsche Selbstbefragung“ möglich wäre, „in der es darum geht: Wie wollen wir eigentlich miteinander leben?“ Sie sprechen von „Ko-Transformationen“, vielleicht geht es aber auch um nicht mehr oder weniger als einen dialektischen Zugang, der die Ambivalenzen, Kontroversen und Unverträglichkeiten aufgreift, diskutiert, in Frage stellt und neue Ambivalenzen entdeckt, letztlich um „Ambiguitätstoleranz“. Steffen Mau, Thomas Lux und Linus Westheuser haben in ihrer Studie „Triggerpunkte – Konsens und Konflikt in der Gegenwartsgesellschaft“ (Berlin, Suhrkamp, 2023) gezeigt, dass ein solcher Verständigungsprozess möglich sein könnte, unabhängig von race, class und gender. Warum sollte etwas, dass in einer wissenschaftlichen Studie funktioniert, nicht auch im realen Leben gelingen, in der Kommune, in der Politik?
Alexander Leistner, Manja Präkels, Tina Pruschmann, Barbara Thériault, Extremwetterlagen
Die vier Autor:innen der „Extremwetterlagen“ präsentieren Ergebnisse einer „Feldforschung auf Basis literarischer Reportage“. Im Vorwort schreibt Alexander Leistner, es gehe nicht um „fertige Erklärungen“, es handele sich um „Momentaufnahmen“, um „das Unausgesprochene hörbar zu machen und zu Strukturen geronnene Stimmungen sichtbar“. Oft sind eben diese „Strukturen“ auf den ersten Blick eben nicht erkennbar, werden es jedoch, wenn man sich auf die Menschen, die man mehr oder weniger bewusst aufsucht, einlässt, Artefakte wie Plakate und Aufschriften, Landschaften und verlassene Industrieanlagen beachtet, gegebenenfalls auch dort, wo sich größere Menschengruppen versammeln, auf Festen, in Zügen oder mitunter an Bushaltestellen.
Ein Anlass für das Projekt war der September 2024, der Monat, in dem die AfD bei den Landtagswahlen in Thüringen den ersten, in Brandenburg und Sachsen den zweiten Platz erreichte. Kern des Buches ist der zweite Teil mit der Überschrift „Überlandschreiben“ (zehn Texte). Manja Präkels berichtet über ihre „Durchreise“ in Brandenburg, Tina Pruschmann über ihre Begegnungen in Sachsen und Barbara Thériault aus Thüringen. Alexander Leistner, der einzige Wissenschaftler im Team, kommentiert in jedem Teil mit jeweils einem Text. Er hat auch Vorwort und Epilog verfasst. Im ersten Teil „Sturmsaaten“ werden die ersten Eindrücke beschrieben, die sich möglicherweise auch als Resümee verstehen lassen, im dritten und vierten Teil mit den Überschriften „Druckgradienten“ und „Gegen den Wind atmen“ wird es wieder grundsätzlicher (diese drei Teile enthalten jeweils vier Texte). Die Überschrift des Epilogs klingt paradox: „Rückwärts durch die Zeit lesen“. Der Band enthält eine Fülle von Bildern, alle in schwarz-weiß gehalten, mit Motiven, die die grundsätzlich depressive Stimmung, der die über das Land reisenden Autor:innen begegnen, nicht nur illustrieren, sondern verstärken. In Text und Bild wird das Buch zu einem der deprimierendsten und trostlosesten Bücher, die ich über ostdeutsche Regionen und die dort lebenden Menschen gelesen habe. Dazu trägt auch bei, dass die Autor:innen nicht über in Romanform oder Filmen geronnene Erlebnisse schreiben, auch nicht mit mehr oder weniger prominenten Menschen sprechen, sondern sich auf die Menschen einlassen, die sie mehr oder weniger zufällig auf Straße und Plätzen treffen.
Alexander Leistner bringt im Titel des Epilogs auf eine einfache Formel, was viele Menschen eben so tun, um mit ihrer Gegenwart und ihrer Vergangenheit klarzukommen, wenn sie nicht so recht glauben, dass sie eine ihnen genehme Zukunft erleben werden. Sie versuchen ihre Gegenwart aus erlebten Vergangenheiten abzuleiten oder gar in diesen wiederzufinden, tun dies aber natürlich nicht mit dem Abstand, den üblicherweise Historiker:innen pflegen, sondern auf der Grundlage eigenen Erlebens und der Diskurse in ihren Familien und mit ihren Bekannten. Diese projizieren sie in die Zukunft hinein. Dabei bleiben sie in der Regel unter sich und ihre Gefühle vervielfältigen sich. Es entsteht eine „Kumulation von verschiedenen Prozessen, die man auf unterschiedlichen Analyseebenen – als spezialisierte Parteien-, Populismus-, Rechtsextremismus-, Protest-, Einstellungsforschung – möglicherweise zu lange zwar intensiv, aber meist separat und zu wenig systematisch in ihren Wechselwirkungen und Eigendynamiken betrachtet hat.“ Zu beobachten ist „ein langsames Aufzehren von Legitimation, Systemvertrauen und Wertbindungen, die sich nicht ohne weiteres wiederherstellen lassen“. Dieser mitunter kaum merkliche Prozess lässt sich aus zahlreichen Details erschließen. Barbara Thériault erinnert in ihrem Beitrag „Miss Mittelgebirge 1972“ an das dokumentarische Verfahren in den Romanen Balzacs: „Die Figuren sind Antworten auf Dilemmas der Zeit.“ Auf der Reise fügen sich all diese Details schließlich zu einem Gesamtbild.
Manja Präkels, Tina Pruschmann und Barbara Thériault begegnen Menschen auf der Straße, in einem Zug, an für die Vergangenheit symbolisch gelesenen Orten. Zumindest war das der Plan. Manja Präkels stellt in ihrem ersten Beitrag („Zwischen Leere und Tribüne“) fest, dass sie auf den Straßen niemanden trifft. Eine Freundin denkt in „Straßendörfern Brandenburgs“ an „Zombiefilme oder andere postapokalyptische Stoffe“. Als was könnte aber die Straße dienen? Als „Bühne“, als „Laufsteg“? Und für wen? Oder anders gefragt: Wer lässt sich blicken?
In den 1990er Jahren erlebte jemand, der „lokaljournalistisch zu berichten“ versuchte, „die Besetzung öffentlicher Orte, von Einrichtungen, Straßen und Plätzen durch Horden meist männlicher rechtsextremer Jugendlicher gänsehautnah“. Und heute? „Wir passieren Waren. Auch hier kein Mensch auf der Straße. Dafür Autos. Jeder im eigenen. Jeder mit eigenem Deutschlandwimpel, flatternd im Wind.“ Das sind nicht die Wimpel der Fußballweltmeisterschaft von 2006, sondern aktuelle Statements, die das einzige betonen, dessen man sich noch sicher zu sein scheint, die Zugehörigkeit zu Deutschland. Eine Flagge, die eigentlich die Zusammengehörigkeit der in einem Land lebenden Menschen dokumentieren soll, wird zu einem Symbol des Rückzugs in einen abschließbaren und abgeschlossenen Raum, in dem angeblich „Raumfremde“ – dies einer der Kampfbegriffe der neuen Rechten – keinen Platz (mehr) haben. Das Fähnchen im Auto signalisiert Exklusion, zumindest die Bereitschaft, andere auszuschließen. Und dann die Plakate: In mehreren Texten ist die hohe Präsenz von Plakaten rechtsextremistischer Kleinparteien Thema, der III. Weg, die Freien Sachsen (die in Sachsen so klein gar nicht sind, in manchen Kommunen in Räten sitzen), natürlich auch die zur Großpartei avancierten AfD. Tina Pruschmann: „Derweil präsentiert sich der Plakatwahlkampf in Teilen, als seien die Hakenkreuz-Kritzeleien von den verwitterten Ziegelmauern und Stromkästen der Region, als Wahlplakat geadelt an die Laternen gewandert.“
Menschen trifft man auf Festen. Aber feiern sie gemeinsam? Alexander Leistner berichtet von einem „Sommerfest“ der AfD und von dem „Demokratiefest“ auf der anderen Seite des eine Stadt teilenden Flusses. Zwei Frauen, die Schilder mit den Aufschriften „Omas gegen rechts“ und „‚love is love‘ auf Regenbogengrund tragen“ werden „umringt von einer Gruppe Höcke-Fans“: „Ein paar Mädchen mit AfD-Ballons steigen ins Blumenbeet und bauen sich direkt hinter den Frauen auf. Von vorn rücken die jungen Männer immer näher. Zwei Polizisten, die nur wenige Meter entfernt auf dem Mäuerchen der historischen Mühlgrabenbrücke sitzen, wirken desinteressiert. Sie plaudern freundlich mit Festgästen auf dem Nachhauseweg. Als wir sie auf die Situation am Rosenbeet ansprechen, kommentiert einer von ihnen achselzuckend: ‚Hier ist ja ein Raum für Meinungsaustausch.‘ / ‚Interessantes Amtsverständnis‘, antworte ich. Daraufhin erhebt er sich doch noch, geht gemächlich zu den zwei Frauen rüber, baut sich erst in voller Größe vor ihnen auf, um sich von ganz weit oben zu ihnen hinabbeugen zu können. Dann, wie zu begriffsstutzigen Kindern: ‚Haben – Sie – Angst? Sie können jederzeit gehen.“ Alexander Leistner: „Die Straße (…) ist Kulisse für den Anspruch auf die Beherrschung des öffentlichen Raums, für Einschüchterungen und Feindmarkierungen.“
In Cottbus wurde die Schwarze CDU-Landtagsabgeordnete Adeline Abimnwi Awemo angegriffen. In Bautzen erlebte Anne Rabe, „dass Leute auch nach dem CSD noch angegriffen wurden. Z.B. beim Einkaufen, als Teilnehmer des CSD identifiziert (ohne jegliche Regenbogenfahnen etc.).“ Es ist „ein tief verwurzelter Schwarmhass“, unterstützt von örtlichen Politikern. Manja Präkels kommt nach Rheinsberg, wo das örtliche Tucholsky-Museum gefährdet ist, weil sich der (nicht der AfD angehörige) Bürgermeister weigert, Ratsbeschlüsse zur Finanzierung umzusetzen. Er möchte das Museum gerne „der Abteilung für Tourismus“ zuschlagen. „Das dort ein einschlägig bekannter Rechtsextremist arbeitet, geschenkt. Das Ausflugsziel kann bleiben. Wissenschaft und Zeitkritik – adé?“ Man könnte zu dem Schluss kommen, dass die AfD gar keine SA braucht, die alles, was ihr nicht passt, zerdeppert. Die örtlichen Neo-Nazis, Kameradschaften und Kleinstparteien, Fußball-Hooligans und Kampfsportler organisieren sich schon selbst mit ihren Einschüchterungsprojekten und geben der AfD sogar noch die Gelegenheit, sich gegebenenfalls zu distanzieren. Alexander Leistner diagnostiziert in diesen Szenen eine gewisse „Professionalisierung“, aber auch im Falle einer polizeilichen Ermittlung oder gar eines Prozesses „Angst von Zeuginnen und Geschädigten“, sodass Straflosigkeit zur Regel wird, die dann mit der Zeit in gesellschaftliche Akzeptanz umschlägt, auch eine Variante des Marx’schen Satzes, das mit der Zeit in historischen wie in wirtschaftlichen Prozessen Quantität in Qualität umschlägt.
Manja Präkels erlebt Landschaft als Raum gewordene Gleichgültigkeit: „Zurück im Dorf mit dem nutzlosen Funkmast riecht es schon nach Grillfleisch. Auch hier ist der Nachthimmel klar. Es regnet Schnuppen. Einen meiner Wünsche widme ich Kat und dem schönen, leeren Cottbus. So schwer zu erreichen und doch so nah.“ Wer nicht in solchen Orten wohnt, bleibt – so Manja Präkels – auf der „Durchreise“. Die Straßen, die sie queren, sind auch Orte der Todesmärsche, von Ravensbrück, der Weg zum KZ Sachsenburg. Es wirkt heute fast schon „idyllisch“, wenn man nicht über die Vergangenheit nachdenkt. Tina Pruschmann: „Vielleicht lasse ich mich von meiner Begeisterung für eine schöne Landschaft nur allzu gerne täuschen. Vielleicht halte ich die Gleichzeitigkeit von Schönheit und Terror so wenig aus, das eines weichen muss: das Idyll oder die Brutalität.“
Erinnerungsorte müssen nicht unbedingt Empathie für die Opfer bewirken, im Gegenteil. Es gibt Stimmen, die überzeugt behaupten, dass diejenigen, die in der DDR-Zeit in einem Jugendwerkhof inhaftiert waren, „es verdient hätten dort zu sein“ und „so schlimm sei es nicht gewesen“. Solche Bagatellisierungen, die sich sogar auch in Hinweisen auf die KZ-Vergangenheit finden, schlagen in Verständnis um und machen es dann auch leichter, sich die DDR zurückzuwünschen, zumal diese im Vergleich zum Westen ja auch „ethnisch“ homogener war. Die Vertragsarbeiter:innen aus den sozialistischen „Bruderstaaten“ traf man eben auch nicht auf der Straße.
Viele lassen im wahrsten Sinne des Wortest einfach das sprichwörtliche Gras über die Vergangenheit wachsen. Tina Pruschmann berichtet aus Zwickau „Die Adresse Frühlingsstraße 26, im Ortsteil Weißenborn, wo die Rechtsterroristen des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) Beate Zschäpe, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos zehn Jahre lang unbehelligt ein nahezu bürgerlich anmutendes Leben lebten, zeigt Google Maps nicht mehr an. Auch sonst erinnert an diesem Ort nichts an den NSU. Wo das Haus stand, wachsen Gras und Gebüsch.“ Es bleibt einigen zivilgesellschaftlichen Akteur:innen vorbehalten, das „Gelände der Erinnerung“ sichtbar zu erhalten. Im Gespräch mit dem Sozialarbeiter Jörg Banitz und einer Schulklasse erfährt Tina Pruschmann, dass die Geschichte des NSU zur „Regionalgeschichte“ wurde. Die Schüler:innen waren damals, als sich der NSU selbst enttarnte, gerade einmal fünf Jahre alt. „Mir ist das Erschrecken über die Mordserie des NSU noch so präsent, dass ich mich frage, ab wann Gegenwart zur Geschichte wird.“ Überall der Wunsch nach einem „Schlussstrich“. Man will sich weder die NS- noch die DDR-Vergangenheit noch rechtsextremistische Mordserien der jüngeren Vergangenheit vorhalten lassen. Und im Hintergrund, im Untergrund gären die Gewalt- und Mordfantasien der neuen Nazis. „Hic sunt dracones.“ (NSU-Watch hat im Verbrecher Verlag mit dem Buch „Aufklären und Einmischen – Der NSU-Komplex und der Münchener Prozess“ die nach wie vor vielen offenen Fragen nach den wahren Ausmaßen des Rechtsterrorismus ausführlich beschrieben.)
Barbara Thériault benennt die Überalterung mancher thüringischen Gemeinden. „In den 1990er Jahren zogen viele ihrer jüngeren Einwohner weg und die Zurückgebliebenen bekamen immer weniger Kinder. So wurden aus 56.000 Einwohnern Ende 1988 gerade mal 37.000 Ende 2023. Ein Drittel der Stadtbevölkerung ist älter als 65 Jahre.“ Unter den Deutsch-Deutschen bleiben junge Männer. Junge Männer trifft man auch unter Zugewanderten, allerdings sind diese in einer ganz anderen Stimmung. Barbara Thériault beschreibt eine „Zuggesellschaft“ auf der Fahrt von Erfurt über Zella-Mehlis nach Meiningen: „Viele der Reisenden waren unterwegs in Richtung Thüringer Wald zur Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge. Es schienen aber keine Mitarbeiter einer vom Land beauftragten Sicherheitsfirma den Zug zu begleiten, wie es sonst manchmal der Fall ist. Ich drängte mich in die Menschenmasse hinein. Es duftete wie in einem Barbershop.“ Einige sprechen Ukrainisch, andere Arabisch, Kurdisch, einige auch Französisch. Gesprächsthemen sind Hoffnungen und Träume, Fitnessstudios, Gottvertrauen. „Eine traurige Geschichte, die dennoch fröhlich erzählt wurde.“ Bevor Barbara Thériault aussteigt, sagt sie zu einem Sitznachbarn: „Ist das hier nicht der kosmopolitischste Ort überhaupt, viel mehr als Berlin?“ Betretenes Schweigen, Unsicherheit. Eigentlich eine nette Reisegesellschaft, aber davon erfährt man in den Lokalzeitungen nichts: „Die Stadt ist sowieso in zwei Fraktionen geteilt: die Autofahrenden und die Bus- und Bahnfahrenden. (…) Es sind Kreise, die sich kaum berühren. Die Zeitungsleser und die hiesigen Journalisten gehören zur Fraktion der Autofahrenden.““
So leer wie die Straßen, so leer sind die Orte und so leer sind die Erinnerungen an Vergangenheiten. Nicht so ganz: Es sind letztlich nur andere Erinnerungen, die zählen. Interessant ist für manche zum Beispiel die ehemalige Produktionsstätte des Kleintransporters Barkas: „Die Leere am längsten Produktionsband der Welt ist auch eine identifikatorische.“ Oder ein ehemaliges Dieselkraftwerk in Cottbus, die Halle der Cargolifter AG, die Luftschiffe baute, 2002 Insolvenz anmeldete, wo aber jetzt ein Spaßbad eingerichtet wurde, „die schillernde Raumkapsel des Erlebnisparks Tropical Island“. Zutritt für 53,90 EUR pro Person. Umnutzungen von ehemaligen Militär- und Industrieanlagen sind nicht ungewöhnlich. Eigentlich. Manja Präkels: „Die lange Tradition der heute verlassenen Truppenübungsplätze reicht vom Kaiserreich über die faschistische Wehrmacht bis hin zur Roten Armee. Schlachtfelder unter Sand, Gras und niedrigen Bewuchs – Explosionsgefahr. Aus der Asche bricht Mischwald hervor. Als wäre keine Zeit vergangen.“ Die „Explosionsgefahr“ darf durchaus als Metapher gelesen werden. Man könnte sogar von Wiederholungszwang sprechen. Alexander Leistner: „Zumal sich die Debatten um, aus und über Ostdeutschland mit ihren abgegriffenen Bezichtigungs- und Erklärungsfloskeln schon seit Jahren zunehmend im Kreis drehen.“ Manja Präkels zitiert Ernst Friedrich, Gründer des weltweit ersten Kriegsmuseums. Er „nannte uns Menschen Vergessmaschinen“. Manche vergessen so intensiv, dass sie sich wünschen, dass doch „die Freunde“ wiederkommen sollten, „Putin würde das schon regeln“ (auf PEGIDA- und später auf Querdenker-Demonstrationen waren Schilder mit der Aufschrift „Putin hilf“ zu sehen). Kein Wunder, dass in einem Vortrag in Wünsdorf, wo nach den Nazis das Oberkommando der sowjetischen Streitkräfte in Deutschland residierte, auch gefragt wird, ob der Truppenabzug nicht doch ein Fehler gewesen wäre.
Erzählungen von Glück und Unglück
Thomas Mann schrieb in einer Zeit, in der man ihn noch nicht als Demokraten kannte und bewunderte, im Jahr 1918, in den „Betrachtungen eines Unpolitischen“: „Der Geschmack eines Volkes an der Demokratie steht im umgekehrten Verhältnis zu seinem Ekel vor der Politik.“ Etwas über 30 Jahre später fragte er sich in „Meine Zeit“, „ob der Mensch um seiner seelischen und metaphysischen Geborgenheit willen nicht lieber den Schrecken will als die Freiheit.“ Diese beiden Sätze sind Gegenstand der Ausstellung „Meine Zeit“ in Lübeck zum 150. Geburtstags von Thomas Mann. „Ekel“ – das ließe sich noch steigern, durch Ohnmacht, Wut und eben Gewalt. Darüber ließe sich reden, davon ließe sich erzählen, allerdings wären das keine Heldengeschichten. Ursula K. Le Guin schreibt in „The Carrier Bag of Fiction” (zitiert nach der von Donna Haraway eingeleiteten Ausgabe von 2024 bei cosmogenesis), Geschichten enthielten eigentlich keine Helden, sondern Leute („people“). Donna Haraway kommentiert: „It matters what stories we tell to tell other stories with; it matters what concepts we think to think other concepts with.” Wenn wir etwas sagen oder schreiben, meinen wir immer irgendetwas Anderes mit, das sich möglicherweise mit der Zeit verselbstständigt.
Wenn man die Thesen von Thomas Mann, Ursula K. Le Guin und Donna Haraway auf Deutschland im Jahr 2025 anwenden möchte, findet man Zugang zu Geschichten, die festgefügt, fast schon unwandelbar einander gegenüberstehen, oft allerdings eher im Modus der Anklage. Das gilt selbst für etablierte Autor:innen wie den immer wieder zitierten Ilko-Sascha Kowalczuk. In seinem Grundlagenwerk „Die Übernahme – Wie Ostdeutschland Teil der Bundesrepublik wurde“ (München, C.H. Beck, 2019) suggeriert schon der Titel, in welche Richtung aus seiner Sicht erzählt werden soll. Kowalczuk argumentiert differenzierter, aber die Rezeption ist eindeutig. Diejenigen, die von der Geschichte der DDR und der sogenannten „Transformationszeit“ erzählen, haben ein festgefügtes weitgehend binäres Bild von sich, vom Osten wie vom Westen. Christina Morinas „1000 Aufbrüche“ könnten ein Gegenbild bieten, doch dürften viele dieser „Aufbrüche“ von manchen wegen der vielen enttäuschten Hoffnungen eher als Abbrüche, Abbruch oder etwas neutraler als „Umbruch“ gelesen werden.
„Aufbruch“, „Umbruch“, „Transformation“ – diese Begriffe erwecken den Eindruck, als müsste, sollte, würde sich irgendwer nicht immer aus freien Stücken von irgendwoher irgendwohin bewegen, wo er oder sie vorher nicht war. Demnach gäbe es Geschichten einer Ankunft beziehungsweise eines Verfehlens des eigentlichen Ziels. Wer das Ziel verfehlt, trägt selbst zumindest einen Teil der Schuld. Man hat sich eben ge- oder verirrt. „Übernahme“ oder „Kolonisierung“ betonen hingegen ausschließlich Passivität und Ohnmacht der angeblich Übernommenen oder Kolonisierten. Hinter all diesen Metaphern steckt jedoch immer ein Bild vom Anderen, eine VerAnderung (Julia Reuter übersetzte so den Begriff des „Othering“) desjenigen, der eben nicht dort ist, wo man selbst ist und deswegen nicht zu der Gruppe gehören kann, zu der man sich selbst zählt. Das gilt für den Westen wie für den Osten.
Der Westen ist nicht der ultimative Telos der Geschichte an sich, keine Norm, kein potenzielles „Ende der Geschichte“, wenn man Francis Fukuyamas berühmt-berüchtigten Gedanken zitieren möchte. Niemand muss irgendwo ankommen, niemand muss sich irgendwohin bewegen. Zunächst wäre einfach nur zu analysieren, wer sich eigentlich wo befindet. Abgesehen davon ist „Demokratie“ kein Ort, sondern eine Regierungsform. Ein Ort wird sie erst, wenn sie mit dem „Westen“ identifiziert wird, etwas, das der Osten (noch) nicht erreicht habe. Thorsten Holzhauser, Geschäftsführer der Stiftung Bundespräsident-Theodor-Heuss-Haus, formulierte in seinem Essay „Vom ‚Osten und vom Ankommen in der Demokratie“ (in der Ausgabe des Merkur vom Oktober 2025) folgendes Fazit: „Für das Bild vom ‚Ankommen in der Demokratie‘ lässt sich aus dieser Sicht zweierlei schlussfolgern: Entweder die Ostdeutschen können gar nicht ‚in der Demokratie ankommen‘, genauso wenig übrigens wie die Westdeutschen, weil es die Demokratie in dieser idealisierten von Konflikten bereinigten Form nicht gibt, oder sie sind längst angekommen, nur ist die moderne Demokratie eben nicht so rein und unschuldig und konfliktfrei, wie wir das gerne hätten.“ Das wäre die versöhnliche Version der Geschichte. Wer jedoch darauf beharrt, dass „Ankommen in der Demokratie“ zunächst eine ostdeutsche Bringschuld wäre, definiert den Osten ausschließlich „durch Defizitbeschreibungen“. Dies wäre in der Tat diskriminierend. Als Antwort folgt geradezu zwangsläufig eine ostdeutsche „Identitätskonstruktion“, deutlich zu hören beispielsweise in ostdeutschen Fußballstadien, wenn die Fans dort „Ostdeutschland“ skandieren, oder wenn sich Menschen DDR-Zustände zurückwünschen. Aber gleichviel: „Unzufriedenheit und Protest, Demokratieskepsis und Elitenkritik, autoritäre und rassistische Einstellungen, Rechtsextremismus und Populismus werden in beiden Deutungsmustern zum Kennzeichen Ostdeutschlands.“
Radikalisierungsprozesse gibt es in Ost und West und dennoch sind Ost und West jeweils keine in sich geschlossenen und klar voneinander abgrenzbaren Großgebiete. Es gibt eine Fülle von Zwischentönen oder wenn man so will Grautönen. Das Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung Dortmund (ILS) hat im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung mögliche Zusammenhänge mit dem Zustand der Infrastruktur beziehungsweise der Daseinsvorsorge mit Radikalisierungsprozessen untersucht. Der Wirtschaftsgeograph Bastian Heider bietet im Gespräch mit Ulrike Nimz von der Süddeutschen Zeitung einen Überblick. Es gehe allerdings um. „Korrelationen“, nicht um Kausalitäten“. Ein Ergebnis: „Dass es Zusammenhänge zwischen dem Zustand der Daseinsvorsorge und dem Grad der Demokratiezufriedenheit gibt. Das gilt vor allem für Bildungschancen, Kinderbetreuung und Breitbandausbau, aber auch für objektiv nur schwer messbare Faktoren wie die Lebendigkeit von Ortszentren. Wenn es Räume für sozialen Austausch gibt, Kinder gut betreut und ausgebildet werden, es schnelles Internet gibt, auch als Voraussetzung für die Ansiedlung von Firmen, dann ist das ein Ausweis der Zukunftsfähigkeit und begünstigt einen optimistischen Blick in die Zukunft. Funktioniert all das nicht, wächst der Frust.“ Eine große Rolle spiele aber nicht zuletzt angesichts der zahlreichen aufeinanderfolgenden Transformationserfahrungen vieler Menschen – nicht nur in Ostdeutschland – auch ein Gefühl von „Bedeutungsverlust“, kombiniert „mit einer persönlichen Abwertungserfahrung“.
Mitunter möchte man sich an „Die Unfähigkeit zu trauern – Grundlagen kollektiven Verhaltens“ von Alexander und Margarete Mitscherlich aus dem Jahr 1967 erinnern. Es war die Zeit der ersten Großen Koalition und bedrohlicher Wahlergebnisse der NPD. Heute leben wir in einer Zeit mehr oder weniger dauerhafter nicht mehr ganz so großer Koalitionen, es sei denn, wir addieren die Grünen bei den Wahlergebnissen von CDU, CSU und SPD einfach dazu. Unplausibel wäre das nicht. Die Wahlergebnisse der AfD sind bekannt. Thorsten Holzhauser konstatiert: „Der Prozess ostdeutscher Identitätskonstruktion ist aus dem linken in den rechten Diskurs gewandert und hat sich dort entsprechend verformt.“
August Modersohn, Autor des Reportagenbuchs „In einem neuen Land“ (Berlin, Propyläen, 2025), hat zum 3. Oktober 2025 in der ZEIT einen Essay veröffentlicht, der die Frage stellt: „Wie kommen wir da wieder raus?“ In der Anmoderation provoziert er: „Vor 35 Jahren hatte Deutschland die Chance, sich neu zu erfinden. Viele hofften, träumten auch. Heute hat nur noch die AfD Visionen.“ Kaum jemand traut, wenn man den gängigen Umfragen glauben will, der AfD zu, dass sie die Krisen unserer Zeit lösen könne, aber alle anderen Parteien machen ihr es leicht so zu tun, als sei sie die Lösung: „Zukunft ist gerade ein Wort, bei dem viele zusammenzucken. Zukunft bedeutet Angst, Schrecken, Dunkelheit, in jedem Fall nichts Gutes. Es gibt aber eine Partei, die offensiv mit dem Begriff umgeht, und zwar die AfD. ‚Vision 2026‘, so hat sie ihre Kampagnenwebsite für die Wahl in Sachsen-Anhalt im kommenden Jahr genannt, wo sie sich Hoffnung macht, das erste Mal einen Ministerpräsidenten zu stellen. Was die anderen Parteien natürlich verhindern wollen.“ (Das, was die AfD als Vision anbietet, klingt durchaus ähnlich wie das Projekt 2025 der Heritage Foundation, nach dessen Muster Donald Trump zurzeit die USA entdemokratisiert.)
Alleine mit der mantrahaften Beschwörung der Demokratie kommen wir nicht weiter. Einer der Gesprächspartner von August Modersohn erweitert den Blick: „Langsam werde aber deutlich, dass nicht nur die DDR zu Ende gegangen ist, sondern auch diese Idee der Bonner Republik nur mehr eine Illusion sei. Die Politiker simulierten jedoch immer noch: Wird schon wieder. ‚Nur wird es immer schwieriger, das Problem einzufangen. Im Osten zeigt sich manches ja früher, und hier sieht man, dass es sich nicht nur um Erosionsprozesse handelt, sondern um Fliehkräfte.‘“ Bürgerräte könnten Selbstwirksamkeit fördern. Elisabeth Kaiser, Ostbeauftragte der Bundesregierung, „sagt, sie fände es gut, ‚wenn wir mal regional begrenzt ausprobieren, die Ergebnisse der Bürgerräte tatsächlich rechtlich bindend zu machen, in einem Landkreis im Osten zum Beispiel‘. Man könnte dafür die Kommunalordnung ändern. ‚Das würde ich gerne intensiver diskutieren als einen Baustein, um das Vertrauen in die Demokratie wieder zu stärken.‘“ Das wäre sicherlich ein Mittel gegen den „Ekel vor der Politik“, den Thomas Mann diagnostizierte und der die gesamte rechte Szene – und nicht nur diese – zu durchziehen scheint. „Selbstwirksamkeit“ erleben die Akteure dieser Szene geradezu in der Reaktion der demokratischen Parteien und der Medien auf ihren Krawall. Das ist aber nicht die „Selbstwirksamkeit“, die ein Land voranbringen könnte, sondern eben rein destruktiv.
Die Autor:innen der drei in diesem Essay vorgestellten Bücher und die vielen kleinen Initiativen und Einrichtungen, die den rechtspopulistisch-extremistischen Mainstream aufhalten wollen, wirken mitunter, als wollten sie mit einem Fingerhut ein Meer ausschöpfen. Entscheidend ist jedoch – und das zeigen alle drei Bücher –, wer wem welche Geschichten erzählt und wer bereit ist, wem zuzuhören. André Herzberg, Sänger der Band „Pankow“, die jetzt ihre Abschiedstournee abgeschlossen hat, hat in der Jüdischen Allgemeinen vom 3. Oktober 2025 seine persönliche Vision formuliert: „Die DDR war eine Diktatur, und jeder, der in dieser Diktatur gelebt hat, muss mit diesen Erfahrungen umgehen, weil man damit geboren wurde und kein anderes Leben kannte. (…) Dann kam ein wahnsinniger Bruch. Da musste man diese Freiheit neu lernen. Das sind vielleicht zwei dürre Sätze auf das große Thema. Wie ist es, Identität neu zu erfahren? Das ist ein schwieriger Lernprozess. Psychoanalytiker haben gesagt: Lernen oder Erfahrungen geht nicht ohne Trauer und so ein Sich-in-sich-selbst-Zurückziehen. Das ist ein sehr schmerzafter und langer Prozess für mich gewesen.“ Die Überschrift seines Statements lautet: „Ein großes Glück“. Vielleicht ist das ein Fazit im Einheitspuzzle und ein erster Schritt zur Verknüpfung der vielen ver- und zerstreuten Elemente des Gesamtbildes in, von und für Deutschland.
Norbert Reichel, Bonn
(Anmerkungen: Erstveröffentlichung im Oktober 2025, Internetzugriffe zuletzt am 7. Oktober 2025. Titelbild: Landschaft bei Bestensee, Landkreis Oder-Spreewald, Foto: NoRei.)