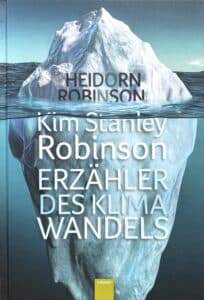Den Klimawandel erzählen
Neue narrative Strategien der Climate Fiction
„Es ist äußerst schwierig, in einer Zeit über Klimawandel und Zukunft nachzudenken, in der der Horizont durch so viele gleichzeitige und miteinander verbundene Krisen finster verhangen ist.“ (Birgit Schneider, Der Anfang einer neuen Welt – Wie wir uns den Klimawandel erzählen, ohne zu verstummen, Berlin, Matthes & Seitz, 2023)
Folgt man den Feuilleton-Debatten der letzten Jahre, dann scheint der Klimawandel noch keinen wirklichen Widerhall in der zeitgenössischen Literatur gefunden zu haben: „Warum gibt es fast keine Romane, die von der ökologischen Katastrophe handeln, die uns wiederfährt und die wir sind, die sich bislang ungebremst entfaltet und so oder so das Leben der Menschen zutiefst verändern wird, nein: schon lange verändert?“, schreibt Bernd Ulrich im Oktober 2021 in der ZEIT. Und noch 2023 behauptet der Sozialwissenschaftler Steffen Vogel in den Blättern für deutsche und internationale Politik, „dass der Klimawandel weder in der Breite noch in der Spitze der Literaturszene angekommen“ sei.
Wie man bei allen Bäumen den Wald doch noch entdecken könnte…
Derartige Aussagen scheinen obsolet, sieht man sich die Vielzahl der in den letzten Monaten veröffentlichten Romane und Erzählungen an, in deren Zentrum der Klimawandel und seine Auswirkungen stehen. Versteht man unter der sogenannten Climate Fiction, wie dies auch Axel Goodbody und Adeline Johns-Putra tun (in der Einleitung des von ihnen herausgegebenen Bandes “Cli-Fi – A companion”, Oxford, New York, Peter Lang, 2019): Cli-Fi – A Companion tun, einen „significant body of narrative work broadly defined by its thematic focus on climate change and the political, social, psychological and ethical issues associated with it”, lässt sich zudem eine erstaunlich lange Literaturgeschichte der Climate Fiction und Proto-Climate-Fiction nachzeichnen. (Ähnlich argumentieren Gregers Andersen, in „Climate Fiction and Cultural Analysis – A New Perspective on Life in the Anthropocene”, New York, Routledge, 2020 und Adam Trexler, “Anthropocene Fictions – The Novel in a Time of Climate Change”, University of Virginia 2015.)
Die Frage sollte demnach nicht lauten: Warum gibt es so wenig Literatur, die den Klimawandel aufgreift und zu beschreiben versucht? Vielmehr gilt es, den Blick dafür zu schärfen, wie die Climate Fiction ein so globales und komplexes Thema wie den Klimawandel überhaupt erzählt. Welche neuen narrativen Szenarien werden dabei entworfen? Gegen welche eingefahrenen und dem Klimawandel-Diskurs abträglichen Narrative schreibt die Climate Fiction zugleich an? Welche Funktion und Bedeutung können diese literarischen Werke für den allgemeinen Klimadiskurs besitzen? Kann die Climate Fiction aufgrund ihrer Vielfältigkeit und Imaginationskraft die Wahrnehmung schärfen beziehungsweise eine neue Sensibilität erzeugen, die unter anderem in Kritik und Handeln umgesetzt werden kann?
Wie auch Birgit Schneider konstatiert, ist die „kreative Vielfalt im Erzählen jenseits der Wissenschaft (…) ein wesentlicher Bestandteil des Weges hin zu einer Ermächtigung, die zum Handeln führen kann. Denn um den Mut aufzubringen, die Hoffnungen auf eine Rettung der alten Welt fahren zu lassen, brauchen wir in einer Zeit der multiplen Krisen Erzählungen. Und wir benötigen das szenische Denken, wobei es nicht darum gehen kann, alles von einem Standpunkt aus zu erzählen, sondern anhand vieler unterschiedlicher Standpunkte.“
In diesem Sinne schreibt auch die Literatur- und Kulturwissenschaftlerin Eva Horn (in: „Zukunft als Katastrophe, Frankfurt am Main, S. Fischer, 2014), dass in „einer Gegenwart, die von höchst diffusen Zukunftsszenarien und einer drohenden Katastrophe ohne Ereignis geprägt ist, (…) Fiktionen eine Form [sind], das Unvorstellbare in eine greif- und erfahrbare Gestalt zu bringen.“ Fiktionen, so Eva Horn, „bringen etwas aus der Latenz hervor, sie erschaffen etwas Erzähl-, Darstell- und Erlebbares, eine konkrete, modellhafte Situation, in der die ungreifbare und bedrohliche Zukunft greifbar und damit auch affektiv bearbeitbar wird. Im Narrativ, im exemplarischen Beispiel oder exzeptionellen Einzelschicksal, in der kurzen, aber prägnanten Szene oder im erhabenen Bild kann die drohende Zukunft zum Gegenstand eines subjektiven Bewusstseins und eines individuellen Affekts werden.“
Kim Stanley Robinson beschreibt insbesondere die Funktion von Science-Fiction-Literatur in einem Interview mit Fritz Heidorn wie folgt: „Fiktionale Erfahrungen sind in dem Sinne reale Erfahrungen, dass sie stark genug sind, um mentale Auswirkungen zu haben. Sie fühlen sich so an, als hätte man die Dinge, von denen der Roman erzählt, erlebt. So fühlt es sich für mich an. Ganz eindeutig kann also das Schreiben von Science-Fiction, die ein Leben in noch nicht-existierenden Stadien des Klimawandels schildert, Menschen dabei helfen, sich diese vorzustellen; und das könnte Verhaltensänderungen bewirken, die dann die bevorstehenden Schäden reduzieren. Ich hoffe es. Einen Versuch ist es wert. (…) Für mich stellt die Rezeption von Literatur immer eine Übung dar, sich in andere hineinzuversetzen, also eine Übung, um die eigene Empathie zu steigern (…). “
Insofern ist, wie der Kognitionswissenschaftler und Germanist Fritz Breithaupt (in: „Das narrative Gehirn – Was unsere Neuronen erzählen“, Berlin, Suhrkamp, 2022) konstatiert, „das narrative Denken ein großartiges Medium des Erlebens und Planens.“
„Green Narrative New Deal“
Doch damit nicht genug: Wie Samira El Quassil und Friedmann Karig in ihrem Buch „Erzählende Affen. Mythen, Lügen, Utopien – Wie Geschichten unser Leben bestimmen“ (Berlin, Ullstein, 2021) zeigen, hat eine Literatur, die von Gefahren und Möglichkeiten des Klimawandels erzählen möchte, zugleich gegen eine Vielzahl an festgefahrenen Narrativen anzuschreiben: Die Climate Fiction könne den Kampf gegen den Klimawandel nicht mehr so einfach als die Reise eines Einzelhelden darstellen, da die Probleme, die der Klimawandel mit sich bringt, nur im Kollektiv sowie zum Beispiel auf politischer und institutioneller Ebene lösbar erscheinen. Samira El Quassil und Friedmann Karig plädieren dafür, uns bessere und andere Geschichten zu erzählen, die weniger das individuelle Heldentum hervorheben und damit der Komplexität der Gegenwart gerecht werden. Doch: „Wie erzählt man eine Heldenreise rund um kollektive Verhaltensänderungen oder supranationale Anstrengungen?“ Als „glaubhafte Helden“ könnten dabei, laut El Quassil und Karig, „am ehesten die Agenten positiver gesellschaftlicher Kipppunkte hin zu einer nachhaltigeren Welt (Wissenschaftlerinnen, Politikerinnen, Aktivistinnen)“ fungieren.
Dass auffällig viele Climate-Fiction-Romane und -Erzählungen sowohl institutionelle Einrichtungen (Forschungslabore, Ministerien, Konzerne etc.) und ihre Akteure als auch die Protagonisten aktivistischer Bewegungen in den Fokus stellen, mag seine Ursache in dieser erzählerischen Problematik haben. Dieser erzählerische Kniff bietet auch die Möglichkeit, Fiktionen mit zum Beispiel wissenschaftlichen Fakten zu mischen sowie zugleich Möglichkeiten des aktiven Widerstands auszuloten. Damit schreibt die Climate-Fiction-Literatur – so El Quassil und Karig – auch gegen ein Gefühl der Resignation an, das besagt: Was kann ich schon ausrichten gegen das Voranschreiten der Klimakrise? Sie plädieren für einen „Green Narrative New Deal“ mit „neuen, ökologisch aufgeladenen Erzählungen“, die die Menschen für die Gefahren des Klimawandels sensibilisieren und damit „zu vernetzten Protagonistinnen einer Heldinnenreise wandeln. Jedes narrative Selbst im 21. Jahrhundert muss zwingend diese existenzielle Krise der Menschheit in eine positive Erzählung gießen können. Die Alternativen dazu sind nur Verdrängung oder Verzweiflung. (…) Nichts weniger als die Rettung der Welt in kleinen Schritten zu erzählen ist heute wichtiger denn je.“
Für El Quassil und Karig ist diese „Absage an althergebrachte Erzählmuster“ ein bedeutender Schritt, um eine Vielzahl an Miseren, die unsere Gesellschaft prägen (wie zum Beispiel Antisemitismus, Rassismus, Faschismus, Umweltverschmutzung und Geschlechterungerechtigkeit), zu beseitigen.
Wütender Optimismus: Kim Stanley Robinson „Das Ministerium für die Zukunft“
Das Werk des amerikanischen Autors Kim Stanley Robinson ist schon seit Anbeginn seiner schriftstellerischen Karriere davon geprägt, die Auswirkungen des Klimawandels und mögliche Zukünfte zu schildern. Aber insbesondere sein Roman „Das Ministerium für die Zukunft“ (München, Heyne, 2021) macht in seiner Komplexität und der Mischung von verschiedenen Schreibweisen sehr deutlich, was für ein vielstimmiges Textgeflecht oftmals notwendig ist, um sowohl die Globalität, Komplexität und Abstraktheit des Klimawandels beschreiben zu können, als auch Möglichkeiten des aktiven Widerstands zu schildern.
Dazu nutzt Robinson eine Vielzahl an Erzählperspektiven und Schreibweisen, um den Leser viele Sichtweisen und Sachinformationen aufzeigen zu können.
Primäre und tragende Hauptfiguren des Romans sind Mary Murphy, Leiterin des sogenannten Ministeriums für die Zukunft, das 2025 von den Vereinten Nationen in Zürich gegründet wird, und der Entwicklungshelfer Frank May, einziger Überlebender einer Hitzewelle in Indien. Hinzu tritt im Laufe der Handlung jedoch eine Vielzahl an Protagonisten, die zum Beispiel aus den Bereichen Politik und Wissenschaft stammen. Durch diese multiperspektivische Erzählhaltung schafft es Robinson, mehrere unterschiedliche Sichtweisen und Aspekte für den Leser transparent zu machen.
Zudem lässt Robinson auch die Stimme von aktivistischen Bewegungen in den Roman einfließen, indem er die Formierung von gewalttätigem Widerstand beziehungsweise von Ökoterrorismus schildert. Geschickt greift Robinson dabei auch die Frage auf, wie weit der Widerstand gehen dürfe, wenn im Roman Flugzeuge durch Drohnenangriffe zum Absturz gebracht, mit Schweröl betriebene Schiffe versenkt und Unternehmensführer der fossilen Energieindustrie exekutiert werden, im Grunde eine in der Science Fiction durchaus gängige Variante des in juristisch-ethischen Debatten kontrovers debattierten Trolley-Problems.
Geschickt mischt Robinson faktuales und fiktionales Erzählen, indem er auf verschiedene Art und Weise immer wieder Sachinformationen in die literarische Form einbindet. Dergestalt finden sich im Roman zum Beispiel auch Protokolle aus dem Ministerium für die Zukunft oder sachbuchartige bzw. enzyklopädisch wirkende Einträge, die wichtige Aspekte des Klimawandels verdeutlichen.
Damit schafft Robinson die Möglichkeit, im Rahmen eines literarischen Textes nicht nur die Folgewirkungen des Klimawandels anzusprechen, sondern auch Möglichkeiten zur technischen und wirtschaftlichen Bewältigung des Klimawandels aufzuzeigen: Robinson nennt dabei u.a. Geo- und Climate-Engineering, Konsumverzicht, Carboncoins zur CO2-Einsparung, Stärkung von genossenschaftlichen Strukturen, integrative Landwirtschaft, datenökonomische Veränderungen etcetera.
Robinsons Werk ist von einem „angry optimism“ geprägt, der dadurch gekennzeichnet ist, trotz krisenhafter Zeiten, an eine wie auch immer geartete, vielleicht sogar bessere Zukunft zu glauben. In seinem Roman „Das Ministerium der Zukunft“ spiegelt sich dieser positive Blick in die Zukunft vor allen Dingen in der Tatsache, dass die Gesellschaft trotz aller Widerstände gemeinschaftlich daran arbeitet, dass die Zukunft nicht dystopisch wird. Wie die Vielstimmigkeit in diesem Roman deutlich hervorhebt, ist das Gestalten einer zukünftigen Welt nur durch das Bündeln beziehungsweise Zusammenwirken vieler Kräfte, die Nutzung wissenschaftlicher Erkenntnisse und die Erprobung einer Vielzahl an Ideen möglich. Der Roman zeigt damit auch, dass der Klimawandel nur von einer – wie auch immer gearteten – global vernetzten Bewegung und nicht von Einzelpersonen aufgehalten werden kann. Damit setzt sich Robinson auch von den oftmals üblichen Heldengeschichten ab, in denen eine Person oder eine kleine Gruppe von Menschen die Krisen und Probleme in dieser Welt quasi im Alleingang bewältigen und damit die ganze Menschheit retten.
Klima-Aktivismus und Gewalt: Theresa Hannig „Parts Per Million“
Auch Theresa Hannig stellt in ihrem Roman „Parts Per Million – Gewalt ist eine Option“ (Frankfurt am Main, Fischer Tor, 2024) die Möglichkeiten und Gefahren, die von einem Klima-Aktivismus ausgehen, in den Mittelpunkt: Wenn die politischen Entscheidungsträger nicht dazu bereit sind, notwendige Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandel zu treffen, ist es dann legitim, auch gewalttätigen Widerstand zu leisten? Und wie weit darf wiederum die stattliche Gewalt gehen, um diesen Widerstand einzudämmen? Ausführlich spricht sie über das Dilemma dieser Fragen in dem Interview mit Norbert Reichel „Die Climate Fiction und die Politik“.
Die Frage, wie weit Widerstand gehen darf, durchzieht die Gewaltdebatten im aktivistischen Milieu, so zuletzt auch belegt in dem Buch „Wie man eine Pipeline in die Luft jagt – Kämpfen lernen in einer Welt in Flammen“ von Andreas Malm (Berlin 2022). Daher lässt Theresa Hannig ihre Protagonistin Johanna Stromann tief in das aktivistische Milieu eintauchen. Von einer Beobachterin und engagierten Literatin, die einfach für einen neuen Roman recherchiert, wandelt sich Stromann im Laufe der Handlung zu einer Aktivistin, die bereit ist, auch Gewalt anzuwenden, im Grunde beschreibt sie „das Ulrike-Meinhof-Syndrom“ (Norbert Reichel). Wie Theresa Hannig im Nachwort des Romans hervorhebt, war Kim Stanley Robinsons Roman „Das Ministerium für die Zukunft“ eine Inspirationsquelle, da Robinson dort eine Terrororganisation namens „Children of Kali“ beschreibt, die durch gewalttätige Aktionen die Politik dazu zwingen will, endlich Maßnahmen gegen den Klimawandel zu ergreifen.
Dabei war, wie Theresa Hannig ebenfalls im Nachwort des Romans erklärt, der Versuch, anhand der Figur von Johanna Strohmann die „Geschichte einer Radikalisierung“ darzustellen, ein „äußerst schmerzhafter Prozess“: „Mich jahrelang mit der Klimakrise zu beschäftigen war erschreckend und desillusionierend. Mich dann auch noch in die sich radikalisierende Hauptperson hineinzuversetzen war ein abenteuerlicher Eskapismus, der mit Fortschreiten des Buches aber immer belastender wurde. Vielleicht ist der Prozess des Schreibens an dieser Stelle am besten mit dem Method Acting zu vergleichen. Ich beschäftige mich mit der Figur, versetzte mich in ihre Position, fühlte ihre Gefühle spielte ihre Gedanken und Handlungen durch und beschrieb sie am Ende so wahrhaftig wie möglich.“
Es ist genau dieses schmerzhafte Hineinversetzen in die Hauptfigur, das auch bei den Leserinnen und Lesern ein Mitgefühl erzeugt, das weit über wissenschaftliche Abhandlungen hinausreicht. Zugleich rüttelt die scheinbare Ausweglosigkeit, die dem Roman „Parts Per Million“ eingeschrieben ist, die Rezipientinnen und Rezipienten auf und sensibilisiert sie für die gefahrvollen Entwicklungen, die sowohl die Klimakrise als auch die staatliche Gewalt sowie der Ökoterrorismus mit sich bringen.
Hybrid-Werden / Tier-Werden / Pflanze-Werden: Lisa J. Krieg und Zara Zerbe
In dem Roman „Drei Phasen der Entwurzelung – Oder die Liebe der Schildkröten“ (Aachen, Wortschatten, 2022) der promovierten Ethnologin Lisa J. Krieg verbindet sich der Klimawandel-Diskurs mit dem Thema moderne Biotechnologien: Eine Klimakatastrophe hat dazu geführt, dass die Menschheit genetische Experimente durchführt. Nachdem diese Manipulationen zu einem genetischen Kollaps (Rückgang der Geburtenrate, hohe Säuglingssterblichkeit etcetera) geführt hat, macht man sich daran, defekte menschliche Embryos mit der DNA von zum Beispiel Meerestieren zu kreuzen und damit zu reparieren. Diese stetig voranschreitenden Hybridisierungsprozesse bzw. diese Hybrid-Wesen spalten die Gesellschaft und führen zu sozialen Spannungen und Aufständen. Die sogenannten „Anti-Hybrider“ sind fest davon überzeugt, dass die „Hybridforschung (…) eine Verwischung der Grenzen zwischen den natürlichen Arten“ unterstützt und damit „die Auslöschung der Menschheit“ aktiv vorantreibt. In ihrer Fremdartigkeit werden die Mischwesen als nicht-menschlich und minderwertig angesehen, obwohl sie aufgrund ihrer genetischen Ausstattung auch den Ozean als neuen Lebensraum erobern können. Das Hybrid-Werden der Menschheit scheint zugleich ein gangbarer Weg zu sein, neue Daseinsweisen zu erproben, die vielleicht dazu führen, das Überleben zu sichern.
Im Fokus der Handlung steht die Meeresbiologin Anna Hoareau, die nur einen geringen Anteil an hybriden Genen besitzt und an einem Institut in Eilat daran arbeitet, den genetischen Kollaps aufzuhalten. Zugleich erzählt Lisa J. Krieg die Geschichte einer Familie und einer Metamorphose, die vom Festland in die Tiefen des Ozeans und wieder zurück zum Festland führt.
Dabei lassen sich diese Prozesse des Werdens, des Verschmelzens und der Transformation, die dem Roman seine Form geben, mit den theoretischen Arbeiten der amerikanischen Wissenschaftshistorikerin, Biologin und Geschlechterforscherin Donna Haraway vergleichen: Haraway hat in vielen Aufsätzen dafür plädiert, das nicht-menschliche Andere systematisch in alle Betrachtungen und Handlungen mit einzubeziehen und dabei die ethische, politische und auch epistemologische Bedeutung des nicht-menschlichen Anderen hervorzuheben. Gerade in Zeiten ökologischer Verwerfungen bekommt Haraways These, dass die menschliche Existenz als biosozial zu denken ist und wir damit (immer schon) durchdrungen sind von dem heterogenen Anderen, eine immense Bedeutung zu. Haraway sieht in dieser post-anthropologischen Vorstellung zudem das Potential, neue Verwandtschaftsverhältnisse zu etablieren, um damit zugleich radikale Transformationsprozesse zu initiieren (ausführlich in ihrem Buch „Unruhig bleiben – Die Verwandtschaft der Arten im Chthuluzän“, Frankfurt am Main, Campus, 2018).
Von diesen radikalen Transformationsprozessen erzählt auch die Literatur und Medienwissenschaftlerin Zara Zerbe in dem Roman „Phytopia Plus“ (Berlin, Verbrecher Verlag, 2024): In der nahen Zukunft bestimmen unerträgliche Hitze und lange Dürreperioden das Leben auf der Erde. Zwar gibt es spezielle Siedlungen, die Schutz bieten vor den Folgen des Klimawandels, doch diese komfortablen Schutzräume können sich nur reiche Menschen leisten. Auch das Verfahren, das „Bewusstsein aus dem Gehirn herauszukopieren und in Pflanzenzellen zu speichern“, kann nur von Menschen in Anspruch genommen werden, die genügend Geld besitzen. Für dieses Verfahren, das den Namen „Heterözie“ (den Begriff hat die Autorin erfunden) trägt, wird, wie der ominöse Dr. Fichte im Roman ausführt, das menschliche Bewusstsein „in einen Datensatz umgewandelt und an die Histone der Trägerpflanze angedockt. Wir haben dafür einen speziellen Biochip entwickelt. Der wird in Ihrem Neocortex, also in der Hirnrinde, implantiert. Nach Ihrem Tod setzen wir diesen Biochip in das Scheitelmeristem einer Pflanze Ihrer Wahl ein. Das ist der Gewebeteil von Pflanzen, an dem Zellteilung und damit das Wachstum stattfindet. Vorher legen wir selbstverständlich ein Backup Ihres Datensatzes auf einem unserer Server an, obwohl die Datensicherheit auf unseren Pflanzenspeichern im Fall eines Blackouts deutlich höher ist als in einem anorganischen Datacenter, aber eine doppelte Absicherung hat ja noch niemanden geschadet. Und wir erstellen ein Abbild Ihres Konnektoms, also einen Netzplan Ihrer Synapsen, das in den Zellvakuolen gespeichert sein wird.“
Die Protagonistin Aylin arbeitet, stetig überwacht von einer KI, im Hamburg des Jahres 2040 als Aushilfsgärtnerin in der Drosera AG. Ihre Arbeitsstätte ist eines der Gewächshäuser, in denen man nach dem Tod sein Bewusstsein in der DNA von Pflanzen speichern lassen kann. Eingewoben in den Romanverlauf sind immer wieder kurze Abschnitte, in denen das dadurch neu entstandene Pflanzenbewusstsein zur Sprache kommt. Aylin würde ihrem Großvater gerne einen Speicherplatz auf einer Pflanze anbieten, aber ihre finanziellen Verhältnisse lassen dies nicht zu. Um ihre Lage etwas zu entspannen, tauscht sie mit Menschen, die besser verdienen, seltene Zierpflanzen gegen frische Lebensmittel. Plötzlich jedoch zeigen sich ungewöhnliche Muster auf den Blättern einer Speicherpflanze, die zudem ein schnelles Wachstum aufweist. Aylin schafft es, sich einen Ableger dieser Pflanze zu organisieren…
Zara Zerbe schildert in ihrem Roman Phytopia Plus eine Zukunft, in der technologischer Fortschritt und Natur verschmelzen, um den Menschen z.B. eine gewisse digitale Unsterblichkeit zu sichern. Dabei macht der Roman mehr als deutlich, mit welcher Radikalität der Mensch in die Natur eingreift, da die aufkommenden Technologien immer neue Möglichkeiten bieten.
Post-Cli-Fi: Aiki Miras Roman „Proxi”
In den Romanen liegt der Klimawandel schon längst hinter uns. Die Konsequenzen hat sie in ihrem Manifest „Post-Cli-Fi“ benannt. Er bildet vielmehr nur den Background beziehungsweise die Folie für die Beschreibung einer zukünftigen Welt, in der sich aufgrund des technologischen Fortschritts Grenzen, Identitäten, Hierarchien und Zuschreibungen schon längst aufgelöst haben und obsolet geworden sind. Dergestalt führen zum Beispiel die neuen, stark immersiven Möglichkeiten, die die Virtual-Reality-Technologie bietet, zur Ununterscheidbarkeit von Virtualität und Realität, so dass sich ganz neue Formen der Wahrnehmungs- und Daseinsweisen ausbilden. Die modernen Biotechnologien schaffen die Möglichkeit, immer radikaler in die DNA von Pflanzen, Tieren und Menschen einzugreifen, so dass bestimmte Zuschreibungen kaum noch haltbar sind. Der rasante Fortschritt im Bereich der Künstlichen Intelligenz führt auch in der literarischen Rede dazu, künstlich erschaffene Intelligenzen als Figuren agieren zu lassen.
Um dieser Entwicklung Rechnung zu tragen, bedarf es neuer Erzählstrategien, die vehement gegen die tradierten Formen anschreiben, indem sie neue (zum Teil künstliche) Identitäten erschaffen, neue Geschlechteridentitäten entwerfen, neue Daseins- und Wahrnehmungsweisen schildern und – im Sinne Haraways – neue Verwandtschaften von menschlichen und nicht-menschlichen Aktant:innen postulieren. Oder in Aiki Miras eigenen Worten: „Donna J. Haraway entwickelt in ihrem Buch STAYING WITH THE TROUBLE mit dem Prinzip der companion species, der Gefährt*innenschaft, eine Möglichkeit, die vermeintliche Einzigartigkeit des Menschen zu dekonstruieren und Menschen stattdessen in ein komplexes Geflecht aus Beziehungen zwischen humanen und non-humanen Aktant:innen einzubinden. PROXI erforscht die Gefährt:innenschaft zwischen Menschen, Landschaft, Biosynths, Insekten, Blumen, Vögeln und anderen.“
Dabei greifen Aiki Miras Romane und Erzählungen immer wieder Elemente des sogenannten Cyberpunks auf, erweitern diesen aber unter anderem um Queer- und Genderdiskurse. Diese neue „Poetik der Querness“ führt in Aiki Miras literarischen Arbeiten zu postmodernen, hybriden und fluiden Schreibweisen, die Zuschreibungen, Vereinnahmungen und Hierarchien auflösen. Verstärkt wird dieser Eindruck noch dadurch, dass Aiki Mira explizit das sogenannten „head hopping“ nutzt: Dieses stetige Hin- und Herspringen zwischen verschiedenen Charakteren (oftmals in einem Absatz oder sogar in einem Satz) gilt eigentlich als ein Fehler, der unbedingt vermieden werden soll. Bei Aiki Mira handelt es sich jedoch um einen bewussten Verstoß gegen Schreibkonventionen, der Vielstimmigkeit erzeugen sowie hierarchischen Strukturen entgegenwirken soll. Diese Ästhetik erzeugt eine gewisse Haltlosigkeit, einen gewissen Taumel. Es entsteht eine Literatur, die es schafft u.a. postanthropozentrische Beziehungen zu schildern und Post-Klima-Landschaften zu entwerfen. Dergestalt erzählt Aiki Miras neuer Roman „Proxi“ (Frankfurt, Fischer Tor, 2024) „von einer Welt, in der Menschen glauben, am Ende ihrer Geschichte angekommen zu sein. Ganze Meere sind vertrocknet, Europa ist zur Stadt geschrumpft und wird umschlossen von einer sich ausbreitenden Wüste aus Müllstrudeln. Die Wüste heißt Proto. Sie ist zugleich das Ergebnis der menschgemachten Klimakatastrophe und ein eigenständiger posthumaner Aktant. Oder präziser: Proto besteht aus vielen Kooperationen unterschiedlicher non-humaner Aktant*innen (aus Tieren, Pflanzen, Pilzen, Mikroben, Gezeiten, Prozessen…).“
Während jedoch die Climate Fiction mögliche Klimazukünfte beschreibt, handelt es sich bei der Post-Cli-Fi, wie Aiki Mira schreibt, um „ein literarisches Anliegen, um das Leben im Kollaps zu verarbeiten und aus diesen gelebten Wirklichkeiten – über das Enden hinaus! – neue Zukünfte zu generieren.” Es geht um nicht mehr und nicht weniger als um das (Über-)Leben: „In der PolyWelt“.
Markus Tillmann, Bochum
(Anmerkungen: Es handelt sich um den leicht veränderten Einführungsvortrag bei dem Kongress „Erzählte Zukünfte“ am 16. November 2024 in Bochum, der auch in der zur Tagung veröffentlichten Broschüre in einer Printfassung vorliegt. Veröffentlichung im Demokratischen Salon im Januar 2025. Internetzugriffe zuletzt am 21. Dezember 2024. Titelbild: Aiki Mira.)