Die Theaterkultur der Ukraine
Eine einzigartige Studie über 1.000 Jahre Theatergeschichte
„Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt“. (Ludwig Wittgenstein, „Tractatus Logico-Philosophicus“, 1921)
Ende des Jahres 2023 legten Forschende des Instituts für zeitgenössische Kunst der Nationalen Akademie der Künste der Ukraine – Olexander Klekovkin, Iuliia Bentia und Svitlana Kulinska – eine zweibändige Ausgabe vor, die die ukrainische Theaterterminologie aus Hunderten von Jahren vereint („Teatralna kultura Ukrajiny: materialy do istorytschnoho slownyka“ („Theaterkultur der Ukraine: Materialien zu einem historischen Wörterbuch“). Nischyn, 2023. Bd. 1: A–O, 728 S.; Bd. 2: P–Ja, 784 S.). Die Arbeit am Text des Wörterbuchs dauerte fünf Jahre; ein weiteres Jahr wurde für die Vorbereitung der Publikation benötigt. Drei dieser Jahre entfielen auf die Zeit vor der großangelegten russischen Invasion, drei weitere auf die Zeit nach ihrem Beginn. Das Werk ist inzwischen auf der Website des Forschungsinstituts für zeitgenössische Kunst frei zugänglich.
Das ukrainische Theater in der Forschung
In seinem Vorwort zu der Publikation schreibt Olexander Klekovkin: „Das Problem der ukrainischen Theaterterminologie ist ein historisches Problem, denn hinter ihr steht die Geschichte des Kampfes um eine eigene Theaterkultur – und somit um ein eigenes System von Begriffen und Termini.“ Er fügt hinzu: „Die Erforschung der Geschichte theatraler Termini – als eine eigentümliche Form der Verfremdung gewohnter Vorstellungen vom Theater – eröffnet die Möglichkeit, verborgene oder kaum wahrnehmbare, mithin schwer analysierbare Prozesse in der Geschichte der Theaterkultur sichtbar zu machen und über die gewohnten Grenzen von Hagiografie und Ranglisten hinauszugehen. Auf diese Weise lässt sich die Abhängigkeit von gängigen ideologischen und ästhetischen Klischees überwinden. Insgesamt schafft die Untersuchung der Geschichte theatraler Termini – sowohl inhaltlich als auch im Hinblick auf die Geschlossenheit einzelner Terminologiesysteme – die Voraussetzungen für eine radikale Neubewertung des Gegenstandsfeldes und des methodologischen Instrumentariums der Theaterwissenschaft in der Ukraine“.
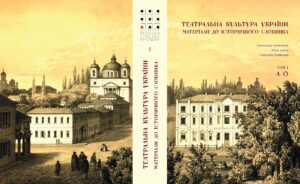 Die Autor:innen der Arbeit „Theaterkultur der Ukraine: Materialien zu einem historischen Wörterbuch“ haben die im ukrainischen Theater von seinen Anfängen bis in unsere Zeit gebräuchlichen Termini und Begriffe gesammelt und systematisiert und auf der Grundlage dieses historischen Wörterbuchs die Besonderheiten der ukrainischen Theaterkultur sowie die Dynamik ihrer Veränderungen rekonstruiert. Die Publikation erfasst und analysiert die ukrainische theatralische Terminologie von den ersten Erwähnungen theatralischer Praktiken auf dem Gebiet der heutigen Ukraine (chronikologische Quellen des 11. Jahrhunderts) bis zur Gegenwart. Der größte Teil des Quellenmaterials gehört jedoch in die Zeit vom Beginn des 19. Jahrhunderts – der Phase der aktiven Herausbildung der ukrainischen Nationalkultur – bis in die 1930er Jahre, nach denen die Terminologie und damit auch die begriffliche Grundlage für lange Zeit gleichsam eingefroren wurden. Die ukrainische Theaterlexik wurde anhand von Periodika, dramatischen Werken, publizistischen Texten und epistolaren Zeugnissen untersucht. Dies ist nicht nur für das Studium der Schaffenswege der Bühnenkünstler dieser Epoche und ihrer Ansichten über Theaterkunst und Dramaturgietechnik bedeutsam, sondern auch für die Präzisierung unserer Vorstellungen von der Vergangenheit des ukrainischen Theaters. Denn die Inventarisierung von Termini bedeutet die Fixierung von Markern der Entwicklung einer Theaterkultur in einer bestimmten Epoche.
Die Autor:innen der Arbeit „Theaterkultur der Ukraine: Materialien zu einem historischen Wörterbuch“ haben die im ukrainischen Theater von seinen Anfängen bis in unsere Zeit gebräuchlichen Termini und Begriffe gesammelt und systematisiert und auf der Grundlage dieses historischen Wörterbuchs die Besonderheiten der ukrainischen Theaterkultur sowie die Dynamik ihrer Veränderungen rekonstruiert. Die Publikation erfasst und analysiert die ukrainische theatralische Terminologie von den ersten Erwähnungen theatralischer Praktiken auf dem Gebiet der heutigen Ukraine (chronikologische Quellen des 11. Jahrhunderts) bis zur Gegenwart. Der größte Teil des Quellenmaterials gehört jedoch in die Zeit vom Beginn des 19. Jahrhunderts – der Phase der aktiven Herausbildung der ukrainischen Nationalkultur – bis in die 1930er Jahre, nach denen die Terminologie und damit auch die begriffliche Grundlage für lange Zeit gleichsam eingefroren wurden. Die ukrainische Theaterlexik wurde anhand von Periodika, dramatischen Werken, publizistischen Texten und epistolaren Zeugnissen untersucht. Dies ist nicht nur für das Studium der Schaffenswege der Bühnenkünstler dieser Epoche und ihrer Ansichten über Theaterkunst und Dramaturgietechnik bedeutsam, sondern auch für die Präzisierung unserer Vorstellungen von der Vergangenheit des ukrainischen Theaters. Denn die Inventarisierung von Termini bedeutet die Fixierung von Markern der Entwicklung einer Theaterkultur in einer bestimmten Epoche.
Die Begriffsgeschichte ist eine der aktuellen Forschungsrichtungen der Geschichtswissenschaft, die sich in den 1960er-Jahren vor allem dank der Arbeiten von Reinhart Koselleck verbreitet hat. Dieser Ansatz wurde zur praktischen Antwort auf Ludwig Wittgensteins berühmten Satz: „Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt.“ Die Fruchtbarkeit einer derartigen Herangehensweise begründete seinerzeit Hans-Georg Gadamer in seiner Schrift „Begriffsgeschichte als Philosophie“, und ihr praktisches Potenzial wurde in der Folge von Forscherinnen und Forschern unterschiedlicher Disziplinen überzeugend demonstriert. In den letzten Jahrzehnten sind in diesem Genre zahlreiche Monographien internationaler Forscher erschienen, die der Geschichte nationaler theatralischer Terminologien gewidmet sind: der polnischen (Jerzy Ronard Bujański, Słownictwo teatralne w polskiej dramaturgii, Wrocław, 1971; Anna Cegieła, Polski słownik terminologii i gwary teatralnej, Wrocław, 1992; Maria Rutkowska, Terminologia dramatu i teatru w polskim Oświeceniu, Poznań, 2007; Rafał Kowalczyk, Rosyjskie słownictwo teatralne w porównaniu z polskim, Wrocław, 2005); der französischen (Teresa Jaroszewska, Le Vocabulaire du Théâtre de la Renaissance en France (1540–1585): Сontribution à l’histoire du lexique théâtral, Łódź, 1997; Teresa Jaroszewska, „La lexique théâtral français à l’époque de la Renaissance“, Zeitschrift für romanische Philologie, 2000, Bd. 116, H. 3); der englischen (Alan Dessen, Leslie Thomson, A Dictionary of Stage Directions in English Drama, 1580–1642, Cambridge, 1999); der altgriechischen (Krzysztof Bielawski, Terminy rytualno-kultowe w tragedii greckiej epoki klasycznej, Kraków, 2004), und andere. Im Bereich der ukrainischen Bühnenkunst stellt die Publikation „Theaterkultur der Ukraine: Materialien zu einem historischen Wörterbuch“ die erste Arbeit dieser Art dar.
In der Ukraine war dieser Typ von Forschung in einem dem Theater nahestehenden Bereich über lange Zeit lediglich durch den „Slovnyk literaturoznavtschych terminiv Ivana Franka“ (Wörterbuch der literaturwissenschaftlichen Termini von Ivan Franko) (Stepan Pinchuk, Yevhen Rehushevsky, Kyjiw: Naukova Dumka, 1966) vertreten. In den letzten Jahrzehnten sind jedoch auch eigenständige monographische Publikationen erschienen: „Slovnyk literaturoznavčych terminiv Ivana Ohiienka“ [Wörterbuch der literaturwissenschaftlichen Termini von Ivan Ohienko] von Vitaliy Matsko (Chmelnytskyi, 1997), „Slovnyk filolohitschnych terminiv Mychajla Drahomanova“ (Wörterbuch der philologischen Termini von Mychajlo Drahomanow] von Vasyl Derkach, Kremenchuk, Jatran, 2000) sowie „Slovnyk filolohitschnoji terminolohiji ta nomenklatury tvoriv M. S. Hruschevskoho“ (Wörterbuch der philologischen Terminologie und der Werknomenklatur von Mychajlo Hruschewskyj) von Oksana Maslykova, Simferopol, 2002). Zu einem ähnlichen Typ von Veröffentlichungen zählen auch Wörterbücher der Sprache einzelner Schriftsteller: „Slovnyk movy H. Kvitky-Osnovjanenka“ [Wörterbuch der Sprache von Hryhorij Kwitka-Osnowjanenko] in drei Bänden (Charkiw, 1978–79), „Slovnyk movy Lesi Ukrajinky“ (na materiali zbirky “Na krylakh pisen’”) (Wörterbuch der Sprache von Lesia Ukrainka auf der Grundlage des Bandes „Auf den Flügeln der Lieder“, Lutsk, 2012) sowie „Slovnyk movy poetytschnoji zbirky Ivana Franka ‘Zivjale lystja’“ (Wörterbuch der Sprache des Gedichtbandes „Verwelkte Blätter“ von Ivan Franko] von Zenovij Terlak, Lviv, 2010); Leonid Ushkalov, „Moja schewtschenkiwska entsyklopedija: iz doswidu samopiznannja“ (Meine Schewtschenko-Enzyklopädie: Aus der Erfahrung der Selbsterkenntnis, Kyjiw, 2019). Diese Arbeiten belegen die zunehmende Aktualisierung und Relevanz personaler und historischer terminologischer Wörterbücher in den Geisteswissenschaften.
Quellen, Definitionen, Begriffe
Die Quellen zur Geschichte des Theaters in der Ukraine wurden in mehreren Sprachen verfasst (Altkirchenslawisch, Altukrainisch, Ukrainisch, Russisch, Polnisch), was nicht nur die Besonderheiten der nationalen Bühnenpraxis widerspiegelt. Schließlich ist die gesamte primäre Terminologie des europäischen Theaters – zum Beispiel Theater, Szene, Aktor, Tragödie, Komödie – ebenso wie zahlreiche neuere Termini – zum Beispiel Happening, Performance, Verbatim – entlehnt. Dies zeugt von kulturellen Überschneidungen und mahnt dazu, diesen Sachverhalt ohne unnötige fachliche Befangenheit zu betrachten. Hinzu kommt, dass aus der Perspektive der Theaterkultur weniger der linguistische als vielmehr der fachliche Aspekt der Terminologie von Bedeutung ist: nicht so sehr die Verbalisierung eines Phänomens, sondern die Tatsache seines Vorhandenseins im theatralischen Bewusstsein der jeweiligen Epoche; nicht so sehr die Frage nach der Bezeichnung des Vorhangs oder der Kulisse, sondern die Tatsache ihrer Einführung; nicht so sehr der Terminus, sondern der Begriff, die Erscheinung, das Ding, das Phänomen. Aus diesem Grund wurde in die Untersuchung auch die polnische Theaterterminologie einbezogen, deren Einfluss der ukrainische Theater – zumindest auf terminologischem Niveau – bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts besonders deutlich verspürte.
Im Zuge der Arbeit an der Edition wurden in den Jahren 2019–23 über drei Tausend Quellen aus dem Zeitraum 1068–2022 ausgewertet. In der Edition sind mehr als 8.000 lexikalische Einheiten erfasst (theatralische Termini, feste Wendungen und bisweilen auch bildkräftige metaphorische Bezeichnungen), die das Vorhandensein bestimmter Erscheinungen in der Theaterpraxis und im theatralischen Bewusstsein der jeweiligen Epoche — also in der Theaterkultur — belegen und zugleich den Wortschatz des modernen Theaters bereichern.
Hinter jeder lexikalischen Einheit steht ein Begriff oder ein Phänomen, das die Besonderheiten der damaligen Bühnenpraxis charakterisiert. So bieten etwa die nachstehenden Fragmente Beschreibungen von Gepflogenheiten, die für die Theaterkultur ihrer Zeit kennzeichnend sind: „Die Schauspieler und Schauspielerinnen jener Zeit (des 19. Jahrhunderts, die Autorin) hatten noch eine weitere Einnahmequelle: Sie verteilten die Eintrittskarten für ihre Benefizvorstellungen eigenhändig in den Häusern wohlhabender Bürger und erhielten dafür sogenannte ‚Preise‘. Ein reicher Theatergänger zahlte für die Karten das Doppelte oder Dreifache, weshalb solche Fahrten durch die Stadt überhaupt unternommen wurden. Ein „Förderer der Kunst“ schickte das Geld durch seinen Diener und wies ihn an, den Schauspieler oder die Schauspielerin zu bewirten.“ (Nikolaj Tschernjaew, „Iz harkovskoj teatralnoj stariny“ (Aus der Charkiwer Theatervergangenheit, Charkiw, 2010). In diesem Fall ist der zentrale Terminus („Preis“), wobei zugleich eine Rückverweisung auf „Benefiz“ und „Schauspielerin“ erfolgt.
Ein weiteres Beispiel findet sich in den Erinnerungen von Marko Kropyvnytskyj, wo der Schlüsselbegriff „Ovation“ lautet: „Die junge, aufgeschlossene Zuschauerschaft begrüßte dieses Werk mit großer Herzlichkeit, und nach der Vorstellung veranstaltete sie eine unerhörte Ovation mit einem Fackelzug: Man einigte sich mit etwa fünfzig Kutschern, und auf jede Kutsche setzten sich drei Personen, sodass sich auf diese Weise ein ganzer Zug formierte.“ (Marko Kropyvnytskyj, „Tvory“ (Werke), 6 Bde., in Bd. 6, Kyjiw, 1960.)
Unter Berücksichtigung des Genres der Publikation werden die Termini ohne historische oder etymologische Kommentare wiedergegeben; lediglich einige veraltete Begriffe werden kurz erläutert. Neben den Lexemen, die heute zweifellos den Anspruch erheben können, als Termini zu gelten (Exposition, Katastrophe, Thema, Idee zum Beispiel) enthält die „Materialien zu einem historischen Wörterbuch“ auch Ausdrücke und einzelne Redewendungen, die die Besonderheiten des theatralischen Bewusstseins und der szenischen Praxis vergangener Zeiten widerspiegeln.
Besonderes Interesse verdienen die in alten Wörterbüchern verstreuten Termini, in denen sich mitunter ungewohnte, jedoch außerordentlich wichtige Definitionen für das Verständnis der historischen Theaterpraxis finden. So entspricht etwa eine Definition wie „Dekadent — ein Schriftsteller oder Maler, der so schreibt oder malt, wie es ihm erscheint, auch wenn es der Wahrheit nicht ähnlich ist“ (aus dem „Slovaryk“ von Wasyl Domanitskyj, 1906) zwar nicht unseren heutigen Vorstellungen des Dekadenzbegriffs, erklärt jedoch die Haltung des durchschnittlichen Zuschauers zu Beginn des 20. Jahrhunderts gegenüber der neuen Kunst. Solche Definitionen sind überaus wertvolles Material für das Verständnis der Besonderheiten der Theaterkultur vergangener Zeiten – ihrer Praxis, ihrer ästhetischen Vorstellungen und ihrer Denkgewohnheiten. In diesem Sinne interessierten uns die Termini und ihre inhaltliche Ausgestaltung vor allem als Indikatoren für Erscheinungen, Vorstellungen, methodologische Prinzipien, ästhetische Erwartungen, Zuschauergewohnheiten sowie für die künstlerische und administrative Praxis des Theaters früherer Epochen.
Der Hauptteil der im Wörterbuch zitierten Texte wird nach den Originalquellen oder nach wissenschaftlichen Ausgaben wiedergegeben; in einigen Fällen stützen sich die Zitate auf Forschungsarbeiten, in denen die Ergebnisse der Auswertung schwer zugänglicher historischer Quellen – darunter Buchausgaben, Periodika und Archivmaterialien – vorgelegt wurden. Die Quellenverweise in den Wörterbuchartikeln erfolgen in gekürzter Form in eckigen Klammern direkt im Text: Zuerst wird das Datum der Entstehung oder der Erstdruck angegeben, anschließend der verkürzte Titel der jeweiligen Schrift, gegebenenfalls mit Seitenzahl. Die vollständige, nummerierte Bibliographie der Quellen wird am Ende der Arbeit geboten – chronologisch nach Jahren geordnet und innerhalb eines Jahres alphabetisch. Die orthographischen Besonderheiten der Originalquellen bleiben beibehalten.
Die Struktur jedes Wörterbucheintrags umfasst: den Terminus; eine kurze Erklärung des Begriffs (falls notwendig), das frühe Datum seines Nachweises, Beispiele für die Verwendung des Terminus in der Theaterpraxis, die Quellenangabe des Zitats sowie eine Verweisstruktur – also einen Querverweis auf einen anderen Terminus, mit dem er in Beziehung steht oder in dessen Artikel ebenfalls ein Beleg für den betreffenden Gebrauch zu finden ist.
Die Edition „Theaterkultur der Ukraine: Materialien zu einem historischen Wörterbuch“ richtet sich an Forscherinnen und Forscher der Kultur- und Kunstwissenschaften sowie an Historiker, Philologen und all jene, die sich für die Geschichte der ukrainischen Theaterkultur interessieren. Sie konnte nur auf dem Fundament der intensiven und fruchtbaren Arbeit vieler Generationen ukrainischer Theaterwissenschaftler sowie von Sprach- und Kulturforschern entstehen. Wie jedes Wörterbuch ist es nicht vollständig; dennoch legt es ein wichtiges Fundament für künftige Forschungen in verwandten Bereichen der ukrainischen Kultur und stellt zugleich eine wesentliche Quelle für die konzeptionelle Erneuerung der modernen ukrainischen Theaterwissenschaft dar.
Yuliia Dobronosova, Kyjiw
Die Autorin ist Schriftstellerin, Philosophin und Essayistin. Im Jahr 2002 verteidigte sie am Hryhorij-Skoworoda-Institut für Philosophie der Nationalen Akademie der Wissenschaften der Ukraine eine Ph.D. Dissertation, die dem philosophischen Diskurs von Lesia Ukrainka gewidmet war. Seit 2009 ist sie Dozentin am Lehrstuhl für Philosophie und Pädagogik der Nationalen Transportuniversität (Kyjiw). Ihre wissenschaftlichen Interessen umfassen die philosophische Anthropologie sowie die Medienphilosophie.
Lyrik, Prosa, Essays und Rezensionen von Yuliia Yemets-Dobronosova:
- „Widlunja samotnosti. Knut Hamsun i kontekst ukraïnskoho modernizmu“ (Echo der Einsamkeit – Knut Hamsun und der Kontext der ukrainischen Moderne, Kyjiw, 2003),
- „Ravlyky tyshi. Poeziji“ (Schnecken der Stille – Gedichte, Charkiw, 2004),
- „Hymeryka@step.ua. Roman“ (Lwiw, 2006),
- „Ultra Light. Systema dychannja. Roman“ (Ultra Light – Ein Atmungssystem. Roman, Kyjiw, 2011)
- „Sriblo i moloko. Poeziji“ (Silber und Milch – Gedichte), Kyjiw, 2017).
- Wissenschaftliche Herausgeberin der ukrainischen Ausgabe von Zygmunt Baumans „Liquid Modernity“ („Plynni tschasy“, Kyjiw, 2013).
(Anmerkungen: Erstveröffentlichung der deutschen Übersetzung im Oktober 2025, Übersetzer: Pavlo Shopin, Drahomanow Universität Kyjiw, Internetzugriffe zuletzt am 21. Oktober 2025, Titelbild: Morituri te salutant eine Inszenierung nach den Novellen von Wassyl Stefanyk, Regie Dmytro Bogomasow © Ivan Franko Theater.)
