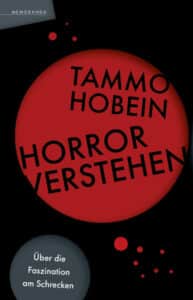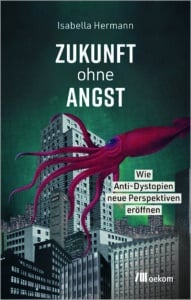Mehr Anti-Dystopie wagen!
Eine popkulturelle Annäherung
„Wir nehmen Zuflucht in Fantasieschrecken, damit die echten Schrecken uns nicht überwältigen, indem sie uns auf der Stelle gefrieren lassen und es uns unmöglich machen, im Alltag zu funktionieren. Wir begeben uns in die Dunkelheit eines Kinos und hoffen darauf, schlecht zu träumen – weil die Welt in unserem normalen Leben stets so viel besser aussieht, wenn der schlechte Traum endet.“ (Stephen King, Danse macabre – Die Welt des Horrors, München, Wilhelm Heyne Verlag, 2011, zitiert nach: Tammo Hobein, Horror verstehen – Über die Faszination am Schrecken, Berlin, Memoranda, 2022)
Es mag etwas ungewöhnlich erscheinen, einen Essay über Utopien und Dystopien mit einem Statement zur Popularität von Horrorerzählungen, -filmen und -serien zu beginnen. Aber wenn wir in die gängigen Medien hineinschauen, liegt der Gedanke vielleicht gar nicht mehr so fern. Vielleicht hilft es wirklich, sich gegen die realen Apokalypsen mit der Flucht in fiktive zu schützen. Ich nehme das letzte Wochenende des Juli 2025, an dem in drei Qualitätsmedien, ZEIT beziehungsweise ZEIT-Magazin, Tagesspiegel und FAZ Texte zu lesen waren, die uns nicht zuletzt deshalb beunruhigen dürften, weil wir Leser:innen den weiteren Gang der beschriebenen Entwicklungen selbst nicht beeinflussen können. Thema waren die drohende Vernichtung der Menschheit durch sich selbst programmierende Künstliche Intelligenz (ZEIT-Magazin), die apokalyptische Welt des Peter Thiel und seines Lehrers René Girard (ZEIT), der Weg der USA zu einer „Scheindemokratie“ im „siècle des dictateurs“ – so ein Buchtitel von Olivier Guez (Perrin, 2019) (FAZ) – und der irgendwann drohende Ausbruch des Supervulkans unter den Phlegräischen Feldern rund um Neapel (Tagesspiegel). Drohen (nur noch) apokalyptische und postapokalyptische Zeiten?
Die Lust am Schrecken
Dystopien, Apokalypsen verkaufen sich gut und fesseln uns im übertragenen wie im wörtlichen Sinne. Aber gibt es vielleicht auch Auswege? Immerhin schickt die ZEIT ihren Abonnent:innen jedes Wochenende einen Newsletter, der nur „gute Nachrichten“ enthält. Zwei Publikationen des Münchner oekom-Verlages bieten eine ebenso ermutigende Perspektive. Isabella Hermann veröffentlichte im Jahr 2025 ihr Buch „Zukunft ohne Angst – Wie Anti-Dystopien neue Perspektiven eröffnen“ und die Gruppe „Reinventing Society“ veröffentlichte eben dort im Jahr 2023 den Band „Zukunftsbilder 2045 – Eine Reise in die Welt von morgen“, ein Buch, das nicht zuletzt mit seinen Bildern an Fantasien des Solarpunk erinnert. Beide Bücher haben – ebenso wie die zu Beginn zitierte Einführung in die „Welt des Horrors“ – eine popkulturelle Note und bieten zugleich Prolegomena für ein zukunftsfähiges politisches Programm. Es fehlt eigentlich nur noch die reale Welt-Regierung, die es auch umsetzt. In „Zukunftsbilder 2045“ scheint es so etwas zu geben, eine Art Allianz von Wissenschaft, Regierungen und Zivilgesellschaft.
Utopien statt Dystopien – das wäre eine schöne Botschaft, aber so einfach ist es nun leider nicht, sodass ich in den beiden ersten Kapiteln dieses Essays erst einmal versuchen möchte, mich einem möglichen Verständnis der Lust an der Dystopie, an der Apokalypse zu nähern. Wir sollten wissen und darüber nachdenken, was uns an Dystopien, Apokalypse und Horror so fasziniert und warum wir vielleicht auch im realen Leben eher an eine apokalyptische Zukunft glauben als an eine Zukunft, in der Demokratie, Menschen- und Naturrechte gleichermaßen respektiert werden. Sind das nur Sehgewohnheiten? Oder steckt mehr dahinter? Erst wenn wir diese Fragen ernsthaft analysieren, können wir uns auf den Weg der „Anti-Dystopien“ begeben und an der Verwirklichung mehr oder weniger konkreter „Utopien“ arbeiten.
Apokalyptische Szenarien sind Möglichkeiten, aber wie viele und welche die Menschen, die sie rezipieren, für mögliche, aber abwendbare Szenarien oder für unabwendbare Gewissheiten halten, ist eine weitere wichtige Frage. Die Macht apokalyptischer Prophezeiungen liegt in uns selbst begründet. So ist es in der Tat sicherlich bequem und hilfreich, sich in fiktiven Horror zurückzuziehen, um den real drohenden Horror ignorieren zu können.
Die Glaubwürdigkeit der Apokalypsen steigt mit der Inszenierung von wirtschaftlichem Erfolg – so Ijoma Mangold in der ZEIT: „Thiels eigene Thesen sind also auf den ersten Blick oft so obskur, dass man ihn nicht einmal als Hofnarren dulden würde, wären seine Gedankenspiele nicht durch seine Geschäftserfolge geadelt.“ Douglas Rushkoff, dessen Buch „Survival of the Richest – Escape Fantasies of the Tech Billionaires“ (New York, W.W. Norton & Company, 2022), 2025 bei Suhrkamp in deutscher Sprache erschien, geht noch einen Schritt weiter. Er beschreibt eindrucksvoll, wie sich diejenigen, die es sich finanziell leisten können, auf die anstehenden Katastrophen, nicht zuletzt die Folgen des Klimawandels, den sie gar nicht leugnen, vorbereiten, und sich entweder auf den Mars zurückzuziehen gedenken (Elon Musk) oder an der eigenen Unsterblichkeit arbeiten (Peter Thiel): „Rette sich, wer kann“.
Naomi Klein und Astra Taylor nennen dies einen „Aufstieg des Endzeitfaschismus“ (in: Blätter für deutsche und internationale Politik Juni 2025): „Kurz gesagt, die mächtigsten Menschen der Welt bereiten sich auf das Ende der Welt vor, ein Ende, das sie selbst frenetisch beschleunigen. Das ist gar nicht so weit entfernt von der massentauglicheren Vision von Nationen als Festungen (…). In einer Zeit ständiger Gefahr positionieren offen suprematistische Bewegungen in diesen Ländern ihre relativ wohlhabenden Staaten als bewaffnete Bunker.“ Die beiden Autorinnen belegen dies mit Äußerungen von Peter Thiel, Curtis Yarvin, Steve Bannon und anderen. Sie belegen, dass diese Weltsicht „viel mit der christlich-fundamentalistischen Interpretation der biblischen ‚Entrückung‘ gemeinsam“ hat. Die schwerreichen Prepper definieren sozusagen ihre eigene Heilsgeschichte, in der aber nicht das Heil der Menschheit, sondern nur ihr eigenes Heil gesucht wird: JD Vance versuchte Papst Leo XIV. zu erklären, dass das Gebot der Nächstenliebe (Moses III, 19,18) nur für die Menschen in der eigenen Nähe gelte, Papst Leo XIV. widersprach.
Wollen wir so etwas wirklich lesen? Glauben wir, was wir lesen, oder ist es einfach zu abstrus? Und wir retten uns in das noch viel Abstrusere der Fantasy und Science Fiction? Wer einmal auf einer Buchmesse den Stand des Berliner Festa-Verlags besucht hat, wird feststellen, dass vor allem junge Frauen ein Faible für fiktiven Horror haben, nicht zuletzt für Hardcore-Horrorromane ohne ISBN-Nummer, die nur beim Verlag selbst erwerbbar sind. Populär sind zum Beispiel Teeny-Slasher-Produkte, wie sie David Lynch in seiner Twin-Peaks-Serie im Schicksal der Laura Palmer ästhetisiert hat. Vielleicht hat Stephen King recht, wenn er eine solche Lektüre als eine Art Eskapismus erklärt. So schlimm wie es in all diesen fiktiven Horrorszenarien, in Serien wie „The X-Files“, „American Horror Story“ oder „Penny Dreadful“ oder Romanen des Klassikers aller Horrorromane, H.P. Lovecraft, und seiner Epigonen ausschaut, ist es nun in der Wirklichkeit doch nicht! Oder etwa doch? Vielleicht hilft eine solche Strategie der Wirklichkeitsvermeidung tatsächlich gegen die Allgegenwart der aktuellen „Polykrisen“. Frau schaut Teeny-Slasher-Filme und kann zumindest für einige Augenblicke #Metoo, Femizide und nicht zuletzt die Weltsicht derjenigen ignorieren, die – das ist das Geschäftsmodell rechtspopulistischer und rechtsextremistischer Parteien in Europa und in den USA – die gesamte Welt als ein einziges Horrorszenario darstellen, in dem ständig dunkle Männer helle Frauen verfolgen, vergewaltigen und töten.
„Abwehrzauber“
Vielleicht handelt es sich bei der Popularität von Horrorprodukten tatsächlich um eine Form von Magie, eine Art „Abwehrzauber“? Tammo Hobein erklärt die Popularität des Horrorgenres am Beispiel der Serie „Penny Dreadful“: „Anhand der Figur des Caliban wird immer wieder die Frage aufgeworfen, was eigentlich einen Menschen ausmacht, was der Mensch denn sei – in seinem eigenen Wunsch, ein Mensch zu sein, begegnet Caliban den unterschiedlichsten Facetten des Mensch-Seins, und auch der Zuschauer muss sich zwangsläufig, möchte er an Calibans Schicksal partizipieren, damit auseinandersetzen.“ Mit „Caliban“ sind wir bei Shakespeare: Was ist der Mensch? Was kann er? Welche Fragen?
Thomas Assheuer verwendet den Begriff des „Abwehrzaubers“ in seiner in der ZEIT veröffentlichten Analyse des Krisenbegriffs: „Luftnummer mit fünf Buchstaben“: „Dass der Wortabwehrzauber eine Weile krisenfest funktioniert, verdankt sich den magischen Qualitäten der Sprache. Sie nimmt Dinge ‚in Obacht‘, macht sie namhaft und ‚merkfähig‘. Was benannt ist, ist gebannt, man kann damit umgehen, wie beruhigend. Aber die Macht der Benennung, das Fest-Stellende, ist zweischneidig. Wiederholt man das Wort Krise nur oft genug, dann wirkt es hypnotisch und bringt das darin Gemeinte zum Verschwinden – indem die Krise ins Wort eingeschlossen wird, bleiben ihre Ursachen ausgeschlossen. Man klebt Wörter an Probleme und glaubt, man sei sie los.“ Aber auch das Gegenteil ist denkbar und der „Abwehrzauber“ sediert lediglich. Vorsicht ist geboten! Verschwörungserzählungen, die die aktuellen politischen Krisen zur Metapher erklären, sind nicht mehr weit hergeholt. Susan Sontag hat analysiert, wie Krankheiten zu Metaphern erklärt werden, obwohl sie nichts anderes sind als eben Krankheiten, gleichviel, ob Krebs, AIDS oder – diese Pandemie erlebte Susan Sontag nicht mehr – COVID 19.
Tammo Hobein schließt sich dem amerikanischen Mythenforscher Joseph Campbell (1904-1987) an, der im fiktiven Horror eine Art vierfachen Schriftsinn entdeckt wie ihn im Mittelalter Bibelexegeten anwandten. Campbell „stellte in seinen Arbeiten vier verschiedene Funktionen heraus, die Mythen oder mythische Geschichten gemeinsam haben: die metaphysisch-mystische Perspektive, die kosmologische Perspektive, die gesellschaftliche Perspektive und die psychologische Perspektive.“ Als Beispiel zitiert er das Märchen um Frau Holle und wagt einen Ausflug in die sogenannte schwarze Pädagogik: „Schreckfiguren werden auch genutzt, um Kinder zu erziehen.“ Extremistische Akteure machen sich dies zunutze und stellen die ihrer Ansicht nach Verantwortlichen nach dem Muster von „Stürmer“-Karikaturen dar. Sie profitieren von einer gehörigen Portion „Aberglaube“, der sich im Horrorgenre in der Form von „Creepypasta“ im Internet vervielfältigt, aber genauso mit realen Verschwörungserzählungen in den sozialen Medien funktioniert, wie dem von Renaud Camus, Martin Sellner und ihren Anhänger:innen propagierten „Great Reset“. Vor diesen Verschwörungserzählungen schützt der Konsum von fiktivem Horror nicht. Aber es ist nicht ausgemacht, ob dieser Konsum möglicherweise die Wirkung von realen Verschwörungserzählungen verstärken könnte. Das wäre dann die Gegenthese zur These von Stephen King.
Wenn schon kein realer Bruce Willis („Armageddon“, „The 5th Element“) hilft, gibt es eigentlich nur noch zwei Wege, mit den drohenden Katastrophen zurechtzukommen, sich zu sedieren oder einfach nur zu reflektieren, was da geschieht. Eine Lösung ist nicht in Sicht, aber auch die Erkenntnis des Schreckens könnte vielleicht helfen, die Contenance zu bewahren. Intellektuelle möchten das gerne glauben. Ijoma Mangold vermutet dies in seinem Porträt von Peter Thiel: „Vielleicht können wir die Lage wieder besser erkennen, wenn wir uns dieses dunklen Denkens im Dunstkreis von Peter Thiel, das ja auch als ‚dark enlightenment‘ apostrophiert wird, wie eines Kontrastmittels bedienen. Wie heißt es bei Theodor Däubler, den Thiels Held Carl Schmitt so gerne zitierte: Der Feind ist unsere eigene Frage als Gestalt. Vielleicht hilft das Denken des politischen Gegners einem selbst dabei, wieder die Deutungshoheit über die Wirklichkeit zurückzugewinnen. / Zugeben, wer sich mit dem Teufel an einen Tisch setzt, braucht einen langen Löffel. Aber es kann nicht schaden, dem Teufel Intelligenz zu unterstellen, wenn man herauszufinden versucht, wie er tickt.“
Wer kennt außer einigen wenigen Germanist:innen schon Theodor Däubler? Aber ein anderer Name ist selbst zur allseits bekannten Metapher geworden: Franz Kafka. Olivier Guez beendet seinen bereits zitierten Gastbeitrag in der FAZ über die „Gleichgültigkeit“ in den USA und anderswo gegenüber Trump mit einem Blick auf den unvollendeten Amerika-Roman Kafkas: „Es gibt kein gelobtes Land mehr; der Ort der Zuflucht fehlt. An seine Stelle ist eine nationalistische, unberechenbare und zugleich berechnende Macht getreten. Zu diesem Reich passt eher die Sicht von Karl Roßmann, der gerade in New York in den Hafen einläuft. Am Anfang von ‚Der Verschollene‘ (1927) erblickt der junge Emigrant die Göttin der Freiheit: ‚Ihr Arm mit dem Schwert ragte wie neuerdings empor‘, schreibt Kafka. Ein bedrohliches Schwert ersetzt nun die Flamme von Recht und Freiheit.“
„Zukunftsbilder 2045“
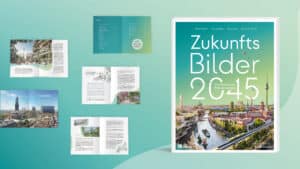
Weitere Informationen der Herausgeber:innen über das Buch erhalten Sie mit einem Klick auf das Bild.
Die Welt in 20 Jahren. Das ist keine lange Zeit. Klimaneutralität soll in Deutschland bis 2045 erreicht werden, in der EU bis 2050. Allerdings gibt es inzwischen auch Überlegungen, dieses Datum zu verschieben. Nicht einmal die Grünen trauen sich zurzeit, allzu laut für Klimaschutz zu werben. Im Band „Zukunftsbilder 2045“ ist von diesen Debatten keine Rede, denn die Ziele wurden – wie es sich für eine anständige Utopie gehört – erreicht.
Der Band „Zukunftsbilder 2045“ ist aufwendig gestaltet, enthält viele ausgesprochen ansprechende Bilder in einem großen Format, jeweils über Doppelseiten. Ergänzend zu den Texten gibt es QR-Codes mit weiteren Informationen. Vorgestellt werden 17 Kommunen, 15 in Deutschland, dazu Wien und Zürich. Zwei Kommunen liegen in Ostdeutschland, Leipzig und Wiesenburg, das die einzige ländliche Kommune ist. Haan bei Düsseldorf steht als Beispiel für eine kleine Kommune im Speckgürtel einer wohlhabenden Stadt. Die weiteren Städte: Berlin, Bremerhaven, Düsseldorf, Emden, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, Leipzig, Ludwigsburg, Lüneburg, Stuttgart, München.
Der Band wird nach dem Vorwort der vier Gestalter:innen Stella Schaller, Ute Scheub, Sebastian Vollmar und Lino Zeddies von der fiktiven Journalistin Liliana Morgentau eingeleitet, die 21 Jahre in Lateinamerika, insbesondere in Peru und Argentinien, gearbeitet hat. Sie möchte uns Leser:innen einladen, sie auf ihrer Reise zu begleiten: „Auf meiner Reise will ich erkunden, ob es uns gelungen ist, (…) Frieden mit der Natur zu schließen.“ Der Band endet mit einem Fragebogen, in den die Leser:innen ihre eigenen Visionen eintragen können, sowie mit einer Vorstellung der Ziele und Arbeitsweisen von Reinventing Society.
Die 17 Orte werden mit fiktiven Interviews vorgestellt, alle vorgestellten Initiativen haben bereits heute erprobte Vorbilder, die in der Regel jedoch nur an einzelnen Orten und dort oft nur mit einzelnen Projekten Wirklichkeit wurden. Zu diesen Initiativen gehören Ökodörfer, Urban Gardening, Forschungsergebnisse zur Agrarwende, Utopiekonferenzen, wie es sie seit 2018 an der Universität Lüneburg gibt, Bürgerräte nach dem Modell von Mehr Demokratie e.V., Maßnahmen zur Klimaanpassung, zum Beispiel Ersatz von Asphalt, der sonst in der Hitze schmilzt. Schulen wie die Margret-Rasfeld-Schule folgen der Dalton-Pädagogik, bieten Räume nach dem Modell der Fraktalen Schule, Banken arbeiten mit „Gemeinwohlbilanzierungen“.
Auf den Bildern sehen wir viel Grün, wenig Autos, Busse, Shuttles, Fahrräder, gut erreichbare Gastronomie mit Cafés in der Innenstadt, natürliche Wasserkreisläufe und Schwammstädte, die Nähe von Wohnen, Arbeiten und Einkaufen, attraktive Naherholung. Die Nutzung repräsentativer Gebäude durch Bürgerinitiativen und Vereine wird öffentlich gefördert, es gibt bundesweite „Bürgerwerkstätten“. Das „Kriegsministerium“ ist zum „Ministerium für Demokratie und Gemeinwohl“ geworden, es gibt eine „Bundesministerin für integrale Gesellschaftsentwicklung“, es gab im Jahr 2030 eine große Steuerreform, die für mehr Gerechtigkeit sorgte, der „Deep State“ wurde zur „Deep Democracy“. Ein wichtiger Stichwortgeber – man könnte ihn auch Influencer nennen – war der (fiktive) Buchautor Leonardo Merwald mit seiner „Regeneratopia“-Reihe, die durchaus Anklänge an Romane von Kim Stanley Robinson verrät, nicht zuletzt an „Das Ministerium für die Zukunft“ (deutsche Erstausgabe 2021 bei Heyne).
Der Band bietet ein überzeugendes Gegenbild zu so manchen politischen Ansätzen der 2020er Jahre, in denen wir nicht ohne Grund befürchten müssen, dass sich die Welt eben nicht zum Besseren entwickeln wird. Aber wie konnte es zu dem von Reinventing Society imaginierten besseren Ende kommen? Die Antwort ernüchtert: Durch Katastrophen. Es gab Temperaturen von bis zu 46 Grad Celsius im Rheinland, einen Finanzcrash im Jahr 2029, aber dann gab es ein Umdenken, weltweit!
Eine fiktive Transformationsforscherin mit dem sprechenden Namen Henrike Schirmbauer aus Bremerhaven erinnert an die 2020er Jahre: „Die 2020er waren eine Zeit großer Paradoxien und Widersprüche. So wie Pflanzenreste zum Humus für neue Gewächse werden, hat der Zusammenbruch des alten Systems ein Aufkeimen neuer Ideen, Lösungen und Praktiken ermöglicht. In den krisenhaften 2020er Jahren ist die globale regenerative Bewegung erstarkt. Deren Mitglieder bauten Pionierprojekte und Inseln regenerativer Kulturen auf. Eine wichtige Inspiration für mich war das Buch ‚Regenerative Kulturen gestalten‘ von Daniel Christian Wahl, einem Vordenker auf diesem Gebiet.“ (Dieses Buch und diesen Autor gibt es wirklich, Internetlinks im Zitat NR).

Köln Hohenzollernbrücke, Zukunftsbild 2045 / Reinventing Society & loomn (CC BY NC SA 4.0, Foto: Maximilian Schönherr)
In den 2030er Jahren wurden – metaphorisch gesprochen – aus nachhaltigen Inseln nachhaltige Kontinente und Meere, ein nachhaltig wirtschaftender Planet. Henrike Schirmbauer: „Die wilden 2030er sind in eine Phase von größerer Erdung und Stabilität übergegangen. In den letzten Jahren gelang uns ein kraftvoller Umbau unserer Gesellschaft. Nach vielen Experimenten haben sich viele gute Lösungen etabliert. Die Wirtschaft mehrt unseren Wohlstand und hält überwiegend die planetaren Leitplanken ein.“
Als Leser wurde ich an diesem Punkt skeptisch. Globales Umdenken? In einem so kurzen Zeitraum? Die Ziele, die 2045 erreicht wurden, überzeugen, aber wie kommt die Welt dorthin? Nur über Katastrophen? Was wurde aus den 46 Grad im Rheinland? Gibt es noch Kriege? Müssen Menschen wegen eines Krieges oder wegen der durch den Klimawandel ausgelösten Katastrophen ihre Heimat nach wie vor verlassen wie in den ersten Dekaden des 21. Jahrhunderts?
Es ließe sich auch ein anderes Szenario denken, eine reine Anpassungsstrategie an eine Erderwärmung um vier Grad Celsius im Durchschnitt wie sie Parag Khanna in seinem Buch „Move“ als Jahrhundertprojekt vorstellt: Die Menschheit gibt im Verlauf des 21. Jahrhunderts zahlreiche Siedlungsgebiete auf und erschließt durch Migration neue in der Nähe der Polarkreise. Das ist Migration in größtem Stil, der alle heutigen Szenarien um ein Vielfaches übertrifft. Die Konflikte, die wir bereits heute weltweit erleben, und die wir mit großer Wahrscheinlichkeit auch in der nächsten Zukunft erleben werden, wären noch ein anderes Thema. Ausgetrocknete Böden, versteppte Landschaften, Wasserknappheit, Artensterben und Pandemien, weil der Mensch bei einer immer weiter eingeengten Wildnis mit Viren in Kontakt kommt, die er sonst nie kennengelernt hätte. Wie gehen die Städte und Dörfer der Zukunft damit um, wie Politik und Gesellschaften?
„Zukunftsbilder 2045“ imaginiert eine mögliche und wünschenswerte Zukunft, aber reicht es aus, nur über Gegenbilder zur Dystopie der Gegenwart nachzudenken? Hier kommt Isabella Hermann mit ihrem Buch „Zukunft ohne Angst“ ins Spiel. Sie fordert ein anti-dystopisches Denken.
„Zukunft ohne Angst“
Das Buch von Isabella Hermann enthält sechs Kapitel. Es beginnt mit „Die dystopische Gegenwart“ und „Die utopische Forderung“, definiert anschließend ausgehend von Kim Stanley Robinsons „Das Ministerium für die Zukunft“ den Begriff der „Anti-Dystopie“, konkretisiert dies mit mehreren „antidystopischen Geschichten“ und schließt mit Vorschlägen für „Anti-dystopisches Verhalten im Hier und Jetzt“ sowie dem resümierenden Kapitel „Die Anti-Dystopie als anschlussfähiges Narrativ und Konzept“. Etwa 100 Seiten Text lesen sich ausgesprochen konzentriert und zugleich so unterhaltsam, dass manche Leser:innen auf den Geschmack kommen werden, die einzelnen empfohlenen Romane zu lesen. Darüber hinaus bietet das Buch einen Werkzeugkasten, mit dem sich andere als utopisch oder dystopisch charakterisierte Romane, Filme, Serien analysieren lassen.
Dystopien sind für Isabella Hermann der „Ausdruck gegenwärtiger Zukunftsängste, die in ein düsteres Extrem gesteigert werden.“ Grundlage sind das „Anthropozän“, ein Begriff von Paul J. Crutzen und Eugene F. Stoermer, beziehungsweise das „Kapitalozän“, ein von Donna Haraway ergänzend eingeführter Begriff. Isabella Hermann verweist auf den Roman „Parable of the Sower“ (1993) von Octavia Butler, der im Jahr 2024 spielt, etwa 30 Jahre nach Erscheinen: „Die prekären Lebensbedingungen treffen Weiße genauso wie People of Color, was aber nicht zwingend zu einer Solidarisierung führt. Stattdessen herrscht oft großes Misstrauen zwischen den verschiedenen ethnischen Gruppen.“ Das ist nicht nur eine Fiktion, sondern lässt durchaus an diverse identitätspolitische Debatten der heutigen Zeit denken.
Isabella Hermann geht einen Schritt weiter, indem sie die Akteure des „Anthropozäns“ beziehungsweise des „Kapitalozäns“ benennt, die sich in dystopischen Erzählungen gegenseitig zu übertreffen versuchen: „Zu erwähnen ist, dass die über weite Strecken sehr angloamerikanisch, männlich und weiß geprägte Geschichte der SF seit den 1970ern zunehmend mit feministischen, antirassistischen, postkolonialen und queeren Perspektiven erfolgreich herausgefordert wird.“ Eine der bekanntesten Autorinnen ist vielleicht Margaret Atwood mit ihrem inzwischen auch in Filmen und Serien präsenten Werk „The Handmaid’s Tale“ (1985). Die Perspektiven ändern sich auch, weil die Autor:innen vielfältiger werden, es entstehen weibliche oder afrikanische Perspektiven. Dazu gehört beispielsweise die nigerianische Schriftstellerin Nnedi Okorafor, die ihr Werk „als Africanfuturism in Abgrenzung zum Afrofuturismus“ definiert und damit afrikanische Perspektiven in den Vordergrund stellt, die sich von den Perspektiven afroamerikanischer, afroeuropäischer oder afrodeutscher Autor:innen unterscheiden. Dies bedeutet nicht, dass auf Grund dieser Vielfalt die humanistischen, utopischen Kräfte dominieren müssten. Das ist schon in der frauenfeindlichen Dystopie Margaret Atwoods nicht der Fall. In Sarah Halls Roman „The Carhullan Army“ (2007) entpuppt sich die Befreierin Jacky „als manipulative Gewaltherrscherin“, ein angesichts des Schicksals mancher Befreiungsbewegungen gar nicht so weit hergeholtes Szenario (zum Beispiel das Ehepaar Ortega in Nicaragua, Mugabe in Zimbabwe).
Vielleicht sorgt Vielfalt auch dafür, dass in den Dystopien Perspektiven einer Utopie entstehen? Isabella Hermann konstatiert allerdings: „Des einen Utopie ist des anderen Dystopie – und umgekehrt. Dies heißt Utopien stets zu hinterfragen oder sich gleich vor ihnen in Acht zu nehmen, denn sie könnten nicht nur eine unerreichbare Träumerei, sondern auch gefährlich sein.“ Man muss sich im Grunde nur die Utopien anschauen, die die Milliardäre rund um Donald Trump oder ein Vladimir Putin verbreiten, um diesen Satz zu verstehen. Ein Gegengift wären jedoch „kritische Utopien“. Diese „legen den Fokus auf den fortwährenden Prozess der Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Idealen und die Akzeptanz von Unterschieden und Unvollkommenheiten innerhalb der Utopie.“ Als Beispiele nennt Isabella Hermann Ursula K. LeGuins „The Dispossessed“ (1974), Earnest Callenbachs „Ecotopia” (1975), Angela und Karlheinz Steinmüllers „Andymon“ (1982), aber auch Theresa Hannigs „Pantopia“. „Der Gedanke ist also, dass Utopien im Gegensatz zu Dystopien nicht nur warnen, sondern als positive Visionen auch zum konstruktiven Handeln anregen sollen.“
Eine „kritische Utopie“ ist somit immer auch „Anti-Dystopie“. Sie ist – so Isabella Hermann – „dynamisch“ und betont den Widerstand der Akteure in einem zunächst dystopisch erscheinenden Szenario. Man könnte die Autor:innen, die anti-dystopische Texte schreiben, auch als Teilnehmer:innen eines Diskurses bezeichnen, die wagen, in Alternativen, in Gegensätzen, in dialektischen Prozessen zu denken. Eben dies ist auch der Grundgedanke von Kim Stanley Robinson im „Ministerium für die Zukunft“, den Isabella Hermann wie folgt zitiert: „It’s not a utopian novel, because they haven’t solved the problems, but have resisted dystopia.“ Anders gesagt: „Die Anti-Utopie ist unperfekt“. Es gibt keine einfachen Lösungen: „Wie dann im Sinne der Anti-Dystopie Gerechtigkeit ausgestaltet, Gemeinschaft gebildet und Veränderung herbeigeführt und durchlebt werden, müssen wir in der Realität selbst aushandeln – das kann uns kein Kim Stanley Robinson abnehmen. Was Autor:innen allerdings eröffnen, sind Möglichkeitsräume, um Zukunftsideen zu diskutieren.“ (Wer es bildungsbürgerlich mag, möge an Friedrich Hölderlin und sein so oft zitiertes Gedicht „Patmos“ denken, in dem gleich zu Beginn die folgende These formuliert wird: „Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch“. Wie auch immer es ausschauen mag, jenseits von Superheld:innen nachempfundenen Figuren.)
Ingenieure, Hazardeure und Geisterjäger retten die Welt
Können wir die weitere Erwärmung der Erde noch verhindern oder bleibt nur noch Klimaanpassung? Ist die Apokalypse verhinderbar oder können wir uns nur noch darauf vorbereiten, in einer postapokalyptischen Zukunft zu überleben? Mit der biblischen Apokalypse hat das nicht mehr viel zu tun. Isabella Hermann beschreibt die säkulare Wende religiöser Vorstellung in postapokalyptischer Literatur: „In der Postapocalyptic Fiction als Subgenre der Science-Fiction ist der Grund des Weltendes zwar nicht mehr direkt religiöser Natur, doch geht es um das menschliche Überleben nach einem Ereignis, das zum Zusammenbruch der Erde geführt, seien es Klimakatastrophen, missglücktes Geoingineering, Meteoriteneinschläge, Alien-Invasionen, Pandemien oder der Einsatz von Waffen globalen Ausmaßes. (…) Oft sind diese Settings dystopisch, da die Menschheit in einen Zustand fällt, in dem das Recht des Stärkeren gilt und Macht durch Gewalt ausgeübt wird.“ Hier wird „eine Stunde null“ imaginiert, nach der unterschiedliche Szenarien möglich sind, eine Besinnung der Menschheit auf eine nachhaltige und friedliche Zukunft – wie in der Utopie von „Zukunftsbilder 2045“ – oder eine Art Eskapismus à la Elon Musk auf den Mars.
Allerdings könnte sich Elon Musk vielleicht öfter diverse Star-Trek-Episoden anschauen, in denen es immer wieder einmal darum geht, Apokalypsen zu verhindern. Das geht mitunter so weit, dass die Bedrohungen im All genozidale Auswirkungen zu haben drohen. Im Franchise „Discovery“ verschärft sich dies von Staffel zu Staffel, zum Beispiel in der vierten Staffel, in der die Spezies 10C überzeugt werden muss, dass eine von ihr durchgeführte Maßnahme ungewollt die Zerstörung ganzer Zivilisationen mit sich bringt. Ökologische Katastrophen, Genozide können dank der Genialität der diversen Star-Trek-Ingenieure oft genug mit technischen Mitteln, über die die Sternenflotte verfügt, verhindert werden. Das Fiktionale wird hier geradezu zur Metapher.
Fortgeschrittene Ingenieurskunst ist nur eines der Instrumente, mit denen dies den jeweiligen Kommandant:innen der Sternenflotte gelingt, die Welt zu retten. In „Year of Hell“, eine Doppel-Episode von „Voyager“, versucht der Anführer der Krenim, Captain Annorax (übrigens der Name des Wissenschaftlers in dem Roman „20.000 Meilen unter dem Meer“ von Jules Verne), eine Zeitlinie wiederherzustellen, in der seine tote Ehefrau wieder lebt. Die Wiederherstellung dieser Zeitlinie gelingt jedoch immer nur zu einem Teil, mitunter mit bis über 90 Prozent, nur seine Frau bleibt nach wie vor tot. Die Veränderungen haben katastrophale Auswirkungen auf ganze Zivilisationen, sie sind in Kauf genommene Genozide. Als letztes Mittel riskiert Captain Janeway die Vernichtung der Voyager. Natürlich mit Erfolg, die ursprüngliche Zeitlinie wird wiederhergestellt, das Jahr der Hölle hat nicht stattgefunden, nicht nur für die Crew der Voyager, auch für die Krenim, deren Anführer sein Ziel erreicht hat: seine Frau lebt.
Oder brauchen wir vielleicht doch eher professionelle Geisterjäger:innen, echte Ghostbuster? Patricia Eckermann lässt sie in ihrem Roman „Elektro Krause“ dafür sorgen, dass eine Elektrofirma aus Troisdorf-Sieglar mit einer eigenen Kompetenz als Ghostbuster im Bonn des Jahres 1989, kurz vor dem Mauerfall, eine Art Nazi-Zombies daran hindert, die Abgeordneten des Deutschen Bundestages durch ein Portal zu infiltrieren und auf diese Weise die Macht zu übernehmen. Damit wären wir wieder beim Horror-Genre, in dem es eben auch immer diejenigen gibt, die die Ursachen des Horrors beseitigen. Suchen Sie sich aus, wem Sie mehr vertrauen, Ingenieure:innen, Hazardeur:innen oder Geisterjäger:innen!
Die Apokalypse hat viele Gesichter, es gibt aber eben auch viele Szenarien, sie zu verhindern. Isabella Hermann: „Diese Widersprüche der unterschiedlichen Antworten auszuhalten ist anti-dystopisch.“ Sie zitiert zum Abschluss Octavia Butler: „Was wir im Angesicht einer sehr komplexen Krise tun können, ist, dass wir sie mit unserer eigenen Komplexität beantworten. Wir sind selbst sehr komplex in unserem Empfinden, Denken und Handeln. Demzufolge gibt es auch nicht nur eine einzige Antwort auf die Frage, was wir tun können, im Gegenteil: Unsere Antworten gebären eine ganz neue Welt.“ Nicht ohne Grund verweist Isabella Hermann im Abschlusskapitel auf das Buch „Erzählende Affen“ von Samira El Ouassil und Friedemann Karig (Berlin, Ullstein, 2021). Horrorerzählungen, Apokalypsen, Dystopien gehören dazu, aber eben auch die Geschichten, wie sie überwunden werden könnten. Beispielsweise findet jede Episode der „X-Files“ dank Fox Mulder und Dana Scully findet ein weitgehend gutes Ende. Oder es bleibt zumindest – wie in „Twin Peaks“ denkbar, wenn auch vielleicht in einer anderen Zeit-Dimension. Die Möglichkeit einer Überwindung ist auch die Botschaft der vorbildlich humanistischen Welt von Star Trek, der Mensch hat eine zentrale Fähigkeit. Am Ende der ersten Staffel des Franchise „Picard“ benennt sie Jean-Luc Picard im Gespräch mit Data: „It’s imagination“. In der Tat. So wie wir ein Kino verlassen, sollten wir auch den realen Horror verlassen können.
Vielleicht wäre aber auch denkbar, dass Politiker:innen zugleich kluge Ingenieur:innen, mutige Hazardeur:innen oder gar erfolgreiche Geisterjäger:innen werden? Vielleicht sollten sie einfach nur mehr anti-dystopisches Denken wagen? Petra Pinzler und Stefan Schmitt veröffentlichten am 26. Juni 2025 in der ZEIT ihren Essay „Das wird gut“, in dem sie sich ausdrücklich auf Kim Stanley Robinson und Isabella Hermann bezogen: Sie erinnern an das UNESCO-Konzept der „Futures Literacy“, das inzwischen auch in diversen Workshops diskutiert und erprobt wird: „Nicht fantasieren, sondern Existierendes in die Zukunft verlängern“. Eigentlich bräuchte man dazu nur den politischen Willen, die erforderlichen Mehrheiten zu organisieren. Dann werden vielleicht auch Zukunftsbilder Wirklichkeit, wie sie Reinventing Society imaginiert. Und das wäre dann nicht mehr nur Science Fiction. Vielleicht.
Norbert Reichel, Bonn
(Anmerkungen: Erstveröffentlichung im August 2025, Internetzugriffe zuletzt am 6. August 2025. Titelbild: Thomas Franke,
Illustration zur Erzählung „Ascheglühen“ von Wolf Welling und mit der Collage gedruckt in EXODUS 49, Holzstichcollage auf Chromolithografie / 29,8 x 39,3 cm / 2024.. Der Künstler gab der Collage den folgenden Titel: „Visualisierung einiger Konstellaterationen im komaschatischen Wunderland mit dem vom Patakosmologen Klaúdios Ptolemaíos installerierten Induktions-Inklinatorium sowie dem von seinem Konkurrenten Niclas Koppernigk einmontierten Erdinduktor, welche die Feldlinien des Wunderlandischen Magnetfeldes zum nörderlichsten Punkt des Daseinsabschlusses des Visualisierers beeinflussen, womit sich dessen alternativlosende Zuneigung zur Wissenschaft offenbart. In den sich daseinsabschließend zusehends fragmentarisierenden neuronalen Verschaltungen, die einen Fluß moderat dahintreibender magnetfeldischer Strömungen erzeugen, quellen Nanobots an die Oberfläche und enthüllen ihr wahres Wesen als weltzerfressende Pac-Mans im in die Wirklichkeit transformulierten Labyrinth ‚Wunderland‘, – gierig mit dem japanischen lautmalerischen Ruf ‚paku paku!‘ nach dem nörderlichsten Punkt des Daseinsabschlusses schnappend. Das in diese virtualitätige Visualisierung integrierte alte Schulhaus im Sonnenuntergang beobachtend, lauert der Boschfroschlakai und suggeriert als Erscheinung, daß das Froschsein als Zustand zwar etwas nicht Erstrebenswertes, allerdings etwas Vorübergehendes sein könnte. Und also schwirrelt einer der durch die unglückliche Einwürgung des Doppler-Effekts verdoppelten Alice, als A-Lice und Be-Lice zu sehen, in diesem Zusammenhang die klügliche Be-Hauptung des antiken Dichters Petronius durch den Kopf: ‚qui fuit rana, nunc est rex‘. A-Lice hingegen denkt über sich und komaschatische Wunderländer nach und singt das Lied ‚The Me I Never Knew‘“.“ Alle Rechte beim Künstler.)