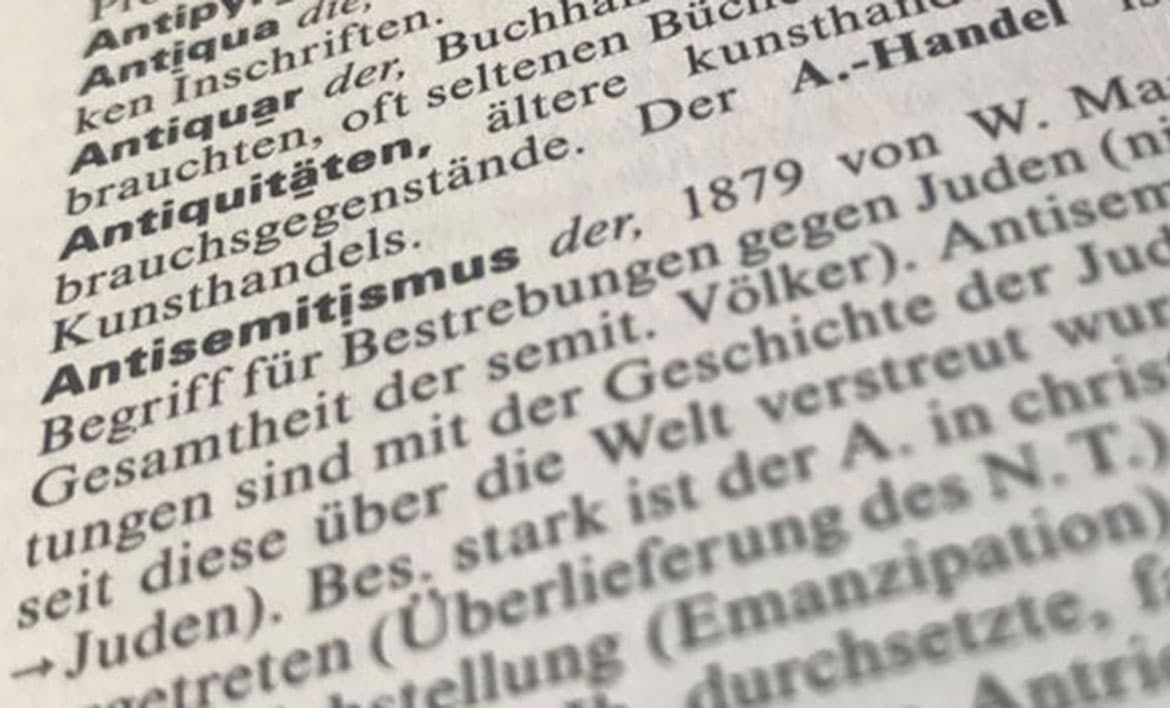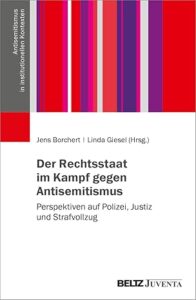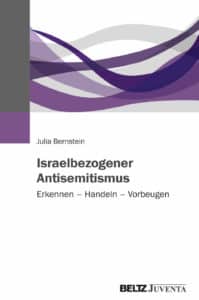Mit dem Rechtsstaat gegen Antisemitismus
Definitionen, Studien, Handlungsmöglichkeiten
„Der Antisemitismus war keine direkte Reaktion auf reale Umstände. Tatsächlich reagieren Menschen auch nicht direkt auf Ereignisse. In einem Prozess der Konzeptualisierung und Verbalisierung konstruieren sie sich eine Interpretation ihres Welt-Erlebens, und nur auf diese selbstgemachte Konzeption der Wirklichkeit können sie reagieren. Jede Interpretation der Wirklichkeit ist ein selbstständiges, schöpferisches Produkt des menschlichen Geistes, und oft ist sie gerade darum umso wirksamer, weil ganz oder teilweise falsch ist.“ (Shulamit Volkov, Antisemitismus als kultureller Code, in: Leo Baeck Institut Yearbook XXIII, 1978, Nachdruck in: Jüdisches Leben und Antisemitismus im 19. und 20. Jahrhundert, München, Beck, 1990. Zweite, durch ein Register erweiterte Auflage, 2000.)
Manche möchten vielleicht Shulamit Volkov widersprechen, weil nach dem Pogrom vom 7. Oktober 2023 unmittelbare eindeutig antisemitische Reaktionen erfolgten. Es gab nach der Shoah wohl kein antisemitisches Pogrom, das so ausführlich und umfassend dokumentiert wurde, in Echtzeit. Die Hamas-Terroristen filmten mit ihren eigenen und mit den Handys ihrer Opfer den Überfall, die Vergewaltigungen, die Morde und Verschleppungen und versandten Bilder und Videos an die Familien der Opfer. Und dennoch gibt es bis heute immer wieder selbst prominente Stimmen, die das Massaker anzweifeln, leugnen, herunterspielen oder gar rechtfertigen, den Opfern jedes Mitgefühl verweigern und Antisemitismus schüren. Jüdinnen und Juden wurden auf offener Straße bedroht, ihre Wohnungen markiert, jüdische Studierende wurden gehindert, ihre Lehrveranstaltungen zu besuchen, auf Demonstrationen wurde die Vernichtung Israels gefordert und alle Jüdinnen und Juden dieser Welt wurden gleichermaßen für jede einzelne Entscheidung der israelischen Regierung in Kollektivhaftung genommen. Die Medien und die Politik reagierten, erweckten aber mitunter den Anschein, als handele es sich um ein völlig neues Phänomen. Nur glaubten sie wirklich, dass es vorher keinen Antisemitismus gegeben hätte? Und dass der Rechtsstaat erst jetzt reagieren müsse?
Aber welche Möglichkeiten hat der Rechtsstaat, gegen Antisemitismus dauerhaft und wirksam vorzugehen? In der Theorie, in der Praxis? Diese Fragen sind Gegenstand dieses Essays. Um sie zu beantworten, soll zunächst an die lange Geschichte des Antisemitismus in seinen verschiedenen Verkleidungen und Ausprägungen erinnert werden, bis hin zur heute dominierenden Form des israelbezogenen Antisemitismus. In einem zweiten Teil sollen dann die beiden zentralen Definitionen von Antisemitismus analysiert werden, IHRA-Definition und Jerusalem Declaration, im dritten Teil Reaktionen des Rechtsstaates und der Sicherheitsorgane vorgestellt und diskutiert werden. Ein eigenes Kapitel befasst sich mit Antisemitismus im Strafvollzug.
Antisemitismus braucht keinen Anlass
Es gibt eine Fülle von Literatur zur langen Tradition des Antisemitismus und der immer wieder neuen Variationen des „Gerüchts über die Juden“, von dem Theodor W. Adorno in den Minima Moralia (1951) sprach. Antisemitismus ist – so ist Adorno zu verstehen – schwer zu definieren, aber dennoch gibt es eine Struktur. Shulamit Volkov und Jeffrey Herf beschreiben diese Struktur: Antisemitismus ist latent immer vorhanden. Aber Aufmerksamkeit und Widerstand entstehen erst mit aktuellen Anlässen. Solche Anlässe, mal mehr, mal weniger beachtet, hat Ronen Steinke in seinem Buch „Terror gegen Juden“ ausführlich dokumentiert. (Berlin Verlag, 2020). Das Buch enthält ohne den Anspruch von Vollständigkeit eine etwa 100 Seiten umfassende Liste antisemitischer Gewalttaten in Deutschland seit 1945. Antisemitismus ist auf keinen Fall eine plötzliche Erfindung, die erst durch den 7. Oktober ausgelöst worden wäre.
Shulamit Volkov hat die verschiedenen Ausprägungen und Phasen des Antisemitismus zuletzt in dem Buch „Deutschland aus jüdischer Sicht – Eine andere Geschichte vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart“ (München, C.H. Beck, 2022) thematisiert. Sie notiert einen wesentlichen Unterschied in den antisemitischen Diskursen: „Bis ins achtzehnte Jahrhundert hinein definierten sich Männer und vermutlich auch Frauen primär über ihre Religionszugehörigkeit. In einer Welt der zumindest de jure gleichen politischen Rechte für alle Konfessionen neigte man stattdessen dazu, sich über seine nationale Zugehörigkeit zu definieren.“ Gleichzeitig gab es immer wieder Mischformen, in denen religiöse und nationale Diskurse sich gegenseitig verstärkten. Kritik an der israelischen Regierung wurde zum Beispiel zu grundsätzlicher Kritik an der Berechtigung Israels und diese wiederum zu grundsätzlicher Kritik an allen Jüdinnen und Juden dieser Welt.
Wo Antisemitismus beginnt, ist eine immer wieder kontrovers debattierte Frage. Mit jedem einzelnen Fall beginnt aufs Neue der Streit, ob das, was als Antisemitismus benannt wird, auch tatsächlich Antisemitismus ist. Kritik an der israelischen Besatzungspolitik wird oft als Kritik an Zionismus als kolonialistischem Projekt bezeichnet und hätte daher nichts mit Antisemitismus zu tun, so denken manche. Jeffrey Herf dekonstruiert diese Verbindung in einem Essay vom 25. April 2023, den er in seine Aufsatzsammlung „Three Faces of Antisemitism – Right, Left and Islamist“ (London / New York, Routledge, 2023) aufnahm, der jetzt in der 2025 bei Hentrich & Hentrich erschienenen Ausgabe in deutscher Sprache vorliegt. Das Buch enthält 18 zum Teil aktualisierte Texte aus etwa 40 Jahren. Der älteste Text mit dem Titel „Reaktionärer Modernismus“ („Reactionary Modernism“) wurde schon im Jahr 1984 veröffentlicht. Antisemitismus gehört zum Inventar anti-modernistischer, reaktionärer Positionen, die sich je nach Kontext unterschiedlich begründen, mal eher religiös, mal eher nationalistisch, mal auch antikapitalistisch oder antiimperialistisch. Rechte, Linke, Islamisten müssen sich nicht miteinander abstimmen.
Jeffrey Herf beschreibt, wie Israel als „Projekt der antifaschistischen, antirassistischen, antikolonialistischen und antiimperialistischen Linken, einschließlich der Sowjetunion“ gegen zögerliche und kontroverse Positionierungen in den USA entstand, so dass David Ben-Gurion zugespitzt formulierte: „Die Juden wären ausgerottet worden, wenn sie für ihr Überleben von den Vereinigten Staaten abhängig gewesen wären.“ Beide Positionen änderten sich schnell und so entstanden im Kalten Krieg die pro-israelische Haltung der USA und die anti-israelische der Sowjetunion und wesentlicher Teile der Linken, nicht zuletzt im Kontext der 1968er-Bewegung. Jeffrey Herf weist jedoch nach, dass Israel „antirassistisch, antikolonialistisch und antifaschistisch“ war „(und war es von Anfang an)“. Wer heute Israel als ein Produkt der USA und des Westens angreift und glaubt, es gehöre zu einer linken Politik, Israel zu „kritisieren“, kennt die wechselvolle Geschichte des Landes, der verschiedenen zionistischen Bewegungen und der Staatsgründung Israels im Jahr 1948 nicht.
Jeffrey Herfs Essay „From the River to the Sea” erschien am 20. November 2020 (in: American Purpose Magazine). Er vergleicht die Botschaft der Hamas-Charta von 1988 mit ihrer Überarbeitung aus dem Jahr 2017, die oft herangezogen wird, um zu begründen, warum die sich auf die Hamas-Charta berufende BDS-Bewegung nicht antisemitisch wäre. Jeffrey Herf kommt zu einem anderen Ergebnis: „Die Verfasser der Charta von 2017 bedienten sich der säkularen Sprache der globalen Linken, um ihr reaktionäres, antisemitisches und fundamentalistisches Wesen zu verschleiern, aber die Realität eines religiösen Krieges gegen die Juden blieb im Zentrum dessen, was die Hamas war und ist. Alle drei Gesichter des Antisemitismus – rechts, links und islamistisch – sind in der Charta von 2017 genauso offensichtlich wie in der von 1988. Am 7. Oktober 2023 explodierte dieser religiöse und säkulare Hass mit einer Barbarei, die nur diejenigen überraschte, die die Wahrheit über den Krieg der Hamas gegen die Juden nicht direkt gesehen hatten, eine Wahrheit, die in diesen beiden bösen Dokumenten offenkundig war.“
Dies war im Übrigen auch schon die Taktik des Ajatollah Khomeini bei seiner Machtübernahme im Jahr 1979. Er verstand es, seine islamistische Agenda mit anti-kolonialistischen Inhalten zu verbinden, sodass auch damals schon manche sich als Linke verstehende Akteure im Westen glaubten, es handele sich bei ihm und seinen Genossen um eine Befreiungsbewegung. Die islamistische Agenda, die schon sehr schnell offensichtlich wurde, ignorierten sie (nachzulesen in der Biographie von Katajun Amirpur „Khomeini – Ein Revolutionär des Islams“, München, C.H. Beck, 2021). Immer wieder erleben wir, dass die islamistische Hamas in linken Kreisen als „Befreiungsbewegung“ verstanden wird, auch von Feminist:innen und Queers, die in einem von der Hamas geführten Staat mit Sicherheit nicht lange ihre Freiheit genießen dürften.
Der Streit um eine rechtsverbindliche Antisemitismusdefinition
Der Deutsche Bundestag hat am 7. November 2024 mit den Stimmen von CDU/CSU, SPD, Bündnis 90 / Die Grünen und FDP die lange umkämpfte Antisemitismus-Resolution unter dem Titel „Nie wieder ist jetzt – Jüdisches Leben in Deutschland schützen, bewahren und stärken“ beschlossen. Zwei Änderungsanträge der Gruppe „Die Linke“ und der Gruppe BSW wurden abgelehnt. In der Schlussabstimmung stimmte BSW gegen die Resolution, die Linke enthielt sich. Der Antrag von „Die Linke“ bezog sich auf in der FAZ veröffentlichte Formulierungsvorschläge verschiedener Wissenschaftler:innen und Nicht-Regierungsorganisationen. Die Gruppe BSW forderte einem Stopp von Waffenlieferungen an Israel sowie die Räumung der 1967 besetzten Gebiete. Wichtige Beiträge waren im Vorfeld die Gemeinsame Erklärung der Kulturstaatsministerin, der Kulturministerkonferenz und der kommunalen Spitzenverbände „Freiheit und Respekt in Kunst und Kultur. Strategien gegen antisemitische, rassistische und andere menschenverachtende Inhalte im öffentlich geförderten Kulturbetrieb“ vom 13. März 2024 sowie das Positionspapier „Freiheit der Kunst sichern – Antisemitismus und Rassismus im Kulturbereich bekämpfen!“ vom 1. Juli 2024. Am 4. November 2024 hatte sich der Deutsche Kulturrat zum Antrag geäußert und unter anderem eine entsprechende Mittelausstattung für den Kampf gegen Antisemitismus gefordert, beispielsweise in der historisch-politischen Bildung. Aber das ist eine andere Geschichte, angesichts der bisherigen und auch weiterhin wahrscheinlichen Kürzungen in Bundes- und Landeshaushalten für Vorhaben und Einrichtungen der historisch-politischen Bildung leider keine mit Aussichten auf ein verlässliches und gutes Ende.
Doch wie wird Antisemitismus vom Deutschen Bundestag definiert? Der Deutsche Bundestag hat sich mit seiner jüngsten Resolution wie auch bei früheren Beschlüssen auf die IHRA-Definition festgelegt. Zahlreiche Verbände, so zum Beispiel der Deutsche Kulturrat, folgten dieser Festlegung. Gegen die IHRA-Definition gab es Widerspruch von über 300 Wissenschaftler:innen, die als Alternative die Jerusalem Declaration vorgeschlagen haben. Der Hauptstreitpunkt zwischen beiden Definitionen liegt in der Frage der Bewertung von israelbezogenem Antisemitismus beziehungsweise der Frage, ob Antizionismus oder Kritik an der israelischen Regierung auch zugleich Antisemitismus sei. Darüber ließe sich streiten, aber leider reduziert sich dieser Streit in der Regel auf den Austausch unvereinbar erscheinender Positionierungen. Saba-Nur Cheema und Meron Mendel haben in ihrer FAZ-Kolumne „Wie politisch darf die Wissenschaft sein?“ (nachlesbar jetzt auch in dem Sammelband „Muslimisch jüdisches Abendbrot“ (Köln, Kiepenheuer & Witsch, 2024) angemerkt, dass „der Unterschied zwischen einer wissenschaftlichen Konferenz an der Universität und einer Talkshow oder einem Stammtischgespräch nicht mehr deutlich erkennbar“ sei. Sie spitzen ihre Kritik in der Bemerkung zu: „Ob sich Max Weber Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts hätte vorstellen können, dass Wissenschaftler sich eines Tages lieber mit Unterschriften statt mit Argumenten gegenseitig überbieten wollen?“
In der Februarausgabe 2025 des Merkur gibt es zwei Texte, die einen fachlichen Diskurs befördern könnten, aber zugleich auch zeigen, wie schwer es ist, sich allein schon auf den Gegenstand des Diskurses zu einigen. Stefan Hirschauer, Soziologieprofessor an der Universität Mainz, sieht in seinem Essay „Wer definiert, was Antisemitismus ist?“ (online frei lesbar) die Berufung auf die IHRA-Definition kritisch. Eine Gegenposition vertritt Marietta Auer, Rechtskolumnistin des Merkur, in ihrem Text „Definiere Antisemitismus“ (auch dieser Text ist online frei lesbar.)
Stefan Hirschauer kritisiert mit Recht, dass die am 7. November 2024 beschlossene Bundestagsresolution den „Fokus auf Antisemitismus unter Immigranten“ legt, und verweist auf die Kritik, „dass die Resolution eine bestimmte Definition von Antisemitismus rechtsverbindlich machen will.“ Nicht zuletzt auch in Hinblick auf die Vergabe von Fördermitteln. In der IHRA-Definition sieht er jedoch nicht mehr und nicht weniger „als ein abstraktes Symbol: ein Mahnmal.“ Vor allem messe die Definition mit zweierlei Maß, weil sie „ein klares Sprechen über die so illegitime wie rechtswidrige Gewalttätigkeit von Juden in Palästina blockiert.“ Nachvollziehbar ist seine Prognose, „dass die Regierung Netanjahu zwar die Existenz des Staates Israels mit seiner militärischen Defensiv- wie Offensivüberlegenheit klar behaupten kann, die Anerkennung seines Existenzrechts, seine internationale Legitimität, aber nachhaltig beschädigt haben wird.“ Aber letztlich werde durch die Resolution des Bundestages wie durch die IHRA-Definition Antisemitismus „eine undifferenzierte Diffamierungsvokabel gegen Personen (…), die sich in einer unerwünschten verbalen Schärfe oder unerwünschten affektiven Lautstärke gegen die unerträgliche Politik Israels im Nahen Osten wenden.“ Mit anderen Worten: Die IHRA-Definition richte sich gegen jede Kritik an der israelischen Besatzungspolitik wie an dem Vorgehen Israels nach dem 7. Oktober in Gaza. Dieses Ungleichgewicht nennt er „Asymmetrische Empathie“. Stefan Hirschauer verweist darauf, dass selbst „der Chef des israelischen Inlandsgeheimdiensts das Verhalten der Siedler (dabei bezog er sich auf das Vorgehen der sogenannten „Hügeljugend“ im Westjordanland, NR) unumwunden ‚jüdischen Terrorismus‘ nennt“, eine Formulierung, die in Deutschland undenkbar wäre.
Marietta Auer hält fest: „Nach reiner liberaler Grundrechtslehre gibt es innerhalb der durch das Strafrecht abgesteckten Grenzen grundsätzlich keinen Raum für staatliche Meinungspolitik.“ Andererseits befinde sich der liberale Rechtsstaat „in einer paradoxen Lage: Dass ‚Antisemitismus keine Meinung‘ sei, (…) ist zwar moralisch richtig, aber rechtlich strenggenommen falsch.“ Bei der Beurteilung eines jeweiligen Falls helfen die unterschiedlichen Definitionen wenig, vieles verbliebe in der Jerusalem Declaration „im Gestus der Behauptungsrhetorik“, insbesondere die Passage, dass BDS „nicht per se antisemitisch“ wäre, weil „Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen“ als „gängige, gewaltfreie Formen des politischen Protests gegen Staaten“ anzusehen wären. Es habe sich inzwischen bei der Frage der Definition von Antisemitismus ein „Stellvertretergefecht in einem politischen Stellungskampf“ entwickelt, „in dem sich schon lange vor dem 7. Oktober 2023 unversöhnliche Fronten gegenüberstanden“. Aus juristischer Sicht hilft dieser Streit niemandem. Juristen „konzentrieren sich auf die Lösung konkreter Fälle und bilden ihre Begriffe danach.“ Dies bedeutet, dass „Antisemitismus“ wie auch andere „Rechtsbegriffe“ – Marietta Auer nennt als Beispiel den Begriff „Eigentum“ – „unbestimmt sind und die Hauptlast der Konkretisierung immer am konkreten Fall und nicht an der abstrakten Definition hängt.“ Diese Unbestimmtheit gilt auch für Förderfragen. Es ist legitim, dass das Parlament als Gesetzgeber „einen nicht rechtsverbindlichen Text wie die IHRA-Definition in geltendes Recht zu überführen“ fordert.
Eine rechtsverbindliche Definition ist im Grunde kaum machbar. Letztlich bleibt es bei Kasuistik, aber dennoch sollten die IHRA-Definition, gegebenenfalls in Reflexion der Differenzierungen der Jerusalem Declaration oder anderer Definitionen genug Anhaltspunkte geben, konkretes Recht zu praktizieren. Auch das Strafrecht hat seine Grenzen. Maximilian Pichl schreibt in seinem Beitrag zu dem von Ann-Kristin Tlusty und Wolfgang M. Schmitt herausgegebenen Band „Selbst Schuld!“ (München, Hanser, 2024): „Das Strafrecht ist auf die Strafbarkeit des Einzelnen gepolt, seine psychologischen und sozialen Dispositionen werden berücksichtigt, die gesellschaftlichen Zustände kommen hingegen immer nur vermittelt in das Strafverfahren hinein. Rudolf Wiethölter stellt daher schon in seinem Standardwerk Rechtswissenschaft von 1968 die Frage, ob es mit dem zivilisatorischen Fortschritt im Recht tatsächlich so weit her ist: ‚Wenn wir also heute davon sprechen, Schuld müsse Sühne finden, lebt in uns dieses mythische Ursache-Wirkung-Denken, zugleich Rache- und Vergeltungsgefühle‘. Bei Verbrechen aller Art wird dieser auch in die Moderne eingelagerte Affekt in der Boulevardpresse und den sozialen Medien mobilisiert.“
Anders gesagt: Auch die Organe des Rechtsstaats müssen sich in jedem einzelnen Fall mit der Tragweite des „Gerüchts über die Juden“ auseinandersetzen. Das gilt beim Strafrecht von der Anzeige bis zum Urteil und schließlich zum Vollzug der Strafe. Noch schwieriger wird es, wenn Behörden darüber zu entscheiden haben, ob sie gegebenenfalls einem Antragsteller die finanziellen Mittel verweigern können, wenn sich dieser nach ihrer Auffassung „antisemitisch“ äußere oder betätige. In Berlin scheiterte der Senat mit einer für solche Fälle vorgesehenen Antisemitismusklausel, in Schleswig-Holstein gibt es eine weichere Formulierung, die jedoch bisher entweder nicht angewandt wurde oder eben einfach sich nicht vor Gericht bewähren musste. Eine Staatssekretärin wurde von ihrer Ministerin allen wegen eines Prüfauftrags, ob der Entzug von Mitteln bei antisemitischer Betätigung möglich wäre, entlassen.
Die IHRA-Definition gibt für all diese Fall-Konstellationen wenig her. Sie hat allenfalls eine heuristische Dimension. Die Jerusalem Declaration stellt erst gar nicht die Frage nach den Rechtsfolgen. Immerhin hat die IHRA-Definitionen einen Vorteil. Sie hält das politische Ziel fest, dass sich Jüdinnen und Juden sicher fühlen können, dass sie frei von Beleidigungen, Unterstellungen und physischer Gewalt leben können. Das müsste eigentlich auch ohne eine Definition von Antisemitismus gelten.
Rechtsanwendung in der täglichen Praxis
Zur Rechtsanwendung im Kontext Antisemitismus haben Linda Giesel und Jens Borchert in Zusammenarbeit mit Franziska Sujeba im Jahr 2024 bei Beltz Juventa den Band „Der Rechtsstaat im Kampf gegen Antisemitismus“ herausgegeben. Im Untertitel verspricht der Band „Perspektiven auf Polizei, Justiz und Strafvollzug“ und thematisiert damit den Rahmen, in dem die Organe des Rechtsstaats handeln beziehungsweise handeln könnten: „Der Sammelband setzt sich damit auseinander, wie der Rechtsstaat im Kampf gegen aktuelle antisemitische Erscheinungsformen vorgeht, welche Herausforderungen sich daraus ergeben und wie diesen begegnet werden kann.“ Grundlage sind zwei Forschungsprojekte, die von der Hochschule Merseburg und dem Anne Frank Zentrum Berlin durchgeführt wurden (es gibt eine eigene Veröffentlichung des Anne Frank Zentrums). Die Beiträge des Bandes und die darin vorgestellten Studien beziehen sich auf die IHRA-Definition.
Es wäre sicherlich interessant gewesen, wenn ein Kapitel sich auch mit der Analysekompetenz der Verfassungsschutzbehörden auseinandergesetzt hätte, die zwar kein Organ des Rechtsstaats sind, aber auf deren Analysen Polizei und Justiz aufbauen könnten. Ebenso wäre es interessant, die Frage zu erörtern, ob die Organe des Rechtsstaats in dieser Thematik evidenzbasiert handeln können, indem die Ergebnisse und Verfahren wissenschaftlicher Forschung Gegenstand von Aus- und Fortbildung werden. Mitunter drängt sich der Eindruck auf, dass die Akteure in Polizei und Justiz sich mehr oder weniger auf ihren jeweiligen persönlichen Lese- und Medienerfahrungen verlassen müssen.
Der Band enthält lesenswerte 14 Texte (einschließlich der Einleitung). Diese thematisieren die jüdischen Perspektiven, beziehen sich auf Studien vor allem in Berlin und in Nordrhein-Westfalen, heben die gute Praxis in Sachsen-Anhalt hervor. Ein wichtiger Aspekt in mehreren Texten ist die Frage nach dem „Dunkelfeld“. Was wissen wir eigentlich über Antisemitismus? Und warum werden so viele antisemitische Vorfälle offenbar unbekannt? Diese Frage gilt allerdings für alle gesellschaftlichen Bereiche, nicht nur für Polizei und Justiz. Immerhin gibt es seit mehreren Jahren, zunächst in Berlin, inzwischen in mehreren Bundesländern die Meldestellen des bundesweiten Netzwerks RIAS. Die Meldestellen erfassen Meldungen von Jüdinnen und Juden, auch unterhalb der Strafbarkeitsschwelle, und sorgen für entsprechende Beratung und Unterstützung, gegebenenfalls auch im Hinblick auf – da wo erforderlich – eine Anzeige bei Polizei und Staatsanwaltschaft. Jährlich werden Berichte veröffentlicht.
Samuel Salzborn stellt in seinem Beitrag Wege zur Erhellung des Dunkelfelds am Beispiel von Berlin vor. Grundlage ist ein Beschluss des Abgeordnetenhauses vom 31. Mai 2018 und des Senats vom 12. März 2019. Grundlage ist auch hier die IHRA-Definition. Das Konzept erfasst „die drei zentralen Säulen – Prävention, Intervention und Repression – der Antisemitismusbekämpfung integral“. Zur Umsetzung gehört auch „eine systematische Vernetzung zwischen den Senatsverwaltungen des Landes Berlin“. Ob gegebenenfalls Datenschutzregelungen die „Vernetzung“ unter den Behörden behindern, wie in der Terrorismusbekämpfung durchweg gang und gäbe, ist nicht Thema des Beitrags. Ein zentraler Punkt ist die Frage der Strafbarkeit, insbesondere nach der „Erweiterung von § 46 StGB und der ausdrücklichen Aufnahme von antisemitischen (und anderen menschenfeindlichen, NR) Beweggründen und Zielen als strafschärfende Motive“.
Die Erkenntnis „antisemitischer Beweggründe“ ist jedoch nicht einfach. Samuel Salzborn belegt dies an dem Urteil nach einem Anschlag auf die Wuppertaler Synagoge 2014, in dem das Gericht keine antisemitischen Motive erkennen wollte, da die Täter doch nur die israelische Besatzungspolitik zum Anlass ihrer Tat genommen hätten, sowie der fehlenden Sicherheitsvorkehrungen in der Synagoge von Halle im Jahr 2019, als die Sicherheitsbehörden die Gefährdungslage zu Yom Kippur ignorierten. Die Meldestatistiken nennen unterschiedliche Zahlen. Beispielsweise zählte RIAS im Jahr 2021 848 Vorfälle, die Staatsanwaltschaft leitete 691 Verfahren ein, die Polizei zählte 381 Fälle. Der Abstimmungsbedarf ist offenbar erheblich. Dies betrifft auch die seit langem in die Kritik geratene PMK („Politisch motivierte Kriminalität“). Samuel Salzborn stellt fest: „Die Differenz zwischen Vorfällen und Fällen macht dabei deutlich, wie wichtig es für eine gesellschaftliche Wahrnehmung von Antisemitismus ist, diesen als aus Einstellungen folgendes Verhalten von Diskriminierung zu begreifen.“ Die PMK und andere Statistiken sind auch Gegenstand eines eigenen Beitrags von vier Kolleg:innen von RIAS. Sie vermerken, dass es in den Statistiken einen „subjektiven Faktor“ gebe, der nicht mehr und nicht weniger den gesellschaftlichen Einstellungen entspreche: „Die Vorstellung, dass politisch motivierte und damit die darunter subsumierte Hasskriminalität Angelegenheit politischer Randgruppen sei, kaschiert die Tatsache, dass Antisemitismus und andere Ideologien der Ungleichheit weit verbreitete Erscheinungen moderner Gesellschaften sind.“ So komme es immer wieder zu Zirkelschlüssen, zumal sich Antisemit:innen immer leicht herauszureden wissen, dass sie doch gar keine Antisemit:innen wäre, weil sie sich ja nur über die israelische Politik äußerten. RIAS arbeitet gezielt gegen solche Verharmlosungen an.
Die Aufgabe der Sicherheitsbehörden lässt sich im Grunde recht einfach formulieren, in den Worten von Julia Bernstein und Florian Diddens: „Mit antisemitischen Vorfällen konfrontiert, ergibt sich für Betroffene zunächst das Problem, einschätzen zu müssen, ob oder worin diese einen strafbewehrten Charakter haben, als illegal gelten und zur Anzeige gebracht werden können.“ Julia Bernstein hat sich – gemeinsam mit Florian Diddens – maßgeblich mit israelbezogenem Antisemitismus auseinandergesetzt und dazu auch mehrfach veröffentlicht, unter anderem in ihrem Buch „Israelbezogener Antisemitismus – Erkennen – Handeln – Vorbeugen“ (Weinheim / Basel, Beltz Juventa, 2021). Julia Bernsteins Bücher enthalten didaktische Hinweise und ergänzende online-Materialien, die zwar für Schule gedacht sind, aber sich sicherlich auch für die Aus- und Fortbildung von Mitarbeiter:innen in Polizei, Justiz und Strafvollzug eignen.
Einen Forschungsbericht zum Antisemitismus in der Polizei bieten Marina Chernivsky und Friederike Lorenz-Sinai. Dies erfolgt im Hinblick auf die in den jüdischen Gemeinschaften verbreiteten Unsicherheiten, die sich auch in fehlendem Vertrauen in die Polizei äußerten. Die beiden Autorinnen haben bei der Analyse der Einstellung von Lehrkräften festgestellt, dass betroffene jüdische Schüler:innen deren Reaktion „nicht als schützend“ erfahren. Sie erleben „wirkungslose Interventionen, die ihre Lage in der Klasse verschlimmern; Passivität sowie das Absprechen und Umdeuten ihrer Erfahrungen und Beschwerden.“ Oft genug verlassen jüdische Schüler:innen die jeweilige Schule, während die Täter:innen unbehelligt bleiben. Eine angemessene Unterstützung, die dann zu einer Anzeige führte, berichten sie als Ausnahme. Doch hindern die Vorbehalte gegenüber der Polizei, die solche Anzeigen nicht ernst nehme, oft genug, dass eine solche Anzeige überhaupt gestellt wird. Eine junge Frau berichtet, dass ihre Mutter Polizisten vor einer jüdischen Einrichtung einen Kaffee angeboten habe, diese jedoch geantwortet hätten: „von dreckigen Juden nehmen sie keinen Kaffee“.
Man mag einen solchen Bericht anekdotisch nennen, aber das ist er nicht. Es stellt sich die Frage, wie viel Hierarchie, wie viel „Korpsgeist“, wie viel autoritäre Hörigkeit in Menschen mit hoheitlichen Aufträgen (zum Beispiel bei Polizist:innen, Lehrer:innen, auch bei Sozialarbeiter:innen) steckt, der von einer entsprechenden antisemitisch eingestellten Regierung nur noch aktiviert werden müsste. Durchweg thematisieren die Beiträge des Buches, in denen jüdische Perspektiven benannt werden, das „Erfahrungswissen, ‚dann stehen wir als Juden alleine da‘“.
Ob Bildung hilft, ist eine spannende Frage. Eine Interviewstudie zu Einstellungen in der Polizei Nordrhein-Westfalens, die von den Forschenden vorgestellt wird (Sarah Jadwiga Jahn, Jana-Andrea Frommer, Marc Grimm und Jakob Baier) vermerkt, es sei „auffällig, dass die konkrete Nachfrage, ob es Berührungspunkte und Erfahrungen mit Antisemitismus im Berufsalltag gäbe, ebenfalls überwiegend verneint wurde“. Dies gelte für alle Einsatzbereiche, gleichviel ob bei Demonstrationen, beim Objektschutz, in der Bereitschaftspolizei, dem Staatsschutz oder dem Streifendienst, ebenso bei politisch motivierter Kriminalität. „Aus den Interviews wird deutlich, dass Polizeibeamt:innen oftmals Schwierigkeiten haben, Antisemitismus überhaupt zu erkennen, zu benennen und einzuordnen.“
Zum selben Ergebnis kommen Befragte im Rahmen des Berliner Projekts Regishut, das Alexander Lorenz-Milord und Alexander Steder vorstellen. Einerseits ist „die hohe Bereitschaft zur Weiterbildung“ ein gutes Zeichen, obwohl sich auch hier fragen ließe, ob diese in den Interviews als gewünschtes Verhalten zu bewerten wäre, denn andererseits wird die „Gefahrenlage, der sich jüdische Menschen und Einrichtungen ausgesetzt sehen“, erheblich unterschätzt oder gar banalisiert. Im Ergebnis führt dies zu „einer sekundären Viktimisierung“ – so Julia Bernstein ihrem Beitrag: „Die zurückliegenden Erfahrungen mit Strafverfolgungs- und Justizbehörden sind häufig das Kriterium für die Entscheidung, antisemitische Äußerungen oder Taten nicht zur Strafanzeige zu bringen.“
Mikrokosmos Haft
Die beiden Texte von Linda Giesel, die sich mit dem Strafvollzug, in einem Fall mit dem Jugendstrafvollzug auseinandersetzen, machen etwa ein Drittel des Gesamtumfangs des Buches aus. In „Eingesperrt – Zur räumlichen und zeitlichen Spezifik der Haft“ befasst sich Jens Borchert grundsätzlich mit dem Strafvollzug, der zwei Prinzipien zu folgen habe, dem „Rechtsstaatsprinzip“ und im Hinblick auf die Vorbereitung auf die Zeit nach der Haft dem „Sozialstaatsprinzip“. Gefängnisse sind eine „totale Institution“, deren Geschichte vor allem Michel Foucault in seinem Buch „Überwachen und Strafen“ (die deutsche Ausgabe erschien 1977 bei Suhrkamp) beschrieben hat. Jens Borchert sieht „die doppelte Unsichtbarmachung in der Haft“, im Hinblick auf die Gesellschaft, die die Inhaftierten aus ihrem Blickfeld ausschließe wie auf die „frühere Identität der inhaftierten Person“, sodass in der Haft eine Art „Gefangenensubkultur“ entsteht, die „bei aller Fraternisierung stets Ausschließungspraktiken“ erzeuge, die durchaus mit Gewalt durchgesetzt werden.
Die Haft ist ein Mikrokosmos, in dem sich Verhaltensweisen manifestieren wie sie sich auch in anderen gesellschaftlichen Milieus zeigen, beispielsweise in der Polizei oder in der Justiz, in der – wie die Aufarbeitung von immer wieder feststellbaren Chatgruppen gerade unter Polizist:innen belegt – oft eine Art Korpsgeist herrscht, der politisch nicht immer mit der erforderlichen Entschiedenheit bekämpft wird (der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) ist in diesem Kontext einer derjenigen, die diese Entschiedenheit deutlich vortragen und auch praktizieren, beispielsweise schon im Jahr 2021 mit seiner Forderung nach Supervision, dass Polizist:innen ihre eigene demokratische Haltung ständig überprüfen sollten.).
Linda Giesel kann sich in ihren Beiträgen auf das Forschungsprojekt „Antisemitismus im Strafvollzug – Empirische Forschung und Prävention“ der Hochschule Merseburg und des Anne Frank Zentrums beziehen. Sie hält fest: „Antisemitismus ist ein Weltdeutungssystem, das auf kognitiven Einstellungen und emotionalen Abwehrmechanismen gegen Jüdinnen:Juden beruht.“ Der „kulturelle Code“, von dem Shulamit Volkov spricht, wirkt auch in der Haft, Post-Shoah-Antisemitismus, israelbezogener Antisemitismus, die Unterstellung von jüdischem Reichtum, die sich beispielsweise darin äußert, dass im Tauschhandel erfolgreiche Personen als „Jude“ bezeichnet werden.
Die Haftsituation führt gerade auch im Kontext des Antisemitismus zu höchst problematischen Entwicklungen, beispielsweise – so Linda Giesel – „verbrüdern sich unterschiedliche Inhaftierte basierend auf antisemitischen Ressentiments“, mitunter auch über eine „Koalitionsbildung (…) wenn sich Inhaftierte und Beamt:innen bspw. In ihren autoritären und antidemokratischen Einstellungen ähneln.“ Solche Koalitionen sind nicht unüblich, denn es gibt durchweg eine Form von „Anpassung“ an die Gepflogenheiten in einem geschlossenen System. Antisemitismus erhält eine „identitätsstiftende Funktion (…), auf deren Basis ein ‚Wir-Gefühl‘ ausgebildet werden kann“. In der Haft sind auch Radikalisierungen feststellbar. Die befragten JVA-Fachkräfte „beziehen sich dabei auf rechte Jugendliche als Träger von Antisemitismus und zum anderen auf muslimische, arabische oder als solche wahrgenommene Jugendliche“. Die Externalisierung von Antisemitismus auf Migranten, insbesondere „Flüchtlinge“ und die Verengung auf einen religiös motivierten Antisemitismus von Muslimen ist in bei JVA-Mitarbeiter:innen ebenso feststellbar wie ohnehin in der Gesellschaft, ebenso die „Deutung von Antisemitismus als Unterkategorie des Rassismus“. Tim Hendlmeier ergänzt in seinem Beitrag, dass Antisemitismus „oft in kriminologischen Studien lediglich als Unterkategorie der Hass- und Vorurteilskriminalität betrachtet“ wird. Genannt werden – so Linda Giesel – auch „defizitäre Familienverhältnisse“ oder „mangelndes (Geschichts-)Wissen“.
Jüdische Inhaftierte versuchen ihr Jüdischsein möglichst zu verbergen, um nicht Opfer solcher Ressentiments zu werden. Eine JVA-Lehrkraft wies im Interview darauf hin, dass ein jüdischer Inhaftierter besonders geschützt werden musste: „Weil klar war, wenn das rauskommt / Das ist wie / Jude und Leute mit Kindersex stehen quasi auf derselben Stufe“. Durchweg fehlt es an „Sensibilität“ und „Problembewusstsein“. Es wäre interessant, diese Erkenntnisse im Hinblick auf andere von Exklusion und Mobbing betroffene Gruppen zu überprüfen, beispielweise im Hinblick auf Sinti und Roma, Muslime, Transpersonen oder nicht zuletzt in Männerhaftanstalten in den dortigen Einstellungen gegenüber Frauen. Menschen, die sich in den gesellschaftlichen Hierarchien weit unten befinden, neigen ohnehin dazu, jemanden zu finden, der noch weiter unten platziert werden könnte, gleichviel ob es sich um jemanden im näheren Umfeld oder – wie im Fall von Frauen im Männerstrafvollzug – in einem weitestgehend unerreichbaren Außen handelt.
Gäbe es Möglichkeiten, auf die Inhaftierten im Sinne des von Jens Borchert betonten „Sozialstaatsprinzips“ einzuwirken? Durchaus, allerdings konzentrieren sich Strafmaßnahmen in der Haft zunächst auf Repression, zum Beispiel Einschluss in Einzelhaft, somit Isolation, oder Entzug bestimmter Freiheiten oder der Bezahlung. Linda Giesel zitiert einen JVA-Lehrer, der „die fehlenden pädagogischen und psychologischen Reflexionen in dieser Hinsicht“, durchaus auch ein Bild vergleichbarer Debatten in der Gesellschaft, wenn beispielsweise primär auf den Entzug von Sozialleistungen gesetzt wird, nicht jedoch auf perspektivische Beratung und Unterstützung. Katinka Meyer und Jona Schapira referieren „Erfahrungen des Anne Frank Zentrums in der Arbeit mit den beiden Zielgruppen Inhaftierte (…) und Mitarbeiter:innen der Justizvollzugsanstalten“. Dau gehört auch die Wanderausstellung „‚Lasst mich ich selbst sein‘ – Anne Franks Lebensgeschichte“, die seit 2004 in etwa 50 Projekten in Jugend- und Erwachsenenvollzug gezeigt wurde. Hilfreich sind auch „Peer Guides“, durch die Inhaftierte „Selbstwirksamkeit innerhalb der Institution Gefängnis“ erfahren. Allerdings weisen Peer Guides auch darauf hin, dass sich „Melde- und Beratungsstrukturen, etwa der Anstaltsbeirat, als unwirksam oder gar kontraproduktiv“ erweisen (können), nicht zuletzt, weil es an Wissen beziehungsweise an Zugang fehle. Es gilt, was in anderen Institutionen auch gilt, dass „Melde- und Beratungsstrukturen“ sich zu oft in paternalistischen Modi erschöpfen. Seit 2020 bietet das Anne Frank Zentrum die Fortbildung „Antisemitismus im Strafvollzug wirksam begegnen“ an. Sechs Bundesländer beteiligten sich bereits. „Die kritische Selbstreflexion der Mitarbeiter:innen hinsichtlich eigener antisemitischer Prägungen ist daher ein wichtiger Bestandteil in der Bildungsarbeit zu Antisemitismus im Strafvollzug.“ Und nicht nur dort.
Botschaftstaten und Verantwortlichkeiten
Tim Hendlmeier fasst die Einschätzungen der Autor:innen des Bandes mit der folgenden Formulierung zusammen: „Antisemitische Taten sind Botschaftstaten. Sie zielen nicht nur auf die unmittelbar Betroffenen, sondern auf alle Jüdinnen:Juden. Jedoch hat nicht nur die Tat, sondern auch der Umgang durch Polizei und Justiz Botschaftswirkung auf Jüdinnen:Juden. Ein Bewusstsein hierfür ist zentral für eine Verbesserung des Vertrauens in die Strafverfolgungsbehörden und die Justiz. Dieses Vertrauen ist notwendig, um die angesprochene niedrige Anzeigebereitschaft zu verbessern, um somit Antisemitismus in der Gesellschaft gezielter verfolgen zu können.“
Für Polizei, Justiz und Strafvollzug gilt, was für die Gesellschaft im Allgemeinen gilt, insbesondere für die Menschen, die hoheitliche Aufgaben wahrnehmen. Polizei, Justiz und Strafvollzug unterscheiden sich jedoch von anderen hoheitlichen Bereichen dadurch, dass ihre repressiven Möglichkeiten zur Prävention von und zur Intervention bei Straftaten einer besonderen Aufmerksamkeit bedürfen, weil sie letztlich den gesellschaftlich vereinbarten Willen durchzusetzen vermögen, ungeachtet der Frage, welche akademischen Debatten über Definitionen geführt werden. Der „kulturelle Code“ des Antisemitismus besteht nach wie vor. Es ist nur die Frage, ob wir ihn erkennen und damit auch bekämpfen können.
Das ist die eine Seite. Die andere Seite sind klare Verantwortlichkeiten. So sehr manche die Beauftragten in Bundes- und Landesregierung und zum Teil auch in Kommunen kritisieren mögen, so sind doch solche Beauftragte ein wichtiges Zeichen in die (nicht nur) jüdischen Gemeinschaften hinein, dass ihre Sicherheit ein grundlegendes Anliegen des Staates ist. Thomas Kluger beschreibt seine Erfahrungen in Sachsen-Anhalt, wo er am 1. Dezember 2022 zum Antisemitismusbeauftragten für die Justiz ernannt wurde. Er ist bei der Generalstaatsanwaltschaft Naumburg angesiedelt und „hat innerhalb der Justiz eine Koordinierungs- und Vernetzungsfunktion“ und steht „als zentraler justizinterner Ansprechpartner für Fragen bei antisemitischen Straftaten, etwa zur Bewertung antijüdischer, israelbezogener und Post-Shoa-Antisemitismus-Aspekte eines Tatgeschehens, zur Verfügung“. Grundlage ist ein Beschluss der Justizministerkonferenz. In Nordrhein-Westfalen gibt es 19 Antisemitismusbeauftragte bei den Staatsanwaltschaften, in Hessen gibt es einen Beauftragten im Landesjustizministerium. Bundesweit einzigartig ist die Freistellung des Antisemitismusbeauftragten für die Justiz in Sachsen-Anhalt zu 100 Prozent. Thomas Kluger stellt fest: „Nur dort, wo sich jüdisches Leben ungestört von Übergriffen und geschützt durch Prävention und Sanktion in Sicherheit entwickeln kann, wird sich der Rechtsstaat las wehrhaft erweisen. Justizielle Antisemitismusbeauftragte spielen daher eine zentrale Rolle, um den Kampf gegen den Antisemitismus zu stärken.“
Norbert Reichel, Bonn
(Anmerkungen: Erstveröffentlichung im Februar 2025, Internetzugriffe zuletzt am 24. Februar 2025.)