Liebe Freund:innen des Demokratischen Salons,
der Newsletter des Demokratischen Salons für Januar 2025 erscheint etwa drei Wochen vor der Bundestagswahl, die uns mitunter bei all den vielen Botschaften auf Plakaten, in Talkshows und Wahlveranstaltungen irritieren mag. Es ist vielleicht etwa so wie in den Reiseberichten des Marco Polo in „Le cittá invisibili“ („Die unsichtbaren Städte“) von Italo Calvino. Marco Polo berichtet Kublai Kahn beispielsweise von der Stadt Diomira, in der Neuankommenden Postkarten gezeigt werden, wie die Stadt früher einmal ausgesehen habe, aber niemand weiß, ob es sich tatsächlich um Diomira handelt oder um eine Stadt gleichen Namens.
Themen der im Januar 2025 neu veröffentlichten Texte im Demokratischen Salon sind die anstehenden Präsidentschaftswahlen in Polen, die Krise der Demokratie in der Slowakei, Workshops zur Dramatherapie in der Ukraine, Menschenrechte in der deutschen und europäischen Außenpolitik, die Perspektiven kleiner Parteien zur Bundestagswahl, Fragen, wie sich der Klimawandel in der Literatur erzählen lässt und ob wir möglicherweise in einer Simulation leben, die Biographien der in der SBZ und der frühen DDR verfolgten Demokrat:innen sowie eine Analyse der neuen Zeitenwende, als die der 29. Januar 2025 sich möglicherweise erweisen könnte.
Im Editorial kommentiert Franz-Reinhard Habbel die so oft zitierte „Zeitenwende“ mit einem „etwas anderen Blick auf die Wahlprogramme“: „Es ist an der Zeit“. Wir brauchen keine vorschnellen Antworten, wohl aber qualifizierte Debatten über die grundlegenden Fragen unserer Zeit.
Nach den Kurzvorstellungen der neuen Texte lesen Sie Vorschläge zum Besuch von Veranstaltungen und Ausstellungen, darunter „Wir werden wieder tanzen“ (vier Orte in Nordrhein-Westfalen), die aktuelle Tournee des Puppentheaters Bubales (unter anderem in Dorsten, Frankfurt am Main, Hannover und Köln), Jüdisches Leben und 35 Jahre deutsche Einheit (Berlin), Demokratiebildung auf der didacta (Stuttgart), Versöhnung – eine Utopie (Bonn), Polnisches Schreiben (Darmstadt), die Gruppenausstellungen „Swaying the Current“ (Berlin) und „Steine räumen für den Frieden“ (Bonn), ein Vortrag über jüdische Sakralbauten nach 1945 (Bochum), Ausstellungen zur Exil-Kunst aus der Sammlung von Thomas B. Schumann (Siegburg) und zum Ende des Lebens (Frankfurt am Main) sowie das Kunstfest Weimar.
Die Leseempfehlungen und Hintergrundinformationen bieten Lesens- und Wissenswertes zu Berichterstattung und Lage der aus der Gewalt der Hamas befreiten Geiseln, zur Propaganda der Hamas, zum aktuellen Global Risk Report, zu den Debatten um soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz, zu Opferrenten für NS-Täter, zu Bundestagsabgeordneten, die nicht mehr kandidieren, zu Sicherheitsgesetzen in Italien, dem Paradox, dass rechte Regierungen mehr Migration statt weniger bewirken, zur gelingenden Integration in einer sizilianischen Gemeinde, und dem Niedergang einer US-amerikanischen Gemeinde nach einer Abschiebeaktion im Jahr 2008, zu Wikipedia von rechts, zu einer Analyse von unterschiedlichen Formen der Kriege in unserer Zeit, der neuen Oberbürgermeisterin in Diyabakır, dem Terrorregime im Iran, zum Aufstieg Katars zum Global Player, den USA als Land der unbegrenzten Unmöglichkeiten, zu Bangladesh, das der „Economist“ zum „Land des Jahres“ ernannte, zum Mythos Neutralitätsgebot in Schulen, Hochschulen und Kultur, zur prekären Lage von Bibliotheken, zum Judentum in Bildungsmedien, zur Überlastung der Jugendämter und last not least zu zwei weiteren Übersetzungen aus dem Demokratischen Salon ins Ukrainische (ein Essay von Fritz Heidorn und das Gespräch mit Zara Zerbe).
Die neuen Texte im Demokratischen Salon:
 Ines Skibinski berichtet über den Beginn des Wahlkampfs um das Amt des Präsidenten in Polen im Mai 2025: „Ein entscheidendes Jahr“. Sie stellt die Kandidat:innen der Parteien vor. Wahrscheinlich ist eine Stichwahl zwischen den Kandidaten von PO und PiS. Wie werden sich die anderen Parteien verhalten? Wird die Wahl die aktuellen Blockaden des noch von der PiS gestellten Präsidenten gegen die Gesetzesvorschläge der von PO geführten Dreierkoalition auflösen? Welche Rolle spielen in der Regierung strittige Gesetzesvorhaben? (Rubriken: Osteuropa, Europa)
Ines Skibinski berichtet über den Beginn des Wahlkampfs um das Amt des Präsidenten in Polen im Mai 2025: „Ein entscheidendes Jahr“. Sie stellt die Kandidat:innen der Parteien vor. Wahrscheinlich ist eine Stichwahl zwischen den Kandidaten von PO und PiS. Wie werden sich die anderen Parteien verhalten? Wird die Wahl die aktuellen Blockaden des noch von der PiS gestellten Präsidenten gegen die Gesetzesvorschläge der von PO geführten Dreierkoalition auflösen? Welche Rolle spielen in der Regierung strittige Gesetzesvorhaben? (Rubriken: Osteuropa, Europa)
- Michal Hvorecky stellt in seiner Bilanz des Jahres 2024 fest: „Die Slowakei ist in einer tiefen Krise“. Dies gilt vor allem für Kultur und Justiz, aber auch in der Außenpolitik gibt es Veränderungen, die Anlass zu höchster Besorgnis geben. Die Dreierkoalition aus SMER, HLAS und SNS verliert jedoch an Stabilität. Dies bedeutet noch nicht, dass die größte Oppositionspartei, die PS, bald eine neue Regierung bilden könnte. In der Zivilgesellschaft breitet sich Frustration aus. Großen Unmut gibt es angesichts eines vorerst abgewendeten, aber möglicherweise nur vertagten Streiks der Ärzt:innen. (Rubriken: Osteuropa, Kultur)
- Michael D. Reisman hat im Herbst in Lviv, Irpin und Kyiv mit Psycholog:innen, Studierenden und Künstler:innen Workshops der Dramatherapie (DvT) durchgeführt. In „Trauma und Katharsis“ beschreibt er die Potenziale und Grundlagen von Dramatherapie, auch in Bezug auf Psychodrama und Playback-Theater als Instrumente zur Erkenntnis und Bewältigung psychischer Belastungen sowie die sehr positiven Erfahrungen der Workshops. Etwa ein Drittel der Menschen in der Ukraine leiden unter diagnostizierbaren psychischen Störungen, etwa 57 Prozent sind gefährdet. (Rubriken: Kultur, Osteuropa)
- Max Lucks, Menschenrechts- und Außenpolitiker im Deutschen Bundestag (Bündnis 90 / Die Grünen), fordert: „Priorität Menschenrechte“. Er erklärt die prekäre Lage der Êzîd:innen in Deutschland und im Irak im Kontext der Interessen der Türkei, des Iraks und des Iran sowie der schwierigen Situation der Kurd:innen in der Region. Außen- und Entwicklungspolitik sowie die Migrationspolitik Deutschlands und der Europäischen Union müssen sich an den Menschenrechten orientieren. Der Schlüssel für die Lösung (fast) aller Konflikte im Mittleren und Nahen Osten liegt im Iran. (Rubriken: Levantinische Aussichten, Migration)
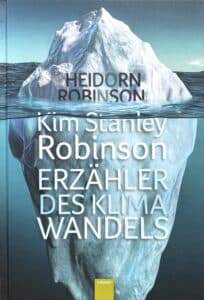 Markus Tillmann untersucht in seinem Essay „Den Klimawandel erzählen“ narrative Strategien der Climate Fiction. „Kann die Climate Fiction aufgrund ihrer Vielfältigkeit und Imaginationskraft die Wahrnehmung schärfen beziehungsweise eine neue Sensibilität erzeugen, die unter anderem in Kritik und Handeln umgesetzt werden kann?“ Der Autor gibt einen Überblick über Romane von Theresa Hannig, Lisa J. Krieg, Aiki Mira, Kim Stanley Robinson und Zara Zerbe. Keine dieser Welten gleicht der anderen, aber sie alle befassen sich mit Strategien des (Über-)Lebens. (Rubriken: Science Fiction, Treibhäuser)
Markus Tillmann untersucht in seinem Essay „Den Klimawandel erzählen“ narrative Strategien der Climate Fiction. „Kann die Climate Fiction aufgrund ihrer Vielfältigkeit und Imaginationskraft die Wahrnehmung schärfen beziehungsweise eine neue Sensibilität erzeugen, die unter anderem in Kritik und Handeln umgesetzt werden kann?“ Der Autor gibt einen Überblick über Romane von Theresa Hannig, Lisa J. Krieg, Aiki Mira, Kim Stanley Robinson und Zara Zerbe. Keine dieser Welten gleicht der anderen, aber sie alle befassen sich mit Strategien des (Über-)Lebens. (Rubriken: Science Fiction, Treibhäuser)
- Klaus Farin, Gründer der Klimaliste, kandidiert für die Tierschutzpartei zum Bundestag. Unter der Überschrift „Gemeinsam progressiv“ wirbt er für ein Bündnis kleiner Parteien, die so in der Lage wären, die Fünf-Prozent-Hürde zu überspringen. „Mehr Demokratie wagen“, das heißt nicht nur die Abschaffung der Fünf-Prozent-Hürde. Er plädiert für mehr Vertrauen in die Bürger:innen, für Bürgerräte und für mehr direkte Demokratie. Der unter Angela Merkel eingerichtete Klimarat war mit den umfangreichen Konsultations- und Beratungsprozessen ein gutes Vorbild. (Rubriken: Liberale Demokratie, Treibhäuser)
- Alexander Frese stellt in seinem Essay „…denen mitzuwirken versagt war“ die gleichnamige Ausstellung vor, wichtiger Teil der Geschichte des Grundgesetzes. Er referiert Hintergründe des ostdeutschen Widerstandes in der Nachkriegszeit, Schikanen und Verfolgung in der SBZ und in der jungen DDR. Er stellt mehrere der für die freiheitliche Demokratie engagierten Menschen vor, Politikerinnen und Politiker, Schülerinnen und Schüler, Studierende, Christinnen und Christen, Menschen, die die DDR verlassen konnten, Menschen, die lange Haftstrafen erlitten oder gar hingerichtet wurden. (Rubriken: Liberale Demokratie, DDR)
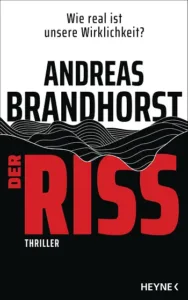 Fritz Heidorn stellt den neuen Roman von Andreas Brandhorst vor: „Wie wirklich ist die Wirklichkeit?“ Die Frage, ob wir in einer Simulation leben, bewegt nicht nur die Science Fiction. Sie ist Teil so mancher Verschwörungserzählung, aber auch manch naturwissenschaftlicher, philosophischer oder gar theologischer Reflexion. „Der Riss“ steht in der Tradition von Autoren wie Daniel F. Galouye („Simulacron-3“) und popularisierender Filme wie der Matrix-Tetralogie. Zu ihren Narrativen gehören Ideen aus dem Bereich des Post- und Transhumanismus. (Rubrik: Science Fiction)
Fritz Heidorn stellt den neuen Roman von Andreas Brandhorst vor: „Wie wirklich ist die Wirklichkeit?“ Die Frage, ob wir in einer Simulation leben, bewegt nicht nur die Science Fiction. Sie ist Teil so mancher Verschwörungserzählung, aber auch manch naturwissenschaftlicher, philosophischer oder gar theologischer Reflexion. „Der Riss“ steht in der Tradition von Autoren wie Daniel F. Galouye („Simulacron-3“) und popularisierender Filme wie der Matrix-Tetralogie. Zu ihren Narrativen gehören Ideen aus dem Bereich des Post- und Transhumanismus. (Rubrik: Science Fiction)
- Norbert Reichel analysiert in dem Essay „Der 29. Januar 2025 – Phänomenologie einer planlosen Zeitenwende“ die Debatten der letzten Januarwoche. Geht die CDU den Weg der ÖVP, bis sie aus der selbst gegrabenen Grube nicht mehr herausfindet? Dahinter steckt jedoch mehr, die Personalisierung von Politik (Trump, Musk, Merz, Söder und die Migranten), die Angst, dass alles immer schlimmer würde, Antipolitik als Lösung, fehlende Zukunftsvisionen. Ist aber den Parteien klar, dass Europa nicht das Problem, sondern die Lösung ist? (Rubriken: Liberale Demokratie, Migration, Treibhäuser)
Veranstaltungen mit Beteiligung des Demokratischen Salons:
 „We will dance again“ – das ließ sich Mia Schem (21) nach ihrer Befreiung aus der Hamas-Gefangenschaft auf den Arm tätowieren. Sophie Brüss, Jürgen Reinecke und Norbert Reichel haben das etwa 70minütige Programm der Szenischen Collage „Wir werden wieder tanzen“ entworfen, mit Songs von Leonard Cohen und Antilopen Gang, Gedichten von Nelly Sachs, Else Lasker-Schüler, Selma Meerbaum-Eisinger und anderen, eigens für die Veranstaltung geschriebenen Szenen sowie Testimonials von (nicht nur) jüdischen Autor:innen. Träger ist der Theater- und Musikverein NRW e.V. Nach der Premiere vom 8. Oktober 2024 in der Synagogengemeinde Köln gibt es weitere Vorführungen. Die nächsten Termine: am 5. Februar 2025, 19.00 Uhr in Krefeld (Fabrik Heeder, Virchowstraße 130, 47805 Krefeld), am 9. Februar 2025, 11 Uhr, in Dortmund (Jüdische Gemeinde Dortmund, Prinz-Friedrich-Karl-Straße 9, 44135 Dortmund) am 13. Februar 2025, 19 Uhr, in Dorsten (Jüdisches Museum, Julius-Ambrunn-Straße 1, 46282 Dorsten), am 20. Februar 2025, 19 Uhr, in Siegen (Kleines Theater im Kulturhaus Lÿz, Eingang A, St.-Johann-Str. 18, 57074 Siegen). Die Veranstaltungsreihe wird von der nordrhein-westfälischen Antisemitismusbeauftragten gefördert.
„We will dance again“ – das ließ sich Mia Schem (21) nach ihrer Befreiung aus der Hamas-Gefangenschaft auf den Arm tätowieren. Sophie Brüss, Jürgen Reinecke und Norbert Reichel haben das etwa 70minütige Programm der Szenischen Collage „Wir werden wieder tanzen“ entworfen, mit Songs von Leonard Cohen und Antilopen Gang, Gedichten von Nelly Sachs, Else Lasker-Schüler, Selma Meerbaum-Eisinger und anderen, eigens für die Veranstaltung geschriebenen Szenen sowie Testimonials von (nicht nur) jüdischen Autor:innen. Träger ist der Theater- und Musikverein NRW e.V. Nach der Premiere vom 8. Oktober 2024 in der Synagogengemeinde Köln gibt es weitere Vorführungen. Die nächsten Termine: am 5. Februar 2025, 19.00 Uhr in Krefeld (Fabrik Heeder, Virchowstraße 130, 47805 Krefeld), am 9. Februar 2025, 11 Uhr, in Dortmund (Jüdische Gemeinde Dortmund, Prinz-Friedrich-Karl-Straße 9, 44135 Dortmund) am 13. Februar 2025, 19 Uhr, in Dorsten (Jüdisches Museum, Julius-Ambrunn-Straße 1, 46282 Dorsten), am 20. Februar 2025, 19 Uhr, in Siegen (Kleines Theater im Kulturhaus Lÿz, Eingang A, St.-Johann-Str. 18, 57074 Siegen). Die Veranstaltungsreihe wird von der nordrhein-westfälischen Antisemitismusbeauftragten gefördert.
Veranstaltungen und Ausstellungen:
- Bubales auf Tournee: „Eifersucht, Liebe, Hass, Intrigen und natürlich ein Happy End – Die alte biblische Geschichte von Königin Esther im persischen Reich, hat den Stoff zu einer Film-Serie.“ Das ist der Plot des Stücks „Das Geheimnis der Königin“, mit dem Puppentheater bubales Februar und März 20205 auf Purim-Tour geht: Hier die Termine: 2. Februar 2025 11 Uhr und 16 Uhr für Familien und Erwachsene im Staatstheater Hannover, 12. März 2024, 16 Uhr, im Jüdischen Museum Frankfurt am Main, am 14. März 2025, 17 Uhr für Familien und um 19 Uhr für Erwachsene in Dorsten im Jüdischen Museum Westfalen und am 16. März 2025, 16 Uhr für Familien, 18 Uhr für Erwachsene im Hänneschen Theater Köln. Buchbar sind noch folgende Termine: am 10. und 11. März in Hessen (am 11. März zwischen 10 und 13 Uhr für Schulen), am 15. März und am 17. März 2025 im Raum NRW oder Niedersachsen. Karten über die jeweiligen Spielorte, Buchungen über bubales@gmx.de. Im Demokratischen Salon hat Shlomit Tripp das Puppentheater unter der Überschrift „Jüdisch und Interkulturell“ vorgestellt.
- 35 Jahre deutsche Einheit und jüdisches Leben in Deutschland: am 11. Februar 2025, 18.00 Uhr findet in den Räumen der Bundesstiftung in der Berliner Kronenstraße 5 eine Lesung mit Film und Gespräch zum Thema „Zukunft teilen – Jüdische Aufbrüche im geteilten und vereinten Deutschland“ statt. Die Veranstaltung ist der Auftakt einer Reihe von Diskussionsveranstaltungen der Deutschen Gesellschaft e. V. und der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Das vollständige Programm und weitere Veranstaltungen der Reihe sind auf der Seite der Deutschen Gesellschaft zu finden. Die Reihe wird wie folgt angekündigt: „Die deutsche Einheit wird 35 alt – oder bleibt 35 Jahre jung. Wir spüren den Zukünften nach, die seit 1990 in Ost und West, bei Jung und Alt, in Stadt und Land erträumt, gefordert und gestaltet wurden. Welche Energien setzte die Einheit frei? Mit welchen Erwartungen blickten die Menschen ins vereinte ‚Morgen‘? Wie wirkte die Teilung im Neuanfang fort?“ In der Auftaktveranstaltung wirken mit: Almuth Berger, Staatssekretärin a. D. und 1990 Ausländerbeauftragte der DDR, Marguerite Bertheau, Wiss. Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Jüdische Geschichte und Kultur der Ludwig-Maximilians-Universität München, Dmitrij Kapitelman, Schriftsteller, Journalist und Musiker, Markus Meckel, Ratsvorsitzender der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und ehem. Außenminister der DDR, Juri Rosov, Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde Rostock K.d.ö.R, Irene Runge, Soziologin und Publizistin. Moderation: Miron Tenenberg, Journalist. Anmeldung über zukunft@deutsche-gesellschaft-ev.de. Die Veranstaltung wird auch über den youtube-Kanal der Stiftung übertragen.
- Demokratiebildung: Auf der Bildungsmesse didacta in Stuttgart (11. bis 15. Februar 2025) diskutieren Deborah Schnabel (Bildungsstätte Anne Frank), Robby Geyer (Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg), Christian Bunnenberg (Ruhr-Universität Bochum) und Katharina Hochmuth (Bundesstiftung Aufarbeitung) am 12. Februar 2025, 10.30 Uhr bis 11.15 Uhr (Halle 3 D62) über „Demokratiebildung zwischen Anspruch und Wirklichkeit: Balance finden im Rahmen des Beutelsbacher Konsenses?“.
- Versöhnung – eine Utopie? Das Theater Bonn und das Bonner Zentrum für Versöhnungsforschung der Universität Bonn laden ein zur Teilnahme an der Reihe „Kunst und Wissenschaft im Gespräch“: Thema ist „das utopische Potenzial von Versöhnung.“ Politische, historische, theologische Perspektiven werden debattiert und aufeinander bezogen. Schauspieler:innen des Bonner Ensembles begleiten die Vorträge mit literarischen und szenischen Beiträgen. Die nächsten Termine: am 18. Februar, 19.30 Uhr: „Geschlechterzuschreibungen der (Un-)Versöhnlichkeit“ mit Christiane Krüger und Victoria Fischer, Universität Bonn, am 7. April 2025, 19.30 Uhr: „Versöhnung durch Versippung“ mit Clemens Albrecht, Universität Bonn, am 29. April, 19.30 Uhr: „Eichmanns Anwalt Robert Servatius als Verteidiger in NS-Strafverfahren“ mit Dirk Stolper, Universität Frankfurt am Main, alle Veranstaltungen im Foyer des Schauspielhauses in Bad Godesberg. Eine weitere Veranstaltung findet am 4. Mai 2025, 20 Uhr, in der Werkstattbühne (hinter dem Opernhaus) statt: „60 Jahre Deutsch-Israelische Beziehungen“ mit Natan Sznaider, Universität Tel Aviv, und Hans-Georg Soeffner, Universität Bonn.
- Polnisches Schreiben in Deutschland: Das Deutsche Poleninstitut bietet gemeinsam mit der Schader-Stiftung am 20. Februar sowie am 6. März 2025, jeweils um 18.30 Uhr, zwei weitere Leseabende an (im Darmstädter Schader-Forum, Goethestraße 2, 64285 Darmstadt): „Ostmigrantisch, postmigrantisch – polnisches Schreiben in Deutschland“. Die Themen: „Deutsch über Polen: Polnisch über Deutschland“ (mit Magdalena Parys und Artur Becker) sowie „Wurzelsuche“ (mit Martin Piekar).
 Swaying the Current: Die Galerie Zilberman hat am 28. November 2024 in Berlin (Schlüterstr. 45) die Gruppenausstellung „Swaying the Current“ eröffnet, die bis zum 15. Februar 2025 zu sehen ist. Gezeigt werden Werke von Alpin Arda Baǧcık, Aziza Kadyri, İz Öztat, Sandra del Pilar, Neriman Polat, Sim Chi Yin und Cengiz Tekin. Kuratiert wurde die Ausstellung von Ece Ateş, Lotte Laub und Lusin Reinsch. Die nächsten begleiteten Führungen finden am Januar und 1. Februar 2025 statt, jeweils um 16 Uhr, Anmeldung unter berlin@zilbermangallery.com wird erbeten. Im Internetauftritt zur Ausstellung wird das verbindende Element der ausgestellten Bilder und Installationen am Beispiel von „Silence“ von Cengiz Tekin wie folgt beschrieben: „Swaying the Current immerses us in the interwoven currents of memory, history and identity, acknowledging how the seemingly submerged and forgotten are inscribed in the fabric of our lives.” Scheinbare Wahrheiten werden durch kleine und kleinste Abweichungen und Korrekturen in Frage gestellt und bei der Betrachtung ergibt sich ein Bild, das historische Ereignisse in einem völlig anderen Licht erscheinen lässt. Sandra del Pilar hat ihre Malintzin-Arbeiten (in einem Gesprächsprotokoll mit der Künstlerin und einem kontrafaktischen Dokument, dem „Codex Malintzin“ im Demokratischen Salon präsent) weiterentwickelt, sie macht die Widersprüche zwischen den Berichten der Konquistadoren und überlieferten Zeichnungen durch die veränderte Haltung eines Zeigefingers, durch Schuhe, durch Blickrichtungen sichtbar. Ob es so war, wie sie die Geschichte erzählt, bleibt offen. Möglich wäre es. Politische Implikationen lassen sich in allen Werken entdecken. Sim Chi Yin erzählt gegen die offizielle Version der „Malayan Emergency“ (1948-1060) die Geschichte ihrer Großeltern, die unter der britischen Herrschaft in Malaya litten. Ihr Großvater wurde nach China deportiert und von der antikommunistischen Kuomintang exekutiert. Mündliche Überlieferungen werden mit historischen Ereignissen verbunden, ungeheilte und unheilbare Wundern des Kalten Krieges in den persönlichen Schicksalen der Menschen der eigenen Familie fühlbar.
Swaying the Current: Die Galerie Zilberman hat am 28. November 2024 in Berlin (Schlüterstr. 45) die Gruppenausstellung „Swaying the Current“ eröffnet, die bis zum 15. Februar 2025 zu sehen ist. Gezeigt werden Werke von Alpin Arda Baǧcık, Aziza Kadyri, İz Öztat, Sandra del Pilar, Neriman Polat, Sim Chi Yin und Cengiz Tekin. Kuratiert wurde die Ausstellung von Ece Ateş, Lotte Laub und Lusin Reinsch. Die nächsten begleiteten Führungen finden am Januar und 1. Februar 2025 statt, jeweils um 16 Uhr, Anmeldung unter berlin@zilbermangallery.com wird erbeten. Im Internetauftritt zur Ausstellung wird das verbindende Element der ausgestellten Bilder und Installationen am Beispiel von „Silence“ von Cengiz Tekin wie folgt beschrieben: „Swaying the Current immerses us in the interwoven currents of memory, history and identity, acknowledging how the seemingly submerged and forgotten are inscribed in the fabric of our lives.” Scheinbare Wahrheiten werden durch kleine und kleinste Abweichungen und Korrekturen in Frage gestellt und bei der Betrachtung ergibt sich ein Bild, das historische Ereignisse in einem völlig anderen Licht erscheinen lässt. Sandra del Pilar hat ihre Malintzin-Arbeiten (in einem Gesprächsprotokoll mit der Künstlerin und einem kontrafaktischen Dokument, dem „Codex Malintzin“ im Demokratischen Salon präsent) weiterentwickelt, sie macht die Widersprüche zwischen den Berichten der Konquistadoren und überlieferten Zeichnungen durch die veränderte Haltung eines Zeigefingers, durch Schuhe, durch Blickrichtungen sichtbar. Ob es so war, wie sie die Geschichte erzählt, bleibt offen. Möglich wäre es. Politische Implikationen lassen sich in allen Werken entdecken. Sim Chi Yin erzählt gegen die offizielle Version der „Malayan Emergency“ (1948-1060) die Geschichte ihrer Großeltern, die unter der britischen Herrschaft in Malaya litten. Ihr Großvater wurde nach China deportiert und von der antikommunistischen Kuomintang exekutiert. Mündliche Überlieferungen werden mit historischen Ereignissen verbunden, ungeheilte und unheilbare Wundern des Kalten Krieges in den persönlichen Schicksalen der Menschen der eigenen Familie fühlbar.
- Frieden: Im Bonner Frauenmuseum (Im Krausfeld 10, 53111 Bonn) präsentieren bis zum 5. März 2025 (Di bis Sa 14 – 18 Uhr, So 11 – 18 Uhr) über 40 Künstlerinnen aus den kurdischen Gebieten, aus Syrien, der Türkei, Georgien und der Ukraine in der Ausstellung „Steine räumen für den Frieden“ ihre Werke „von Krieg, Flucht und der Kraft des Neuanfangs“. Kuratorinnen sind Marianne Pitzen und Julia Heintz. Die Ausstellung zeigt Installationen historischer Friedensverträge, so von Yasemin Yilmaz zum ersten Friedensvertrag der Welt, den die Königinnen Puduhepa und Nefertari abschlossen, und von Daniela Flörsheim zu den Werken der ersten bekannten Autorin der Welt, der sumerischen Priesterin Enheduanna. Die gezeigten Werke reichen über die Jahrhunderte bis in die aktuelle Situation in der Ukraine. Das Museum lädt die Besucher:innen ein, „in die Geschichten dieser beeindruckenden Frauen einzutauchen und einen Raum für Dialog über Frieden Nachhaltigkeit und gesellschaftlichen Wandel zu öffnen.“
- Jüdische Sakralbauten: Am 13. März 2024, 18.30 Uhr, referiert Peter Seibert, auf Einladung des Freundeskreises Synagoge Bochum-Herne-Hattingen in der Synagoge Bochum (Erich-Mendel-Platz 1, 44791 Bochum, über „Zerstörung und Missbrauch – Der Umgang mit jüdischen Sakralbauten nach 1945“. In der Ankündigung lesen wir: „In einem erschreckenden Ausmaß wurden in den beiden deutschen Nachkriegsstaaten die nach den Verwüstungen der NS-Zeit noch erhalten gebliebenen baulichen Überreste der jüdischen Geschichte in Deutschland zerstört. Die Gründe dafür reichen von nicht entschuldbarer Gedankenlosigkeit, Respektlosigkeit gegenüber den Ermordeten und Vertriebenen bis zu offenem Antisemitismus.“ (Für den Hinweis danke ich dem Jüdischen Echo Westfalen J.E.W.)
- Exil-Kunst 1933-1945: Die Sammlung Memoria des Sammlers Thomas B. Schumann wird bis zum 6. April 2025 in Siegburg im Stadtmuseum sowie im Katholisch-Sozialen Institut Siegburg gezeigt: „Exil – Die verschollene Generation 1933–1945 – Deutsche Exilkunst, Literatur, Musik & Filme“. Es gibt zahlreiche Begleitverstaltungen, die zum Teil auch in der Siegburger Stadtbibliothek stattfinden. Ausführliche Informationen im Programmheft. In Bonn wird ein Forum Exilkultur geplant – es gibt bereits einen Ratsbeschluss, eine Machbarkeitsstudie und einen Ort, den Windeckbunker in der Bonner Innenstadt. Einer der Förderer ist der Bonner Antiquar Jürgen Repschläger, der den Sammler, die Sammlung und die weiteren Planungen im Demokratischen Salon vorgestellt.
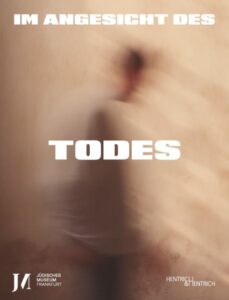 Ein Blick auf das Ende des Lebens: Am 1. November 2024 wurde im Jüdischen Museum Frankfurt die Ausstellung „Im Angesicht des Todes – Blicke auf das Lebensende“ eröffnet. Die Ausstellung ist bis zum 6. Juli 2025 zu sehen. Sie ist die erste kulturgeschichtliche Ausstellung zu jüdischen Praktiken des Umgangs mit Sterben, Tod und Trauer. Das bei Hentrich & Hentrich erschienene Buch zur Ausstellung wurde von Erik Riedel, Sara Soussan und Mirjam Wenzel Es rückt die gezeigten Kunstwerke, Medien und Objekte in einen anthropologischen und philosophischen Zusammenhang. In 17 Beiträgen präsentieren Expertinnen und Experten neue medizinische Forschungsergebnisse, diskutieren ethische Fragen, erörtern religionsvergleichende Perspektiven oder zeichnen nach, welche Rolle der Tod in Kunst- und Kulturgeschichte spielt. Mit seinem multiperspektivischen Ansatz eröffnen Buch und Ausstellung einen neuen Zugang zur letzten Passage des Lebens. Der Band ist auch in englischer Sprache erhältlich.
Ein Blick auf das Ende des Lebens: Am 1. November 2024 wurde im Jüdischen Museum Frankfurt die Ausstellung „Im Angesicht des Todes – Blicke auf das Lebensende“ eröffnet. Die Ausstellung ist bis zum 6. Juli 2025 zu sehen. Sie ist die erste kulturgeschichtliche Ausstellung zu jüdischen Praktiken des Umgangs mit Sterben, Tod und Trauer. Das bei Hentrich & Hentrich erschienene Buch zur Ausstellung wurde von Erik Riedel, Sara Soussan und Mirjam Wenzel Es rückt die gezeigten Kunstwerke, Medien und Objekte in einen anthropologischen und philosophischen Zusammenhang. In 17 Beiträgen präsentieren Expertinnen und Experten neue medizinische Forschungsergebnisse, diskutieren ethische Fragen, erörtern religionsvergleichende Perspektiven oder zeichnen nach, welche Rolle der Tod in Kunst- und Kulturgeschichte spielt. Mit seinem multiperspektivischen Ansatz eröffnen Buch und Ausstellung einen neuen Zugang zur letzten Passage des Lebens. Der Band ist auch in englischer Sprache erhältlich.
- Kunstfest Weimar 2025: Der Vorverkauf hat begonnen. Thema sind „Taiwan, Südafrika und ein ganz lokaler Star“. Das Kunstfest wird vom 20. August bis zum 7. September 2025 In den vergangenen Spielzeiten gab es Rekord-Besuchszahlen In der Pressemitteilung kündigte Kunstfest-Leiter Rolf C. Hemke unter anderem folgende Vorstellungen an: Das Wiedersehen mit Gregory Maqoma und seinem Tanzensemble, der Festivalhit „CION“ (2022) ist vielen Zuschauer:innen noch in bester Erinnerung. Bei „Genesis – The Beginning and End of Time“ (30. August 2025, 18:00 Uhr und Sonntag, 31. August, 20:00 Uhr, DNT Großes Haus) arbeitet der Starchoreograf erneut mit Komponist Nhlanhla Mahlangu zusammen, um Rhythmen und Melodien zu vertanzen, die von der Lebendigkeit und Virtuosität der Kulturen Südafrikas durchdrungen sind – mit acht Tänzer:innen und polyphoner Live-A cappella eines achtköpfigen Chores. Erster Höhepunkt eines weiteren Taiwan-Schwerpunkts im Kunstfest-Programm ist die Familien-Produktion des FOCASA Circus aus Taiwan. Die europäische Erstaufführung „Moss“ (deutsch: Moos) ist eine Zusammenarbeit mit dem deutsch-taiwanesischen Choreografie-Duo Peculiar Man Jan Möllmer und Tsai-Wei Tien, beide eng mit dem Tanztheater Pina Bausch verbunden (23. August 2025, 18:00 und 24. August, 16:00 h, DNT Großes Haus). 2024 bekam das Publikum in zwei völlig ausverkauften Konzerten nicht genug von Martin Kohlstedt! Natürlich ist der Bauhaus-Uni-Absolvent und „Local Hero“ Weimars auch beim Festival 2025 mit dabei – Open Air auf der Seebühne im Weimarhallenpark. Der Komponist, Pianist und Produzent schart ein Publikum aus Hoch- und Clubkultur um sich. Ihm gelingt es, akustisches Klavier und Electronica miteinander zu versöhnen. „Martin Kohlstedt Live“ (Freitag, 22. August, 20.30 h) ist das einzige Konzert des Künstlers in Thüringen im Jahr 2025. Tickets unter 03643 / 755334 oder kunstfest-weimar.de.
Leseempfehlungen und Hintergrundinformationen:
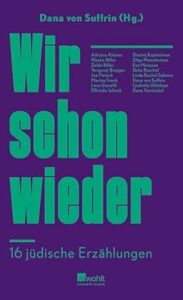 471 Tage: Die Jüdische Allgemeine berichtet in ihrer Ausgabe vom 23. Januar 2025 ausführlich über die Befreiung von Emily Damari (28), Doron Steinbrecher (31) und Romi Gonen (24) aus der Gewalt der Hamas. Sabine Brandes, Israel-Korrespondentin der Zeitung, beschreibt das Glück der Familien: „Voller Liebe, voller Liebe, voller Liebe“. Esther Shapira denkt über das nicht erfüllte Versprechen der „Sicherheit“ nach: „Bei aller Singularität der Schoa gibt es Assoziationen, die nicht mehr verschwinden werden: der Blick in den Abgrund an Grausamkeit. Der Stolz der Mörder auf ihre Tat. Der Hass, der alle Juden trifft. Der Kampf ums Weiterleben und die Rückkehr ins Leben nach dem Überleben.“ Die Botschaft lautet: „Nie wieder wehrlos“, aber auch: „Jede einzelne Geisel, die nach Hause zurückkehrt, steht für unser aller Überleben.“ Maytal Yasur Beit-Or beschrieb auf der Plattform mena-watch die psychischen Belastungen der Geiseln: „Mental immer noch im Tunnel“. Alexander Gruber übersetzte den zuerst auf der Seite des Jewish News Syndicate in englischer Sprache erschienenen Text. Ein Auszug: „Das größte medizinische Problem ist derzeit das Refeeding-Syndrom. Nach fünfzehn Monaten Unterernährung besteht im Fall einer plötzlichen Wiederaufnahme von Nahrung die Gefahr, dass der Flüssigkeits- und Elektrolythaushalt des Körpers gefährlich gestört wird. Bei früheren Geiselfreilassungen wurde ein Gewichtsverlust von zehn bis siebzehn Prozent der Körpermasse festgestellt, was acht bis sechzehn Kilogramm entspricht. Angesichts der langen Zeit ihrer Gefangenschaft rechnet das medizinische Team bei den drei Frauen mit noch komplexeren Herausforderungen, weswegen sie sich einer umfassenden Untersuchung unterziehen müssen. Das festgelegte medizinische Protokoll umfasst Tests wie das Screening auf Infektionskrankheiten, eine Ernährungsbewertung einschließlich Vitamin-, Kalium-, Zink- und Vitamin-B-12-Spiegel, eventuelle Schwangerschaftstests, Blutgerinnungstests wegen der langen Immobilität der Geiseln sowie detaillierte Untersuchungen der neurologischen, respiratorischen und kardialen Funktionen.“ Hinzu kommt die psychische Belastung, auch angesichts der Tatsache, dass noch immer nicht alle von der Hamas entführten Menschen befreit wurden. Am 25. Januar wurden die vier Soldatinnen Liri Albag, Karina Ariev, Naama Levy Daniella Gilboa Sie waren am 7. Oktober von ihrem Stützpunkt Nahal Oz verschleppt worden. In der letzten Januarwoche und am 1. Februar fanden weitere Übergaben statt. Darunter war auch Yarden Bibas, Ehemann von Shiri und Vater der Kinder Ariel (jetzt 4 Jahre alt) und Kfir (jetzt 2 Jahre alt). Ob die drei noch leben ist ungewiss, es gibt Hinweise, auch aufgrund von Äußerungen der Hamas, dass sie getötet wurden, aber keine offizielle Bestätigung von israelischer Seite.
471 Tage: Die Jüdische Allgemeine berichtet in ihrer Ausgabe vom 23. Januar 2025 ausführlich über die Befreiung von Emily Damari (28), Doron Steinbrecher (31) und Romi Gonen (24) aus der Gewalt der Hamas. Sabine Brandes, Israel-Korrespondentin der Zeitung, beschreibt das Glück der Familien: „Voller Liebe, voller Liebe, voller Liebe“. Esther Shapira denkt über das nicht erfüllte Versprechen der „Sicherheit“ nach: „Bei aller Singularität der Schoa gibt es Assoziationen, die nicht mehr verschwinden werden: der Blick in den Abgrund an Grausamkeit. Der Stolz der Mörder auf ihre Tat. Der Hass, der alle Juden trifft. Der Kampf ums Weiterleben und die Rückkehr ins Leben nach dem Überleben.“ Die Botschaft lautet: „Nie wieder wehrlos“, aber auch: „Jede einzelne Geisel, die nach Hause zurückkehrt, steht für unser aller Überleben.“ Maytal Yasur Beit-Or beschrieb auf der Plattform mena-watch die psychischen Belastungen der Geiseln: „Mental immer noch im Tunnel“. Alexander Gruber übersetzte den zuerst auf der Seite des Jewish News Syndicate in englischer Sprache erschienenen Text. Ein Auszug: „Das größte medizinische Problem ist derzeit das Refeeding-Syndrom. Nach fünfzehn Monaten Unterernährung besteht im Fall einer plötzlichen Wiederaufnahme von Nahrung die Gefahr, dass der Flüssigkeits- und Elektrolythaushalt des Körpers gefährlich gestört wird. Bei früheren Geiselfreilassungen wurde ein Gewichtsverlust von zehn bis siebzehn Prozent der Körpermasse festgestellt, was acht bis sechzehn Kilogramm entspricht. Angesichts der langen Zeit ihrer Gefangenschaft rechnet das medizinische Team bei den drei Frauen mit noch komplexeren Herausforderungen, weswegen sie sich einer umfassenden Untersuchung unterziehen müssen. Das festgelegte medizinische Protokoll umfasst Tests wie das Screening auf Infektionskrankheiten, eine Ernährungsbewertung einschließlich Vitamin-, Kalium-, Zink- und Vitamin-B-12-Spiegel, eventuelle Schwangerschaftstests, Blutgerinnungstests wegen der langen Immobilität der Geiseln sowie detaillierte Untersuchungen der neurologischen, respiratorischen und kardialen Funktionen.“ Hinzu kommt die psychische Belastung, auch angesichts der Tatsache, dass noch immer nicht alle von der Hamas entführten Menschen befreit wurden. Am 25. Januar wurden die vier Soldatinnen Liri Albag, Karina Ariev, Naama Levy Daniella Gilboa Sie waren am 7. Oktober von ihrem Stützpunkt Nahal Oz verschleppt worden. In der letzten Januarwoche und am 1. Februar fanden weitere Übergaben statt. Darunter war auch Yarden Bibas, Ehemann von Shiri und Vater der Kinder Ariel (jetzt 4 Jahre alt) und Kfir (jetzt 2 Jahre alt). Ob die drei noch leben ist ungewiss, es gibt Hinweise, auch aufgrund von Äußerungen der Hamas, dass sie getötet wurden, aber keine offizielle Bestätigung von israelischer Seite.
- Propagandaschlacht der Hamas: Thema des zitierten Kommentars von Esther Shapira ist auch die „Propagandaschlacht der Hamas“, die für die ZEIT Yassin Mushbarah dokumentierte: „Die schlimmste Show“. Er zeigt zwei Bilder, ein Bild, das von der Hamas verbreitet wurde, und den Eindruck einer großen die Hamas unterstützenden Menschenmenge erweckt, ein zweites, das von Drohnen aufgenommen wurde und zeigt, dass es sich um eine zwar eng bei einander stehende, aber nur kleine Gruppe handelte. Erschreckend ist, dass mehrere westliche Berichterstattungen, darunter BBC, CNN und France24, darauf hereinfielen. Das zweite Bild wurde von der Nachrichtenagentur Reuters verbreitet, CNN relativierte wenig später seine ursprüngliche Version. Bei den weiteren Übergaben der Geiseln setzte sich diese Inszenierung fort.
- Global Risk Report: Das Weltwirtschaftsforum hat vergangene Woche seinen jährlichen Global Risk Report veröffentlicht. CORRECTIV hat ihn zusammengefasst: Die größten Bedrohungen für die Weltwirtschaft in den kommenden zehn Jahren: Klima, Klima und nochmals Klima, im Einzelnen: Extreme Wetterereignisse, Kritische Veränderung der Erdsysteme, Verlust biologischer Vielfalt und Zusammenbruch von Ökosystemen, Knappheit natürlicher Ressourcen. Was spielt davon eine Rolle im aktuellen Bundestagswahlkampf?
- Soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz: Auf ZEIT-Online erörtert Maximilian Probst die Frage, was an dem Vorwurf dran sei, dass Klimapolitik nur ein Thema einer elitären Blase wäre: „Die Klimaretter in ihrer Blase“. Sozialwissenschaftliche Studien, zum Beispiel von Dennis Eversberg und Steffen Mau, belegen, dass dieser Vorwurf nicht von der Hand zu weisen ist. „Je wohlhabender man ist, desto größer der Materialverbrauch und desto höher die Emissionen. Daraus leitet sich der Doppelmoralvorwurf ab: Wer sich für den Kampf gegen die Klimakrise einsetze, treibe sie in Wahrheit oft besonders stark durch seinen Lebensstil an.“ Auf der anderen Seite gibt es Studien wie die von Karen Bell oder eine Studie der Baseler Universität, der Universität Cambridge und der Kopenhagen Business School, die belegen, dass vor allem ärmere Menschen von den Folgen der Klimakrise besonders hart betroffen sind (Stichwort: Waldbrände in Los Angeles), die weder gut versichert sind noch sich einen Wiederaufbau leisten können. „Die entscheidende Pointe lautete: Je mehr die Ungleichheit unterschätzt wird, desto weniger wird Klimapolitik unterstützt.“ Karen Bell empfiehlt, dass Umweltpolitik attraktiv werden könne, wenn man „über kostenlosen Nahverkehr, neue grüne Jobs, Wärmedämmung, die Mietern zugutekommt, und eine höhere Besteuerung fossiler Energiekonzerne“ „Nur eine Klimapolitik, die auf Gleichheit ziele, würde genügend Rückhalt in der Bevölkerung finden, so Bell.“ Ein Automatismus ist das jedoch nicht, man brauche – so zum Beispiel die britische Ökonomin Jo Cutter – lokale Ansätze und eine aktive Auflösung der polarisierenden Debatte. Dies muss jedoch wie ein Beispiel aus Nordspanien belegt gut vorbereitet werden. Auch hier ist Bürgerbeteiligung von Anfang an eine zentrale Grundlage des Erfolgs.
- Opferrenten: Frag den Staat und Stern haben recherchiert, warum in Deutschland ehemalige SS-Angehörige und Wehrmachtssoldaten, auch im Ausland, nach wie vor eine zusätzliche Kriegsopferrente erhalten, darunter Mitwirkende von Massakern wie in Oradour-sur-Glane. Durchschnittlich etwa 7.000 EUR im Jahr, regelmäßig über 70 Jahre. Shoah-Überlebende gehen jedoch leer aus. Das Problem ist seit den 1990er Jahren bekannt. Eine Reform des Bundesversorgungsgesetzes im Jahr 1998 beseitigte es jedoch nicht. (Den Hinweis verdanke ich CORRECTIV.)
- Wer nicht mehr kandidiert und warum: Nicht nur die Kandidat:innen zur Wahl des Deutschen Bundestages sollten uns interessieren, auch diejenigen, die nicht mehr kandidieren. Eine davon ist die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages Yvonne Magwas, CDU. Die Anfeindungen und Drohungen, körperliche Angriffe – einmal explodierte bei einer Veranstaltung direkt neben ihr ein Sprengsatz – führten zu ihrer Entscheidung. Sie ist nicht die einzige. Auch in der Kommunalpolitik haben mehrere Bürgermeister:innen ihre Arbeit beendet, weil sie die Hetze nicht mehr ertrugen. Christoph Koopmann hat in der Süddeutschen Zeitung berichtet und die neue Studie von Hate Aid Dazu sprach er mit Anna-Lena von Hodenberg, eine der Gründer:innen von Hate Aid und der Gewaltforscherin Janina Steinert.
- Sicherheitsgesetze in Italien: Zu den Reformen der Regierung Giorgia Meloni gehört eine Reform der Sicherheitsgesetze, die inzwischen in einer ersten Lesung beschlossen wurden. Dazu gehört die Erhöhung der Strafen für sogenannte „atti di disobbedienza civili“ (ziviler Ungehorsam), Blockaden, Hungerstreiks, auch friedliche gewaltfreie Formen sind betroffen. Giulio Marcon fragt in seinem Kommentar auf der Plattform „Sbilanciamoci!“: „Sicurezza di chi?“ (Wessen Sicherheit). Er sieht eine „criminalizzazione dei problemi sociali“ (Kriminalisierung sozialer Probleme). Es hat sich ein zivilgesellschaftliches Bündnis gegen die Reform gegründet. (Für den Hinweis danke ich Gerd Pütz).
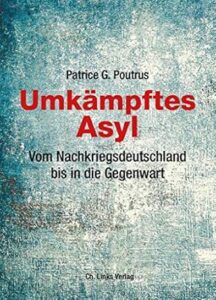 Rechte fördern Migration – ein Paradox: Vielleicht nicht direkt, aber indirekt geschieht genau dies wie der Volksverpetzer in seiner Auswertung der Praxis in Ländern mit rechten Regierungen In Großbritannien beispielsweise ist zwar nach dem Brexit der Zuzug aus EU-Staaten gesunken, der Zuzug aus Ländern außerhalb der EU jedoch deutlich gestiegen. Attraktiv sind offenbar vor allem für wenig Geld arbeitende Arbeitsmigrant:innen. In Polen und in Großbritannien spielt auch die Zuwanderung von Menschen eine Rolle, die aus der Ukraine flüchteten. In Ungarn wirkte sich die restriktive Migrationspolitik auf die Zahlen aus, doch vor etwa einem Jahr musste angesichts der schrumpfenden Bevölkerung die Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte gefördert werden. Im Zweifel entscheiden wirtschaftliche Bedarfe, zu denen auch die Anwerbung von Pflegekräften gehört. Die Lebensbedingungen ausländischer Arbeitskräfte verschlechtern sich allerdings, finanziell, in der Gesundheitsversorgung, in den durch die politische Rhetorik bewirkten Anfeindungen und Übergriffen. Ein großes Problem ist jedoch auch die nicht zu leugnende Tatsache, dass eher liberale oder linke Regierungen das Thema Migration zu lange ignorierten. Diese Ignoranz aber ist eine wichtige Grundlage für Wahlerfolge rechter bis rechtsextremistischer Parteien sowie der damit einhergehenden Radikalisierung auch konservativer Parteien.
Rechte fördern Migration – ein Paradox: Vielleicht nicht direkt, aber indirekt geschieht genau dies wie der Volksverpetzer in seiner Auswertung der Praxis in Ländern mit rechten Regierungen In Großbritannien beispielsweise ist zwar nach dem Brexit der Zuzug aus EU-Staaten gesunken, der Zuzug aus Ländern außerhalb der EU jedoch deutlich gestiegen. Attraktiv sind offenbar vor allem für wenig Geld arbeitende Arbeitsmigrant:innen. In Polen und in Großbritannien spielt auch die Zuwanderung von Menschen eine Rolle, die aus der Ukraine flüchteten. In Ungarn wirkte sich die restriktive Migrationspolitik auf die Zahlen aus, doch vor etwa einem Jahr musste angesichts der schrumpfenden Bevölkerung die Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte gefördert werden. Im Zweifel entscheiden wirtschaftliche Bedarfe, zu denen auch die Anwerbung von Pflegekräften gehört. Die Lebensbedingungen ausländischer Arbeitskräfte verschlechtern sich allerdings, finanziell, in der Gesundheitsversorgung, in den durch die politische Rhetorik bewirkten Anfeindungen und Übergriffen. Ein großes Problem ist jedoch auch die nicht zu leugnende Tatsache, dass eher liberale oder linke Regierungen das Thema Migration zu lange ignorierten. Diese Ignoranz aber ist eine wichtige Grundlage für Wahlerfolge rechter bis rechtsextremistischer Parteien sowie der damit einhergehenden Radikalisierung auch konservativer Parteien.
- Sizilianische Gemeinde profitiert von Migrant:innen: In der taz berichteten Augustin Campos und Stefanie Ludwig aus Piazza Armerina, einer sizilianischen Gemeinde: „Eine Stadt macht sich auf“. Etwa fünf Prozent der 20.000 Einwohner:innen kommen aus dem Ausland, aus Bangladesh, Burkina Faso, Gambia oder Nigeria. Seit 2011 gibt es ein Aufnahmezentrum für Geflüchtete, das von dem Sozialunternehmen Don Bosco 2000 geleitet wird. Angeboten werden Vermittlung von Praktika und Arbeitsplätzen, Sprachkurse und psychologische Betreuung. Die Stadt hat sich verändert, inzwischen sieht man in der Stadt nicht nur alte, sondern auch junge Leute auf den Straßen. Die stark von Abwanderung betroffene Region verjüngt sich. „Exilanten“ – so Samantha Barresi die Leiterin des Aufnahmezentrums – arbeiten „in der Gastronomie oder in der Landwirtschaft“. Agostino Sella, Gründer von Don Bosco 2000, sagt: „Erst sind die Menschen skeptisch, wenn sie dann aber einen Koch in ihrer Küche benötigen und einen afrikanischen Koch finden, sagen sie: Gott sei Dank gibt es einen afrikanischen Koch.“ Der Bürgermeister, der den Fratelli d’Italia angehört, reagiert leider nicht auf Anfragen. Die Akzeptanz der Zugewanderten in der Bevölkerung und bei den Wirtschaftsunternehmen in der Region steigt.
- Abschiebungen zerstören die Wirtschaft: In der ZEIT veröffentlichten Amrai Coen und Kerstin Kohlenberg am 30. Januar 2025 das Dossier „Die Abschiebe-Hauptstadt“. Thema ist eine Abschiebeaktion in Postville (Iowa) vom 12. Mai 2008, die vom damaligen Präsidenten George W. Bush als Modellversuch für weitere Abschiebungen gedacht war. Abgeschoben wurden 389 Arbeiter:innen aus Guatemala und Mexiko, die in einer Fleischfabrik arbeiteten, Familien wurden getrennt, die Fleischfabrik musste kurze Zeit später Insolvenz anmelden. Amerikanische Arbeitskräfte konnten zwar teilweise gewonnen werden, aber es handelte sich um Gefängnisinsassen, Obdachlose sowie eigens angeworbene Menschen aus Palau, die aber schnell wieder verschwanden. Die Stadt verwahrloste, die Kriminalität nahm zu. Nach der Aktion übernahm Leigh Recow das Amt des Bürgermeisters. Er stimmte für Trump, glaubt aber nicht, dass Abschiebungen sinnvoll sind. Das Dossier dokumentiert das Schicksal einer Familie. Consuelo Vega, die Mutter, wurde abgeschoben, der Vater und die Kinder versteckten sich. Inzwischen leben alle wieder in Postville, inzwischen legal, auch dank des Engagements einer Anwältin, die eine gesetzliche Regelung fand, die die Rückkehr einer größeren Gruppe ermöglichte. Was wird Trump tun? „Nichts ist Trump so wichtig wie Wirtschaftswachstum und Börsenkurse. Wird er dem Druck von großen und kleinen Unternehmen nachgeben, die ihre billigen Leute nicht verlieren wollen? Wird er auf Ökonomen hören, die ihm sagen, ein massenhaftes plötzliches Wegfallen von kostengünstigen Arbeitskräften schade dem Land? / Inzwischen haben die ersten Razzien unter dem neuen Präsidenten begonnen.“
- Wikipedia von rechts? Rechtsextremisten haben über mehrere Jahre versucht, über Fake Accounts deutschsprachige Wikipedia-Texte umzuschreiben und deutsche Geschichte aus ihrer Sicht und nach ihren Wünschen zu verändern, den Holocaust zu relativieren. Vieles wurde inzwischen wieder rückgängig gemacht. Ob die Täter tatsächlich gestoppt werden konnten, ist noch unklar. Die Investigativjournalisten Christoph Schattleitner und Daniel Laufer dokumentieren dies im Podcast Sockenpuppenzoo und nennen die Milieus der Täter, die zum Beispiel aus „Burschenschaftskellern“ kamen, aber auch aus „Kaderschmieden der Bundeswehr“. (Den Hinweis verdanke ich CORRECTIV.) Aus eigener Erfahrung darf ich ergänzen, dass es viel zu leicht ist, in Wikipedia Texte zu schreiben und zu verändern. Ein Problem liegt darin, dass die Autor:innen bei Kontaktaufnahme nicht mit Klarnamen für ihre Eintragungen bürgen, oft leider auch nur selbsternannte Expert:innen für das jeweilige Thema sind. Wikipedia kann einer ersten Information dienen, ist aber eben weder ein Fachmagazin noch ein journalistisches Medium. Wer Wikipedia nutzt, sollte dies immer bedenken. Gleichzeitig zeigt dies, wie gefährlich Wikipedia werden kann. Es ist eben auch eine Art soziales Netzwerk, das ständiger Überprüfung auf Fehler und Propaganda bedarf.
- „Konnektivitätskrieg“: Kriege finden schon lange nicht mehr ausschließlich zwischen Armeen von sich bekämpfenden Ländern statt, Herfried Münkler prägte den Begriff der „asymmetrischen Kriege“. Es beteiligen sich immer wieder nicht-staatliche Milizen, die mitunter sogar die Ursache der „Kampfhandlungen“ – wie es oft euphemistisch heißt – sind gegen die sich staatliche Akteure verteidigen. Kriege finden auf den Territorien einzelner Staaten statt, sind jedoch nicht das, was früher einmal als „Bürgerkrieg“ bezeichnet worden wäre. Eine weitere Form ist der „hybride Krieg“, bei dem es darum geht, die Infrastruktur des zum Gegner auserkorenen Landes zu sabotieren, mit gezielten Terrorakten die eigenen Oppositionellen zu ermorden, die in den „feindlichen“ Ländern lebenden Menschen zu verunsichern und gleichgesinnte anti- und a-demokratische Akteure als diejenigen darzustellen, die vor diesen Angriffen angeblich schützen, indem sie Bündnisse mit den angreifenden Staaten propagieren. Genau dies ist das Muster zahlreicher Angriffe Russlands, des Irans, auch Chinas – um nur drei zentrale Akteure zu nennen. Jörg Lau hat für die ZEIT die russische Sabotage in Deutschland kommentiert: „Die Angriffe zielen darauf, ein Gefühl der Verwundbarkeit zu erzeugen, Lücken zu erkunden, die im Ernstfall ausgenutzt werden können, und die roten Linien des Westens zu verschieben. Die Verflechtung der globalisierten Welt eröffnet Feinden der Freiheit neue Chancen der Aggression. Alles Verbindende kann angegriffen oder zur Waffe umfunktioniert werden – Datenkabel, Pipelines, Frachtflugzeuge, Bahnstrecken, Migrationsströme, Medien aller Art. Experten nennen das ‚Konnektivitätskrieg‘.“ Er zitiert den NATO-Generalsekretär Mark Rutte, „wir seien noch ‚nicht im Krieg, wir befinden uns aber auch nicht im Frieden‘.“ Sind wir vorbereitet?
- Neue Oberbürgermeisterin in Diyarbakır: Im Tagesspiegel porträtierte Susanne Güsten die seit März 2024 amtierende Oberbürgermeisterin in Diyarbakır, Serra Bucak, eine Germanistin aus Köln. Vorher stand die Stadt unter Zwangsverwaltung, die Vorgänger:innen wurden jeweils von der türkischen Regierung abgesetzt und inhaftiert. Serra Bucak kandidierte bei den Kommunalwahlen im März 2024 für die kurdische Partei DEM und erhielt 65 Prozent der Stimmen. Zurückkehren kann sie nicht mehr nach Deutschland, denn das türkische Innenministerium hat ihren Reisepass annulliert. Dies widerfuhr auch 20 weiteren kurdischen Bürgermeistern. Internationale Solidarität gibt es kaum. Serra Bucak befürchtet, dass sie für den Fall einer Inhaftierung nicht auf Hilfe und Druck aus dem Ausland rechnen kann.
 Terrorregime Iran: Für die Jüdische Allgemeine sprach Michael Thaidigsmann mit Gazelle Sharmahd, der Tochter von Jamshid Sharmahd, der aus Dubai entführt und im Iran zum Tode verurteilt worden war: „Deutschland muss aufhören, immer alles falsch zu machen.“ Jamshid Sharmahd hatte auch die deutsche Staatsangehörigkeit. Es wurde Anfang November 2024 gemeldet, er sei hingerichtet worden, wenig später hieß es, er sei in der Haft gestorben. Eine unabhängige Untersuchung der Todesursache gibt es nicht. Gazelle Sharmahd wirft dem Westen vor, den Iran zu unterstützen statt konsequent gegen die Missachtung der Menschenrechte, gegen Folter und Todesstrafe im Iran vorzugehen: „Man kann Terrorregime nicht beschwichtigen, indem man mit ihnen Deals macht.“ Mehrere US-Bürger wurden mit sechs Milliarden Dollar aus der Haft freigekauft, ihr Vater war nicht dabei. Die Bundesregierung habe sich auf „Beileidsbekundungen“ beschränkt. „Deutschland wollte das Regime nicht als Terrorregime einstufen und sieht es nach wie vor als Handelspartner an, obwohl es um das Leben eines Staatsbürgers ging.“ (Die Forderung, die Revolutionsgarden zur Terrorgruppe zu erklären, wurde weder in Deutschland noch in der EU bisher erfüllt.) Gazelle Sharmahd betont, dass sich die Bevölkerung im Iran mit Israel und den von der Hamas entführten Geiseln solidarisiere: „Wenn das Regime israelische oder amerikanische Flaggen auf den Boden legt, dann trampeln die meisten Menschen nicht etwa darauf herum, sondern gehen gezielt drum herum. Das Problem sind nicht die Menschen im Iran, sondern die Aufrechterhaltung des Regimes durch Milliarden-Deals und diplomatische Beziehungen.“ Eine gute Nachricht ist die Freilassung der Kölner Architektin Navid Taghavi nach vier Jahren Haft. Sie war zu zehn Jahren Haft verurteilt worden.
Terrorregime Iran: Für die Jüdische Allgemeine sprach Michael Thaidigsmann mit Gazelle Sharmahd, der Tochter von Jamshid Sharmahd, der aus Dubai entführt und im Iran zum Tode verurteilt worden war: „Deutschland muss aufhören, immer alles falsch zu machen.“ Jamshid Sharmahd hatte auch die deutsche Staatsangehörigkeit. Es wurde Anfang November 2024 gemeldet, er sei hingerichtet worden, wenig später hieß es, er sei in der Haft gestorben. Eine unabhängige Untersuchung der Todesursache gibt es nicht. Gazelle Sharmahd wirft dem Westen vor, den Iran zu unterstützen statt konsequent gegen die Missachtung der Menschenrechte, gegen Folter und Todesstrafe im Iran vorzugehen: „Man kann Terrorregime nicht beschwichtigen, indem man mit ihnen Deals macht.“ Mehrere US-Bürger wurden mit sechs Milliarden Dollar aus der Haft freigekauft, ihr Vater war nicht dabei. Die Bundesregierung habe sich auf „Beileidsbekundungen“ beschränkt. „Deutschland wollte das Regime nicht als Terrorregime einstufen und sieht es nach wie vor als Handelspartner an, obwohl es um das Leben eines Staatsbürgers ging.“ (Die Forderung, die Revolutionsgarden zur Terrorgruppe zu erklären, wurde weder in Deutschland noch in der EU bisher erfüllt.) Gazelle Sharmahd betont, dass sich die Bevölkerung im Iran mit Israel und den von der Hamas entführten Geiseln solidarisiere: „Wenn das Regime israelische oder amerikanische Flaggen auf den Boden legt, dann trampeln die meisten Menschen nicht etwa darauf herum, sondern gehen gezielt drum herum. Das Problem sind nicht die Menschen im Iran, sondern die Aufrechterhaltung des Regimes durch Milliarden-Deals und diplomatische Beziehungen.“ Eine gute Nachricht ist die Freilassung der Kölner Architektin Navid Taghavi nach vier Jahren Haft. Sie war zu zehn Jahren Haft verurteilt worden.
- Katar: Auf der Plattform Mena-Watch bieten Thomas M. Eppinger, Alexander Feuerherdt und Irina Tsukerman in drei Porträts eine Übersicht über die Geschichte und die Politik eines Landes, das inzwischen ein „internationaler Machtfaktor“ ist: „Vom Perlenfischerdorf zum Global Player“. Unabhängig ist das Land seit 1971, die Königsfamilie herrscht seit 1822. Sie beschreiben den Aufstieg, Investitionen und Wirtschaftsleistung, Kooperationen mit verschiedenen europäischen Partnern, unter anderem Großbritannien, Spanien und Frankreich, aber auch die Zusammenarbeit mit Muslimbrüdern und Hamas. Thema sind ferner Zusammenhänge mit der Golfkrise, die geschickte Diplomatie gegenüber dem Westen und Russland, insbesondere auch über die Nutzung des „Sportswashing“. Eine wichtige Rolle spielt der Sender Al-Jazeera, auch bei der Beeinflussung der Medien in anderen Ländern. Motto: „Soft Power and Hard Money“. Kritisch zu sehen ist das Fehlen einer kohärenten westlichen Strategie. „Katar versteht es meisterhaft, sich gegenüber allen Seiten zu öffnen und dabei unbeirrt die eigenen Ziele zu verfolgen: Es füttert den Westen mit der einen Hand und schlägt ihn mit der anderen.“
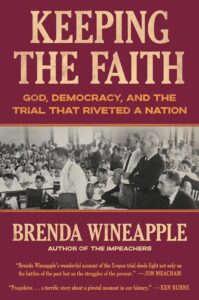 USA –Land der unbegrenzten Unmöglichkeiten: In den USA landen mitunter Themen vor Gericht, die es in Europa allenfalls in eine TV-Satire brächten. Adam Hochschild hat im New York Review of Books in seinem Essay „Evolution in the Dock” das Buch „Keeping the Faith: God, Democracy, and the Trial That Riveted a Nation” von Brenda Weinapple (Random House, 2024) vorgestellt, das dem Strafprozess gegen John Scopes in Dayton, Tennessee, aus dem Jahr 1925 gewidmet ist. Ein Gesetz verbot in Tennessee Lehrer:innen, die Evolution zu lehren, John Scopes tat es dennoch. Er wurde von der Jury schuldig gesprochen und zu einer Geldstrafe von $ 100 verurteilt. Im Prozess wurde diskutiert, ob Joshua tatsächlich die Sonne angehalten habe, wie es möglich wäre, dass die Arche Noah vor 4.262 Jahren (heute wären es 100 Jahre mehr) Menschen und Tiere beherbergt hätte, es aber Zivilisationen gäbe, die über 6.000 Jahre alt wären, wie die Tage bemessen worden wären, bevor Gott am vierten Tag Sonne und Mond geschaffen hätte. Der Ankläger William Jennings Bryan starb wenige Tage nach dem Ende des Prozesses. Manche meinten, er sei als Märtyrer in der Verteidigung von Gottes Sohn gestorben, der Kolumnist L. Mencken, der den Prozess „the Monkey Trial“ nannte, meinte: „God aimed at Darrow (der Verteidiger Clarence Darrow, NR), missed him and hit Bryan.“ Der Schwarze Journalist George Schuyler interviewte einen Gorilla im Zoo der Bronx, der ihm mitteilte, dass es noch nie einen Affen gegeben hätte, der sich alle Bäume des Waldes angeeignet und von den anderen Affen Miete verlangt hätte. Adam Hochschild beschreibt die Bedeutung des Prozesses anhand einer Analogie zur heutigen Zeit, wenn jemand ein in Florida geltendes Verbot überträte, etwas gegen den Klimawandel zu unternehmen (oder das Thema in der Schule zu unterrichten). Undenkbar? Fragen Sie mal die „Moms for Liberty“! Und da könnte der Unterschied zwischen 2025 und 1925 liegen. Brenda Weinapple berichtet, dass die Kontrahenten vor Gericht ebenso wie außerhalb sehr freundschaftlich miteinander umgegangen seien. Der Ankläger bot dem Angeklagten sogar an, seine Strafe zu bezahlen.
USA –Land der unbegrenzten Unmöglichkeiten: In den USA landen mitunter Themen vor Gericht, die es in Europa allenfalls in eine TV-Satire brächten. Adam Hochschild hat im New York Review of Books in seinem Essay „Evolution in the Dock” das Buch „Keeping the Faith: God, Democracy, and the Trial That Riveted a Nation” von Brenda Weinapple (Random House, 2024) vorgestellt, das dem Strafprozess gegen John Scopes in Dayton, Tennessee, aus dem Jahr 1925 gewidmet ist. Ein Gesetz verbot in Tennessee Lehrer:innen, die Evolution zu lehren, John Scopes tat es dennoch. Er wurde von der Jury schuldig gesprochen und zu einer Geldstrafe von $ 100 verurteilt. Im Prozess wurde diskutiert, ob Joshua tatsächlich die Sonne angehalten habe, wie es möglich wäre, dass die Arche Noah vor 4.262 Jahren (heute wären es 100 Jahre mehr) Menschen und Tiere beherbergt hätte, es aber Zivilisationen gäbe, die über 6.000 Jahre alt wären, wie die Tage bemessen worden wären, bevor Gott am vierten Tag Sonne und Mond geschaffen hätte. Der Ankläger William Jennings Bryan starb wenige Tage nach dem Ende des Prozesses. Manche meinten, er sei als Märtyrer in der Verteidigung von Gottes Sohn gestorben, der Kolumnist L. Mencken, der den Prozess „the Monkey Trial“ nannte, meinte: „God aimed at Darrow (der Verteidiger Clarence Darrow, NR), missed him and hit Bryan.“ Der Schwarze Journalist George Schuyler interviewte einen Gorilla im Zoo der Bronx, der ihm mitteilte, dass es noch nie einen Affen gegeben hätte, der sich alle Bäume des Waldes angeeignet und von den anderen Affen Miete verlangt hätte. Adam Hochschild beschreibt die Bedeutung des Prozesses anhand einer Analogie zur heutigen Zeit, wenn jemand ein in Florida geltendes Verbot überträte, etwas gegen den Klimawandel zu unternehmen (oder das Thema in der Schule zu unterrichten). Undenkbar? Fragen Sie mal die „Moms for Liberty“! Und da könnte der Unterschied zwischen 2025 und 1925 liegen. Brenda Weinapple berichtet, dass die Kontrahenten vor Gericht ebenso wie außerhalb sehr freundschaftlich miteinander umgegangen seien. Der Ankläger bot dem Angeklagten sogar an, seine Strafe zu bezahlen.
- Vorbild Bangladesh? Für die Süddeutsche Zeitung sprach Heribert Prantl mit dem neuen Regierungschef des Landes Muhammad Yunus über die Entwicklungen in Bangladesh angesichts des vor etwa einem halben Jahr vollzogenen Regierungswechsel: „Die Erwartungen sind gigantisch“. Die bisherige Regierungschefin Sheik Hasina wurde vertrieben. Sie hatte Rede-, Meinungs- und Pressefreiheit massiv eingeschränkt. Diese Verfügungen wurden inzwischen aufgehoben. „Wir haben die Sicherheitsbehörden sowie zivile und militärische Stellen angewiesen, sich nicht mehr in die Arbeit von Journalisten einzumischen. Die Presse kann nun völlig frei veröffentlichen, was sie möchte.“ Yunus knüpft an die Stärkung der Selbstwirksamkeit an, die er mit den Mikrokreditprojekten, für die er 2006 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde, entwickelt hatte. „Mein Ziel ist es, eine Welt der drei Nullen zu schaffen: null Vermögenskonzentration, null Netto-CO₂-Emissionen und null Arbeitslosigkeit. Diese Konzepte sind in Regierungskreisen noch sehr neu, und ich bringe sie zur Sprache, um die politischen Entscheidungsträger darauf aufmerksam zu machen. Im Moment veranstalten wir ein landesweites Jugendfestival unter dem Motto: ‚Lasst uns das Land verändern, lasst uns die Welt verändern‘. Er lobte die ‚unbändige Energie der Menschen‘. Priorität haben der Kampf gegen Korruption und gegen Extremismus. Yunus hat bereits Ursula von der Leyen getroffen, er betrachtet die EU und Deutschland als wichtige Partner. In Bangladesh leben 171 Millionen Menschen. Der „Economist” ernannte Bangladesh zum „Land des Jahres“.
- Mythos Neutralitätsgebot: Schulen, Jugendarbeit, Hochschulen, Kultur sollen „neutral“ sein, so wird es oft gefordert. Die AfD verlangt, dass in Schulen nichts Kritisches über die Partei gesagt werden dürfe. Die türkischen Konsulate haben bereits mehrfach eingefordert, niemand dürfe in der Schule Erdoǧan kritisieren. Es gibt sogar Stimmen, die verlangen, dass Unterricht über die Klimakrise gegen das Neutralitätsgebot verstoße. Ein Neutralitätsgebot gibt es jedoch nicht. Der Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten hat in der Publikation „Mythos Neutralitätsgebot“ dokumentiert, warum. Für Bildung und Kultur gilt der Beutelsbacher Konsens: „Das darin festgehaltene Überwältigungsverbot und das Kontroversitätsgebot wollen gerade keine kritischen Auseinandersetzungen verhindern. Vielmehr hat politische Bildung auch die Verantwortung zur kritischen Differenzierung und einen normativen Kern in der Vermittlung pluralistischer, demokratischer und menschenrechtsorientierter Haltungen und Werte.“ Ebenso argumentiert die KMK in ihrem Beschluss „Demokratie als Ziel, Gegenstand und Praxis historisch-politischer Bildung in der Schule“, der unter anderem feststellt: „Zum Demokratielernen gehört die Fähigkeit, die Position eines anderen nachzuvollziehen, zu verstehen und zu reflektieren. Respekt vor Freiheit und Meinung des Andersdenkenden bedeutet jedoch nicht Beliebigkeit und Neutralität. Kinder und Jugendliche sollen die Vorzüge, Leistungen und Chancen der rechtsstaatlich verfassten Demokratie erfahren und erkennen, dass demokratische Grundwerte wie Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität und Toleranz niemals zur Disposition stehen dürfen. Zudem gilt es, das Bewusstsein dafür zu schaffen, dass auch beste Absichten bisweilen gegenteilige Wirkungen erzeugen. Überheblichkeit und Übereifer können dazu verleiten, nur die eigene Sicht gelten zu lassen. Kontroversen und Debatten trainieren die Fähigkeit zum Perspektivwechsel.“
- Bibliotheken verlieren Zuschüsse: Unter dem Stichwort „Grundversorgung“ kritisiert Klaus Vater im Beueler Extradienst die Streichungen von Zuschüssen für öffentliche kirchliche Büchereien in der Stadt Bonn. Die Kulturdezernentin versicherte, die „literarische Grundversorgung“ sei dennoch gesichert. Aber was bedeutet „literarische Grundversorgung“? Etwas Ähnliches wie „medizinische Grundversorgung“, die ja im Zweifel bedeutet, dass mehr oder weniger nur Notfälle betreut werden? Das ist kein spezifisches Bonner Problem. Solche Streichungen erleben zurzeit viele Bibliotheken und letztlich bleiben dann für viele Menschen nur noch eher fragwürdige Informationsquellen. (Die Streichungen in Bonn wurden inzwischen wieder rückgängig gemacht. Manchmal helfen Proteste.)
- Judentum in Bildungsmedien: Im Dezember 2024 beschlossen die KMK (jetzt: Bildungsministerkonferenz), der Zentralrat der Juden in Deutschland und der Verband Bildungsmedien eine Erklärung und gemeinsame Empfehlungen zur Darstellung des Judentums in Bildungsmedien. Am 14. Januar 2025 fand hierzu in Köln eine gemeinsame Fachtagung statt. Die Empfehlungen enthalten zwölf Punkte und schließen an die beiden vorangegangenen Beschlüsse an (auf der KMK-Internetseite öffentlich zugänglich). Die Erklärung verweist auch auf die Komplexität des Themas, das je nach Lehrplänen der Länder unterschiedlich bearbeitet werden kann und muss. Thematisiert wird die jüdische Geschichte von der Antike bis in die Gegenwart, die Rolle Israels ebenso wie die Komplexität des Nahostkonflikts und der Antisemitismus. Analyse und Anwendung von Sprache, Bildquellen, Kartenmaterialien und Graphiken bedürfen großer Sorgfalt, um Fehlschlüsse zu vermeiden. Ein zentraler Punkt ist die Forderung nach „Empathieförderung statt emotionale Überwältigung“. Die Schlussfolgerungen verweisen auf die Zuständigkeiten der Länder und der Bildungsmedienverlage, Anforderungen an Lehrpläne und Handreichungen. Leider fehlt ein Hinweis auf eine verpflichtende Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte. Vorbereitet wird eine gemeinsame Fachtagung, in der die Erklärung im Detail vorgestellt und diskutiert werden soll. Im Anhang werden Referenztexte genannt, unter anderem eine Untersuchung zum Judentum in Schulbüchern aus dem Jahr 2014 und vorangegangene Beschlüsse sowie eine kommentierte Materialsammlung, die Zentralrat der Juden und KMK gemeinsam zusammengestellt haben (eine eigene Finanzierung und Infrastruktur gibt es für dieses begrüßenswerte Projekt leider nicht). Wünschenswert wäre, wenn ein ähnlicher Beschluss zum Islam gefasst werden könnte. Der Unabhängige Expertenkreis Muslimfeindlichkeit hat im Herbst 2023 Vorschläge erarbeitet, allerdings fehlt es in diesem Feld an einer klaren Vertretung der Muslim:innen in Deutschland, möglicherweise aber auch am politischen Willen.
- Überlastete Jugendämter: Eine WDR-Reportage berichtete über die Überlastungssituation von Mitarbeiter:innen in Jugendämtern (auf der Mediathek der ARD verfügbar). Autor:innen sind Berit Kalus und Katharina Wolff. Viele Jugendämter sagten eine Beteiligung an der Recherche ab. Mitarbeiter:innen wollten sich nicht in der Öffentlichkeit äußern, aus Angst vor beruflichen Folgen. Mitarbeiter:innen bearbeiten oft doppelt oder gar drei Mal so viele Akten wie sie eigentlich sollten. Stellen bleiben unbesetzt, die Ausstattung reicht oft nicht aus. In Gelsenkirchen sind die Mitarbeiter:innen vergleichsweise gut ausgestattet, können flexibel und schnell arbeiten, aber dennoch ist die zu bearbeitende Fallzahl zu hoch. Es ist oft nur sehr schwer zu beurteilen, ob Kinder gefährdet sind oder nicht. Dazu wären Hausbesuche und Gespräche erforderlich, die viel Zeit brauchen. Die Gefahr ist hoch etwas zu übersehen, aber wenn ein Fall nicht ausreichend beachtet wird, folgen möglicherweise sehr schnell staatsanwaltliche Ermittlungen.
- Demokratischer Salon in der Ukraine: Übersetzt wurde der Beitrag von Fritz Heidorn „Magie – Technik – Evolution“ von Volodymir Komarov. Er wurde im Portal Eksperiment veröffentlicht. 16 Student:innen haben unter Leitung von Pavlo Shopin das Interview „Realistische Fantastik“ mit Zara Zerbe in ukrainischer Sprache übersetzt und veröffentlicht.
Den nächsten Newsletter des Demokratischen Salons lesen sie in etwa vier Wochen.
Mit den besten Grüßen verbleibe ich
Ihr Norbert Reichel
(Alle Internetzugriffe erfolgten zwischen dem 25. und 31. Januar 2024.)
P.S.: Sollte jemand an weiteren Sendungen meines Newsletters nicht interessiert sein, bitte Nachricht an info@demokratischer-salon.de. Willkommen sind unter dieser Adresse natürlich auch wertschätzende und / oder kritische Kommentare und / oder sonstige Anregungen.
