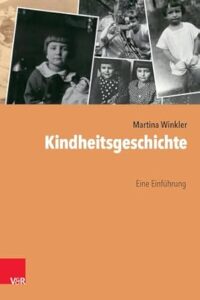Politikum Kindheit
Ein Gespräch mit der Historikerin Martina Winkler
Seit Oktober 2017 leitet Martina Winkler die Abteilung für die Geschichte Osteuropas an der Universität Kiel. Eines ihrer Themen ist die Geschichte der sozialistischen Tschechoslowakei und ihrer Nachfolgestaaten Tschechien und Slowakei. Sie hat sich ferner mit der Geschichte von Zar Peter I. befasst. Ein besonderes Thema, das vielleicht für eine Osteuropahistorikerin ungewöhnlich erscheinen mag, ist die Kindheitsgeschichte, zu der sie bereits geforscht hat und zurzeit ein weiteres Projekt vorbereitet. Im Historikerverband beteiligt sie sich an einer eigenen AG zur Kindheitsgeschichte. Sie ist eine der fünf Sprecher:innen. Im Jahr 2017 veröffentlichte sie in Göttingen bei Vandenhoeck & Ruprecht das Buch „Kindheitsgeschichte – eine Einführung“. Im Demokratischen Salon hat sie zuletzt über die aktuellen Entwicklungen in der Slowakei und das Verhältnis von Tschechen und Slowaken zueinander berichtet.
Kindheitsgeschichte als eigene Disziplin
Norbert Reichel: Es gibt eine Fülle von Untersuchungen der Kindheitsforschung, medizinisch, psychologisch, soziologisch, pädagogisch. Sie haben sich einem Bereich gewidmet, der in der Regel zumindest in allgemeinen gesellschaftlichen und politischen Debatten nicht so präsent ist, der Kindheitsgeschichte.
Martina Winkler: Eigentlich gibt es schon seit längerer Zeit Bücher zur Kindheitsgeschichte. 1960 hat der französische Historiker Philippe Ariès in seinem Buch „Geschichte der Kindheit“ (französischer Originaltitel: L’enfant et la vie familiale sous l’ancien régime, deutsche Übersetzung 1975) geschrieben, Kindheit sei biologisch und historisch nicht nur ein ständig präsentes Thema, sondern historisch auch kontingent. Das heißt, das Bild von Kindheit in der Gesellschaft verändert sich. Der biologische Kern ist relativ einfach definierbar: Kinder sind klein, zu Beginn allein gar nicht lebensfähig, sie brauchen Hilfe, sie verändern sich und wachsen. Das gilt universell, physiologisch, psychologisch, hormonell. Historiker:innen interessieren sich jedoch besonders für die Frage, was Gesellschaften aus diesem biologischen Faktum machen. Kindheit ist in modernen Gesellschaften eine Grundkategorie. Das ist durchaus vergleichbar mit dem großen Thema Gender. Wenn ich wissen will, wie Gesellschaften funktionieren, nach welchen Kategorien Menschen aufgeteilt werden, schaue ich auf Themen wie Race, Gender, Disability und eben auch auf den Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen.
Eine solche Sicht auf Kindheit als eigenständige Kategorie begann im 18. Jahrhundert sehr intensiv, sie wurde dann im 19. Jahrhundert sehr romantisiert. Im 20. Jahrhundert wird es aus meiner persönlichen Sicht besonders spannend, weil der Gegensatz von Erwachsen-Sein und Kind-Sein so deutlich im Kontrast zueinander diskutiert wird: Fertig sein, (scheinbar) rational handeln bezogen auf die Erwachsenen, während das Kind noch erzogen und sozialisiert werden muss. Das ist ein ganz starkes Element in der Kultur, aber vor allem in der Politik. Kindheit wurde sozusagen zu einem Politikum.
Es ist hochinteressant, wie das Thema Kindheit in unterschiedlichen politischen Kulturen verwendet wird. Ich beschäftige mich mit dem Thema seit etwa zehn Jahren. Als ich anfing, gehörte das Thema in Deutschland noch nicht so zum Mainstream (anders als in Skandinavien oder im angloamerikanischen Raum). Manche schauten skeptisch, da gäbe es doch schon genug, und was solle man denn da noch erforschen. Aber natürlich ist das Thema nicht (und ich würde eigentlich sagen: niemals) ausgeforscht. Es gibt im Grunde ja auch keinen gesellschaftlichen Bereich, den ich nicht mit einem Blick auf Kindheit erforschen könnte. Wie gesagt etwa so wie das mit dem Thema Gender auch geschieht. Vor allem wird deutlich, wie sehr der Unterschied zwischen Kind sein und Erwachsen sein unsere Gesellschaft prägt. Das ist letztlich auch eine Machtfrage. Wer hat in unserer Gesellschaft etwas zu sagen? Wer bildet die Normen? Und das sind in der Regel eben nicht die Kinder.
Norbert Reichel: Darf ich auf Ihren Hinweis auf Philippe Ariès (1914-1984) zurückkommen? Ariès war einer der Historiker der französischen Schule der Annales. Einer der Gründer war Marc Bloch (1886-1944, er wurde von der Gestapo erschossen). Dieser erwähnt in seinem Buch „Die Feudalgesellschaft“ (französischer Titel: „La société féodale, 1938/1939) einen Wikingerkrieger, der von seinen Leuten „Kindermann“ genannt wurde, weil er sich weigerte, bei Raubzügen Kinder niederzumetzeln. Kindheit war nicht immer etwas Beschützenswertes.
Martina Winkler: Es wird immer wieder gern erzählt, Kindern gehe es heute besser als früher. Die Rechte von Kindern wurden schließlich auch mit der UN-Kinderrechtskonvention von 1989 in internationales Recht gegossen. Das stimmt auch. Aber die Behauptung, dass es Kindern heute besser geht, ist einfach zu pauschal – was heißt denn „besser“? Dass Eltern ihre Kinder in früheren Zeiten, vor dem 18. oder vor dem 17. Jahrhundert nicht geliebt hätten, oder dass man Kindheit nicht als eigene Phase wahrgenommen hätte, dass Kinder einfach nur kleine Erwachsene gewesen wären, stimmt so nicht. Philippe Ariès hat argumentiert, die Zeit vor dem 18. Jahrhundert, das Mittelalter hätte keinen Begriff von Kindheit gehabt. Dies wird gern so interpretiert, als habe es keine besondere Berücksichtigung von Kindern gegeben. So aber hat Ariès das nicht gemeint. Er argumentierte, dass es keinen so ausgefeilten Begriff wie heute gegeben habe. Und in dieser Hinsicht, mit Kindheit als eigene Kategorie, als besondere, spezifisch zu definierende und zu behandelnde Gruppe, ändert sich seit dem 18. Jahrhundert wirklich sehr viel. In der Kunst wird Kindheit als etwas Eigenes gezeigt, es entstehen eigene Lehrstühle für Kinderheilkunde, Erziehungskonzepte, am populärsten vielleicht der „Émile“ von Rousseau, es entsteht das Konzept einer „Kinderliteratur“, und Kindheit wird als „Entwicklungsphase“ definiert und erforscht. All dies entsteht erst in der Moderne. Aber natürlich wurden Kinder auch vorher schon beschützt, haben gelernt, wurden auf ein eigenes Leben vorbereitet. Es gab auch die Vorstellung von unterschiedlichen Lebensabschnitten.
Das bürgerliche 19. Jahrhundert
Norbert Reichel: Kann man sagen, dass das heutige Verständnis von Kindheit auch sehr stark vom bürgerlichen 19. Jahrhundert geprägt ist?

Philipp Otto Runge (1777-1810), Die Hülsenbeckschen Kinder, 1805, Hamburger Kunsthalle. Wikimedia Commons, Creative Commons Attribution 4.0 International license.
Martina Winkler: Absolut. Die Vorstellung, die wir heute vorherrschend von Kindheit haben, ist in der Tat im 19. Jahrhundert entstanden und zwar im bürgerlichen 19. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert entstanden eigene Räume für Kinder, es gab Kinderzimmer, Spielzeug, Kinder mussten/durften nicht arbeiten. Die Schulpflicht wurde zu einem großen politischen Thema. Das sind aber auch Dinge, die man sich leisten können muss. Entsprechend entstand diese Sicht auf Kindheit im 19. Jahrhundert im west- und mitteleuropäischen Bürgertum und wurde dann nach und nach auf den Adel und auf die Arbeiterschaft erweitert. Eine spannende Frage ist dabei, wie sich dieses west- und mitteleuropäische sowie nordamerikanische Konzept dann mit der Zeit universalisierte oder eben auch nicht.
Norbert Reichel: Stichwort Kinderarbeit?
Martina Winkler: Das ist ein großes Thema. Wenn wir Kinderarbeit hören, denken wir erst einmal im 19. Jahrhundert an Kinder in Kohleminen.
Norbert Reichel: Oder in der Marine. Ich war einmal auf der „Victory“ von Lord Nelson und habe da gesehen, dass es gar nicht anders möglich war als dass Kinder die Kanonen nachluden. Der Raum war für Erwachsene einfach nicht hoch genug. Ähnlich dürfte das in Kohleminen gewesen sein.
Martina Winkler: Es gab immer Kinderarbeit. Dass wir heute sagen, dass wir keine Kinderarbeit hätten, stimmt auch nur zum Teil. So könnte man diskutieren, ob es nicht auch als Kinderarbeit zählen sollte, wenn Kinder acht Stunden am Tag in der Schule sind und nachher noch zu Hause Hausaufgaben oder Nachhilfestunden haben. Aber bleiben wir mal bei der „produktiven Arbeit“ und bei Erwerbstätigkeit, bei Kindern, die mit ihrer Arbeit unmittelbar zum Familienunterhalt beitragen. Es ist eine historische Ausnahme, dass das bei uns nicht akzeptiert wird. Kinder haben immer mitgearbeitet, haben auf jüngere Geschwister aufgepasst, das Vieh gehütet oder im Handwerk oder Haushalt mitgeholfen und dabei gelernt.
Norbert Reichel: Die von Werther angebetete Charlotte ist ein gutes Beispiel. Sie ist eigentlich ein Teenie, die ältere Schwester, die ihre Geschwister versorgt. Werther bewundert sie, wie sie das Brot schneidet. Was ist das anderes als Kinderarbeit, heute würde man sagen Care-Arbeit durch ein nicht volljähriges Mädchen. Auch in der Landwirtschaft arbeiteten Kinder immer mit. Selbst in Zeiten der Schulpflicht orientierten sich die Ferienzeiten an den Erntezeiten. Es gab die sogenannten Kartoffelferien. Was änderte sich mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert?
Martina Winkler: Mit der Industrialisierung wurde Kinderarbeit zu einem starken Element. Kinder wurden dort als billige Arbeitskräfte ausgebeutet. Zur gleichen Zeit entstand im 19. Jahrhundert die bürgerliche Kindheit. Das passt erst einmal nicht zusammen. Die Debatten über Kinderarbeit sind tatsächlich sehr interessant, weil sie genau dieses Aufeinandertreffen zeigen. Es gab natürlich jede Menge Ausreden, für Arbeiterkinder wäre das doch nicht so schlimm, zumindest kämen sie weg von der Straße und würden nicht kriminell, doch nach und nach gab es Maßnahmen gegen Kinderarbeit. Die Arbeitszeit wurde eingeschränkt, die Arbeitsbereiche reduziert. Schließlich wurde Kinderarbeit verboten.
Es ist wichtig sich anzuschauen, dass es seit einer ganzen Weile vor allem in Lateinamerika Bewegungen von Kindern, von Jugendlichen gibt, die argumentieren, wir müssen arbeiten, wir müssen unsere Familien miternähren und wir wollen das auch, weil wir so eine Stimme in der Familie, in der Gesellschaft haben. Diese Bewegungen sind zum Teil gewerkschaftlich organisiert. Sie sagen, Erwerbsarbeit bedeutet eigene Mitbestimmungsrechte. Es darf eben nur keine ausbeutende Arbeit sein, und die Arbeit darf die Schulausbildung nicht beeinträchtigen. Sie wollen natürlich nicht, dass Fünfjährige in Kohleminen geschickt werden.
Es ein Grundelement der Kindheitsgeschichte, dass der Schutz von Kindern immer auch eine Ausgrenzung von Kindern bedeuten kann. Auf der einen Seite sind eigene Räume für Kinder, Kinderzimmer, Spielplätze, Horte eine gute Sache, aber gleichzeitig werden Kinder auf diese Art und Weise auch aus der Gesellschaft ausgegrenzt. Es ist eben ambivalent. Als Historikerin ergreife ich hier nicht Partei, aber es ist eben nicht so, dass Kinder immer nur geschützt werden sollten.
Der den Kindern zugewiesene Platz
Norbert Reichel: Ich sehe es eher als ein Problem, wenn Kinder rund um die Uhr unter dem Vorwand des Schutzes überwacht werden. Manche Eltern tracken ihre Kinder ohnehin schon über eine Smart-Watch. So haben Kinder keine Chance sich selbst auszuprobieren, mit den Herausforderungen, wie es sie nun einmal im Alltag gibt, selbstständiger zu werden.
Martina Winkler: Genau das meine ich. Schutz kann auch beschränken und entmündigen. Die UN-Kinderrechtskonvention unterscheidet deutlich Schutzrechte, Förder- und Partizipationsrechte. Diese Partizipationsrechte vergessen wir aber ganz gerne.
Norbert Reichel: Kinder sind in vielen politischen und pädagogischen Konzepten Objekte und nicht Subjekte. Man traut ihnen bestimmte Dinge einfach nicht zu. Das betrifft auch die Debatte um die Frage des Wahlrechts für 16jährige oder sogar noch jüngere Jugendliche und Kinder.
Martina Winkler: Diese Debatte ist bezeichnend dafür, dass es letztlich um den Platz geht, den Kinder zugewiesen bekommen, in der Realität wie als Metapher. Den realen „Platz“, also eine Raumgeschichte der Kindheit, möchte ich mir demnächst noch etwas genauer anschauen, denn dazu gibt es nicht viel Literatur. Aber schon am Konzept des Kinderzimmers kann man dies zeigen. Das Kinderzimmer bedeutet auch, dass das Kind aus dem Miteinander der Erwachsenen ausgegrenzt wird. Spielplätze in der Stadt sind „für“ Kinder da, aber sie sind eben auch eine Entschuldigung dafür, den Rest der Stadt nicht kindgerecht gestalten zu müssen. Dann lieber einen Zaun um ein paar Schaukeln ziehen, da sind Kinder „geschützt“ und zugleich kontrolliert.
Norbert Reichel: Mit dem Problem des Kinderzimmers beginnt Marcel Proust den ersten Teil seiner „Recherche“. Marcel wurde schon ins Bett geschickt, er wurde von der Runde der Erwachsenen ausgeschlossen und wartet auf den Gute-Nacht-Kuss der Mutter. Diese Szene ließe sich als Metapher der Ausgrenzung aus dem Leben der Erwachsenen interpretieren. Der Gute-Nacht-Kuss ist die einzige Verbindung zwischen dem Kind und den Erwachsenen.
Martina Winkler: Das ist spannend. Raum trennt, körperliche Nähe und Emotionen verbinden. Ich möchte mir demnächst den Raum genauer anschauen, konkret die Bedeutung von Kindern in der Stadtplanung, insbesondere in sozialistischen Ländern. Bisher habe ich mich sehr intensiv mit dem Thema der Repräsentation von Kindern befasst, in Texten und Bildern. Ich habe mir Fotografien angeschaut, insbesondere in der sozialistischen Tschechoslowakei. Meine Frage war, wie sich das Kindheitsbild verändert, wie es auf Fotografien, in der Kinderliteratur oder in Erziehungsratgebern dargestellt wird. Gerade Erziehungsratgeber sind hoch normativ. Wie sollen sich Kinder benehmen, welche Rolle haben Erwachsene, Eltern?
Norbert Reichel: Welche Verhaltensempfehlungen haben Sie entdeckt?
Martina Winkler: Interessant sind die Veränderungen. In den 1950er Jahren fällt auf – speziell in der Tschechoslowakei, aber das dürfte auch für andere vergleichbare Länder gelten –, dass es den Kindern vor allem körperlich gut gehen sollte. Dazu gehört erst einmal Hygiene. Das mag uns heute teilweise übertrieben erscheinen, aber in der damaligen Zeit wurde noch gegen Kindertuberkulose gekämpft, und Antibiotika waren noch ganz neu. Wichtig waren auch Ernährung, frische Luft. In den Erziehungsratgebern wird gelobt, wie der sozialistische Staat das alles ermöglicht, was Kinder brauchen: medizinische Versorgung, Sanatorien, Impfungen etc.
In den 1960er Jahren kam ein emotionales Element hinzu. Es wird argumentiert, der sozialistische Staat mache viel für die Kinder, schaffe tolle Schulen, Kinderferienlager, aber könnte es sein, dass wir die emotionalen Bedürfnisse der Kinder vergessen haben? Es heißt dann, dass Kinder nicht nur organisiert sein wollen, dass es nicht nur darum geht, dass es ihnen körperlich gut geht, sondern dass sie auch seelisch eine bestimmte Freiheit brauchen, die über die Schule am Vormittag und die Pionierorganisation am Nachmittag hinausgeht. Sie bräuchten auch Liebe, Zeit füreinander, um zum Beispiel miteinander zu spielen. Dabei ist auch eine Romantisierung von Kindheit feststellbar. Diese Debatte ist in mancher Hinsicht übrigens mit heutigen Diskussionen vergleichbar (Was brauchen Kinder wirklich?).
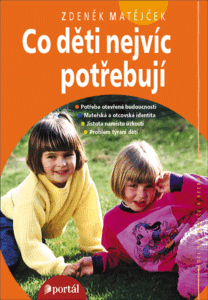 Den Anlass für solche Überlegungen gab der Psychologe Zdeněk Matějček. Man kann ihn vielleicht mit John Bowlby vergleichen, der die Bindungstheorie konzipiert hat. Zentral war auch bei Matějček der Blick auf die emotionale Entwicklung bei Kleinkindern, auf die Bindung an eine Person. Die Debatte ging aber darüber hinaus, und hierentstand ein Spannungsfeld zwischen dem, wie der Staat Kinder zu guten sozialistischen Menschen erziehen will, und einer Gegenbewegung, die sagt, man solle die Kinder einfach mal machen lassen, ihnen auch ein wenig Ruhe geben.
Den Anlass für solche Überlegungen gab der Psychologe Zdeněk Matějček. Man kann ihn vielleicht mit John Bowlby vergleichen, der die Bindungstheorie konzipiert hat. Zentral war auch bei Matějček der Blick auf die emotionale Entwicklung bei Kleinkindern, auf die Bindung an eine Person. Die Debatte ging aber darüber hinaus, und hierentstand ein Spannungsfeld zwischen dem, wie der Staat Kinder zu guten sozialistischen Menschen erziehen will, und einer Gegenbewegung, die sagt, man solle die Kinder einfach mal machen lassen, ihnen auch ein wenig Ruhe geben.
In der Kinderliteratur gibt es dann auch nicht mehr nur diese Heldengeschichten, sondern neue Erzählungen, die auf Gefühle und Probleme eingingen, in denen das individuelle Kind mit seinen Sehnsüchten im Zentrum steht. In dieser Zeit wurde dann auch beispielsweise Astrid Lindgren übersetzt. Hier kam also wieder eine eher eine romantische Kindheitsvorstellung zum Zug. Und dies spiegelt sich in Fotografien, Büchern, in der gesellschaftlichen Diskussion. Allerdings war es auch wenig nachhaltig. Obwohl Matějček schon in den späten 1950ern schrieb, schon Babys bräuchten individuelle Zuwendung, aber andererseits war Tschechien das Land, das am längsten, noch bis etwa vor zwei Jahren, Säuglingsinstitute hatte. Säuglinge, um die sich die Mütter nicht kümmern konnten, wurden in solchen Heimen untergebracht. Anderswo kamen sie in Pflegefamilien. Auf der einen Seite also war die tschechische Psychiatrie bahnbrechend, auf der anderen aber blieben diese institutionellen Strukturen ungewöhnlich lange erhalten. Fragen Sie mich jetzt bitte nicht warum.
Norbert Reichel: Hatte diese Entwicklung in der Tschechoslowakei auch etwas mit dem Prager Frühling zu tun?
Martina Winkler: Nicht unmittelbar mit dem Prager Frühling (damit beschreiben wir ja die Entwicklung von 1967/68), aber doch mit den neuen Ideen und der kulturellen und wissenschaftlichen Liberalisierung der 1960er Jahre. Diese ermöglichte generell eine freiheitlichere Art der Diskussion. Literatur wurde freier, auch die Kinderliteratur. In den 1960er Jahren bekamen Experten eine stärkere Stimme, in der Wirtschaft, aber auch in der Erziehung.
Eskapismus – ein heimlicher Gesellschaftsvertrag
Norbert Reichel: Ein meines Erachtens spannendes Phänomen ist die hervorragende tschechische Kinderliteratur und all die Kinder- und Märchenfilme, es gibt ja nicht nur „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“, das wir in der Vorweihnachtszeit, wenn wir wollen, fast jeden Tag in diversen Fernsehprogrammen anschauen können. Die tschechischen Kinderfilme sind bis heute auch bei uns populär. Auch in der DDR gab es eine ganze Menge solcher Filme.
Martina Winkler: Das wurde sehr stark gefördert und war nicht nur eine Nische. Bei Schriftstellerkonferenzen war Kinderliteratur immer ein großes Thema. Dahinter steckte eine Grundidee der Moderne, dass wir eine gute Zukunft schaffen, indem wir unsere Kinder gut erziehen. Wie kann ich Menschen formen? Wen kann ich am besten formen? Kleine Kinder! Diese Idee wurde in sozialistischen Ländern besonders stark entwickelt, auch in der frühen Sowjetunion. In der Tschechoslowakei war das immer ein großes Thema. 1949 wurde schon ein Kinderbuchverlag gegründet. Als 1953 das Fernsehen kam, entstand sofort auch eine Kinderfernsehredaktion. Man hat das sehr ernst genommen. Autor:innen, die normalerweise für Erwachsene schrieben, schrieben auch Kinderliteratur. Man wurde auch nicht als Kinderbuchautor abgewertet wie das manchmal bei uns der Fall ist. Es gab auch eine eigene Fachzeitschrift für Kinderliteratur, in der diskutiert wurde, wie sie geschrieben werden sollte, wie sie am besten in Filmen adaptiert werden konnte, natürlich immer unter der sozialistischen Prämisse. Auch in der allgemeinen Kulturdiskussion spielte Kinderliteratur eine wichtige Rolle.
Norbert Reichel: Im Westen hatten wir meines Erachtens immer Konjunkturen. Da waren auf der einen Seite, insbesondere in der 68er Zeit, die Kinderladenbewegung, Konzepte einer antiautoritären Erziehung im Sinne von Alexander Neill und das von ihm gegründete „Summerhill“, „Schwarze Pädagogik“ wurde angegriffen, auf der anderen Seite aber Gegenbewegungen, in denen dies als „Kuschelpädagogik“ diffamiert und „Mut zur Erziehung“ gefordert wurde, bis hin zur Popularität der Bücher von Amy Chua. Zurzeit haben wir meines Erachtens wieder Ansätze zu einer repressiven Phase. Andererseits erleben wir in den Schulen eine Vielfalt von offenen und weniger offenen pädagogischen Ansätzen nebeneinander. Spielten diese Debatten in der Tschechoslowakei eine Rolle?
Martina Winkler: Es gab auf jeden Fall Kontakte, viele Wissenschaftler:innen und Autor:innen schauten insbesondere nach Skandinavien, aber auch zum Beispiel nach Österreich. Es ging nicht so radikal hin und her wie im Westen, aber in den 1960er Jahren gab es schon die Idee, dass man Kindern mehr Freiheit geben könnte, und eine Entwicklung, die durchaus mit der nordamerikanischen Tendenz um Benjamin Spock vergleichbar ist (der eine eher gefühlsbetonte und intuitive Erziehung empfahl). Ich möchte allerdings noch etwas ergänzen, damit die Sicht auf die Pädagogik und auf Kindheit in der Tschechoslowakei nicht zu positiv erscheint. Wenn man sich die 1970er und 1980er Jahre anschaut, die Zeit nach der Niederschlagung des Prager Frühlings, spielen Kinderfilme noch eine andere Rolle. Wir haben in dieser Zeit eine Art informellen Gesellschaftsvertrag: Lebensstandard und Konsumleistung sollten erhöht werden, mehr Geld und Arbeitskraft wurde in Konsumgüter statt in die Industrie investiert, jeder soll seine kleine Datsche haben, aber dafür lasst ihr uns politisch in Ruhe.
Norbert Reichel: Für Ungarn gab es immer den merkwürdigen Begriff des „Gulaschkommunismus“ und in der DDR verkündete Erich Honecker die „Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik“. Das funktionierte natürlich nur so lange, wie der Konsum auch garantiert werden konnte.
Martina Winkler: So war das. Wenn ihr euch politisch nicht einmischt, könnt ihr ein ruhiges Leben führen. Das hat schon etwas von Eskapismus. In diesen Kontext kann man unter anderem all diese Kinderfilme einordnen. Die haben ja nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene geschaut.
Norbert Reichel: Ich spitze das einmal zu. Bruno Bettelheim sagte: „Kinder brauchen Märchen.“ Vielleicht lässt sich das erweitern: „Menschen brauchen Märchen.“ „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ ist doch ein wunderbares Beispiel. Alles irgendwie eine Art romantisiertes Mittelalter.
Martina Winkler: Eskapismus halt. Und eine nette Art von Nationalismus. Da wird die schöne böhmische Landschaft gezeigt. Das hatte natürlich eine politische Zielrichtung. In den 1980er Jahren funktionierte das dann immer weniger; heute wird es manchmal nostalgisch verklärt: Im Sozialismus hatten wir noch eine richtige Kindheit.
Puritanismus vs. Aufklärung
Norbert Reichel: Spielten christliche Erzählungen eine Rolle? Kinder werden in den Evangelien ja sehr positiv dargestellt. Sie werden von Jesus mehrfach ausdrücklich adressiert, wer ein Kind aufnähme, nähme ihn auf, wer einem Kind aber etwas antut, soll besonders hart bestraft werden (Mt 18,5 f.),
Martina Winkler: Christliche Darstellungen im Mittelalter sind eher das Metier von Theolog:innen und Kunsthistoriker:innen, da traue ich mir keine Aussagen zu. Ich würde eher auf die Frühe Neuzeit schauen. Die Reformation war für Vorstellungen von Kindheit und von Erziehung sehr bedeutend. Um die Entwicklung sehr vereinfacht darzustellen: Im Mittelalter, mit der dominierenden katholischen Kirche und der Möglichkeit, Sünden zu beichten, gab es eine gewisse Sicherheit, die nun für viele Menschen verloren ging. Für Protestant:innen fiel sozusagen der Puffer der Beichte nun weg. Den Eltern, insbesondere dem Vater, kam eine viel größere Verantwortung zu, das Kind zu einem gottesfürchtigen Menschen zu erziehen und damit nichts weniger als sein Seelenheil zu sichern. Dies geschah zur Not auch mit sehr brutalen Erziehungsmethoden. In dieser Zeit erschienen dann auch alle möglichen pädagogischen Schriften. Viele Philosophen begannen, sich mit Erziehung, mit Pädagogik auseinanderzusetzen. In der Frühen Neuzeit entstanden zwei Kindheitsbilder: Das von Grund auf böse, sündige Kind, und etwas später dann das im Kern gute, unschuldige, unverdorbene Kind.
Norbert Reichel: Dieses Gegenbild kommt dann von Rousseau, der davon ausging, dass das Kind von vornherein gut sei, aber durch die Gesellschaft verdorben werde.
Martina Winkler: Das ist die aufklärerische Gegenbewegung, bei Rousseau bereits mit einem Hang zur Romantik. Die Unschuld, die Güte des Kindes muss erhalten bleiben. Wir dürfen das Kind nicht durch zu viel Zivilisation korrumpieren.
Norbert Reichel: Das zieht sich meines Erachtens bis heute durch. Die einen betrachten das Kind als defizitäres Wesen, die anderen als ein Wesen, das alles Gute in sich birgt, wir es ihm jedoch durch falsche Erziehung austreiben.
Martina Winkler: Tatsächlich stehen diese beiden Bilder bis heute nebeneinander. Soll ich das Kind eher laufen lassen oder durch Druck erziehen? Ein Beispiel für die Annahme des grundsätzlich bösen ist die häufig zu findende Bezeichnung von Kindern als „kleine Tyrannen“, was praktisch bedeutet: Wenn ich ein Kind nicht schreien lasse, sondern es sofort hochnehme (also auf seine Bedürfnisse reagiere), wird aus ihm ein kleiner Tyrann. Auf der anderen Seite stehen dann Vorstellungen von einer möglichst freien, vom Kind selbst bestimmten Lebensweise (von Erziehung kann man hier ja eigentlich gar nicht wirklich sprechen). Das sind einerseits Konjunkturen, aber in unserer Gesellschaft stehen doch durchgehend beide Auffassungen nebeneinander.
Dazu gehört dann auch das Nebeneinander vom Blick in die Zukunft (was soll das Kind einmal werden) und auf die Gegenwart (das Kind soll jetzt Kind sein und erst einmal nicht mehr). Etwas polemisch ausgedrückt: Dies zeigt sich in dem ambivalenten Wunsch, dreijährige Kinder in den Frühchinesischkurs zu schicken, aber gleichzeitig zu betonen, das sei doch alles ganz spielerisch, „kindgerecht“. Die Gesellschaft will natürlich, dass die Kinder möglichst viel schaffen, aber gleichzeitig halten wir immer das romantische Bild von Kindheit aufrecht.
Norbert Reichel: Man muss sein Kind nicht prügeln um es zu gängeln. Man kann es auch ganz einfach vielen Prüfungen unterziehen. Ständig muss ein Kind Prüfungen über sich ergehen lassen, bis es den nächsten Schritt gehen darf. In Schulen, in Sportvereinen, in Musik- und Ballettschulen.
Martina Winkler: Ich denke oft: Wenn wir das, was wir Kindern zumuten, von Erwachsenen verlangen würden, gäbe es eine Revolution. Allein die Tatsache, dass jedes Kind dieselbe Schullaufbahn durchlaufen muss. Jetzt ist Mathe, dann ist Deutsch. Das ist völlig egal, ob das Kind vielleicht in Mathe gerade in einer tollen Diskussion war und hier gern weiterdenken würde. Die muss es leider beenden, denn jetzt ist eben Deutsch, und zwar für alle. Talente spielen in der Sortierungsmaschine Schule leider eine viel zu geringe Rolle, ebenso Interessen. Kindern wird nicht zugetraut, dass sie beim Lernen ihr eigenes Tempo gestalten können.
Norbert Reichel: Es gibt einige wenige Schulen, die sich an der Dalton-Pädagogik orientieren. Aber das mögen Kultusministerien nicht so gerne. Dann stimmt am Ende zwar vielleicht das Ergebnis, aber nicht die Stundenzahl, die in der KMK vereinbart wurde, damit das Ergebnis auch überall anerkannt wird.
Martina Winkler: Oder Sport! Jedes Kind wird gezwungen, bestimmte Sportarten durchzuführen. Aber gerade hier haben Kinder doch ganz unterschiedliche Voraussetzungen und Vorlieben. Von Erwachsenen würden wir das nie im Leben fordern.
Straßenkindheit
Norbert Reichel: Ein interessantes Thema ist die Frage, wen Kinder treffen, welche Aufgaben sie haben. Treffen Kinder heute überhaupt noch Kinder? Gibt es noch so etwas wie Straßenkindheit? Auf der Straße wohl heute eher nicht, nur dann, wenn dort auch andere Kinder dort wohnen und wenn die Eltern den Kinderstundenplan nicht allzu sehr gefüllt haben. Kinder treffen erst einmal vorwiegend Erwachsene. Andere Kinder treffen sie in der KiTa, in der Schule, den Kindern ist es oft vor allem deshalb so wichtig, in die Schule zu gehen, weil sie nur da ihre Freund:innen treffen.
Martina Winkler: Straßenkindheit ist ein Schlüsselbegriff in der Forschung, aber auch im Denken von Erzieher:innen, Psycholog:innen und so weiter. Die These lautet etwas verkürzt, früher seien Kinder einfach mitgelaufen, sie konnten sich auf der Straße treffen (gegebenenfalls erst nach Arbeit natürlich), ihr Leben war nicht so durchorganisiert, und es gab auch nicht so viel Verkehr. Das hörte erst einmal mit der bürgerlichen Kindheit auf, das Kind sollte weg von der Straße. Das ist stark mit einer sozialen Segregation verbunden. Der Begriff der Straßenkindheit verstärkt dies. Erst wurden die bürgerlichen Kinder von der Straße geholt, dann nach und nach auch die Arbeiterkinder.
Norbert Reichel: So entstand der Hort, in den die Kinder gingen, deren Mütter als Arbeiterinnen nicht zu Hause bleiben konnten. Heute hat sich das etwas gedreht, weil nicht nur Arbeiterinnen außer Haus arbeiten, sodass wir Ganztagsschulen und Horte für alle brauchen. Inzwischen gibt es sogar einen Rechtsanspruch.
Martina Winkler: Auf der Straße bleiben dann nur noch die Obdachlosen.
Norbert Reichel: Und wir wären bei Oliver Twist.
Martina Winkler: Straßenkindheit wird um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert von der Normalität zum Problem. Ich fange gerade mit meinem Projekt zur Kindheit in der Stadt der sozialistischen Tschechoslowakei an. Bemerkenswert ist, wie auch in den 1970ern immer noch die Rede davon ist, dass wir die Erziehung der Kinder „nicht der Straße überlassen dürfen“. Das Interessante ist auch, dass das ein bürgerliches Argument ist, das der Sozialismus adaptiert, obwohl er sich anti-bürgerlich verstand. Kinder sind daher – so sieht das die politische Ebene – möglichst von morgens bis abends zu beschäftigen. In organisierten Kindergruppen, in der Schule, in Hort und Pioniergruppen – das ist oft das Gleiche. Man will die Lücken füllen. Es darf nicht sein, dass das Kind alleine aus dem Haus geht und sich außerhalb der staatlichen Strukturen bewegt. Die Literatur, aber auch soziologische Essays, in denen mehr Freiheit für Kinder gefordert wurde, beginnt in Gegenbewegung, Straßenkindheit zu idealisieren. Es wird viel erzählt, wie Kinder auf die Straße gehen und dort Abenteuer erleben und ihr Leben selbst gestalten.
Norbert Reichel: Ich kann mich an Bücher erinnern, die ich in den 1960er Jahren gelesen habe, wie dort Kinder – übrigens fast ausschließlich Jungen, ganz selten war ein Mädchen dabei – sich am Stadtrand trafen, dort sogar Probleme lösten, die sonst niemand sah, beispielsweise jemanden dingfest machten, der ein Auto stehlen wollte. Die Popularität der „Drei Fragezeichen“, die es viel später gab, beruht nach wie vor auf diesem Schema. Übrigens auch alle drei Jungen. Und die treffen sich auf einem Schrottplatz.
Martina Winkler: Kinderliteratur funktioniert sehr oft darüber, dass Kinder in besonderen Zeiten (Ferien) und Räumen (der Schrottplatz ist ein sehr gutes Beispiel) Freiheiten haben, die ihnen normalerweise fehlen. Da wird es dann interessant genug für eine spannende Geschichte. Dass diese Freiheit so besonders und anders ist, zementiert letztlich natürlich die normale Eingebundenheit in Schule, Zuhause, Spielplatz.
Kürzlich las ich den Bericht eines Stadtplaners, der immer wieder in fremde Städte fährt und sich dort von Kindern und Jugendlichen ihre Lieblingsorte zeigen lässt. Das sind meistens nicht die Orte, die Erwachsene für Kinder gebaut haben. Es sind nicht Spielplätze, sondern unbebaute Flächen. Oder Parkhäuser, die für Skater interessant sind. Leerstehende Häuser.
Norbert Reichel: Der Düsseldorfer Erziehungswissenschaftler und Soziologe Ulrich Deinet hat einmal in Düsseldorf in Ganztagsschulen untersucht, wie Kinder die Räume wahrnehmen. Die Kinder fanden Verstecke, sie setzten Bordsteine für bestimmte Spiele ein, richteten sich in einer Art ein, wie sich das Stadtplaner kaum vorstellen konnten. Die wollten lieber alles schön sauber, rechteckig und übersichtlich.
Martina Winkler: Das betrifft auch die Nutzung von Schulräumen. Erziehungs- und Sozialwissenschaften, Psychologie haben einiges dazu veröffentlicht, aber historisch gibt es so gut wie nichts. Ich will diese Lücke mit meinem neuen Projekt etwas füllen.
Norbert Reichel: Ich kenne in Deutschland die Debatte aus den 1970er Jahren, für den Nachmittag Schulhöfe zu öffnen, damit Kinder dort spielen könnten. Das wurde durch die Ganztagsschulen schwieriger, weil dann schulangehörige und schulfremde Kinder sich die gleichen Räume und Geräte teilen. Außerdem gibt es inzwischen die Diskussion zum Bedarf für Sicherheitspersonal, das dafür sorgt, dass auf den Schulhöfen nicht das geschieht, was auf anderen Spielplätzen gang und gäbe ist, Drogenspritzen und Ähnliches. Inzwischen schließen Kommunen Schulhöfe wieder für die Schulexternen.
Martina Winkler: Ich habe mir Diskussionen in der sozialistischen Tschechoslowakei aus den 1950er und 1960er Jahren angeschaut, da sehen wir genau diese Diskussion. Kinder brauchen Raum, der aber eingegrenzt und kontrolliert sein muss. Wenn wir Spielplätze haben, brauchen wir auch jemanden, der darauf aufpasst. Spielplätze ohne Aufsicht galten als Riesenproblem und potentielle Gefahr.
Norbert Reichel: Werden diese Themen in Ihrem Lehrangebot angenommen?
Martina Winkler: Ich habe viele Lehramtsstudierende. Da kommt das Thema gut an. Es ist allerdings so, dass Studierende häufig mit der Frage ankommen, ob es „früher“ besser oder schlechter war. Sie lernen dann, dass das nicht die Frage für geschichtswissenschaftliche Forschung ist, sondern dass es darum geht zu analysieren, woher bestimmte Ideen kommen. Ich habe aber auch das Gefühl, dass das Thema fasziniert. Man beginnt damit, Vorstellungen von Kindheit zu dekonstruieren. Das ist auch emotional herausfordernd: In so einer Art Astrid-Lindgren-Kindheit fühlt man sich doch sehr wohl, die Dekonstruktion kann schmerzhaft sein, denn wir zerstören auch Erinnerungen und Idealbilder. Bei Themen wie Race und Gender sind wir mit der Dekonstruktion von Zuschreibungen schon sehr weit, nicht aber beim Thema Kindheit. Ich habe aber das Gefühl, dass die meisten Studierenden sich letztlich gern darauf einlassen. Und ich lerne auch von Ihnen, gerade von denen, die schon einmal ein Praktikum in der Schule gemacht haben und ihre Erfahrungen reflektieren und weitergeben.
Norbert Reichel: Astrid Lindgren wäre noch ein eigenes Thema. Da gibt es die Anarchist:innen wie Pippi, Lotta und Michel und es gibt die bürgerlichen Bullerbü-Kinder. Als drittes dann die eher in die Fantastik gehörenden Erzählungen wie „Mio, mein Mio“ oder „Die Brüder Löwenherz“, meines Erachtens das beste Buch zum Thema Tod, das Kinder lesen können oder besser: das Eltern mit ihren Kindern gemeinsam lesen sollten.
Martina Winkler: Das war das Verdienst von Astrid Lindgren: Solche Themen für Kinder und Erwachsene aufzunehmen und in einer sehr poetischen Form darüber zu schreiben. Die Kinder stehen bei ihr im Zentrum. Sie werden ernst genommen. Mir gefällt ihr Spruch: „…und dann muss man ja auch noch Zeit haben, einfach dazusitzen und vor sich hin zu schauen“. Nicht nur für Kinder wichtig.
(Anmerkungen: Erstveröffentlichung im April 2025. Internetzugriffe zuletzt am 11. April 2025. Titelbild: Kindergruppe in Prag. Foto: Annemarie Schwarzenbach (1908-1942), März 1938 (Ausschnitt), Schweizer Nationalbibliothek SLA-Schwarzenbach-A5-18/088. Wikimedia Commons.)