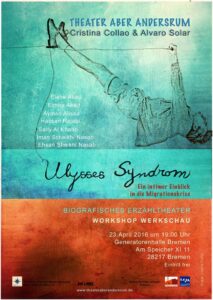Sag mir, wer die Menschen sind
Zwei biografische Dokumentationen des Hirnkost Verlages
„Was ist Freiheit? / Ich konnte die Schule in meiner Heimat nicht weiterbesuchen, / weil Frauen nicht durften. / Deshalb bedeutet für mich Freiheit, lesen und schreiben zu können. / Anderen zu sagen, wer ich wirklich bin. / Zu wissen, wer ich bin und mich frei ausdrücken zu können. / Und dabei keine Angst zu haben.“
Diese Sätze sind eine Strophe der „Stimmen von fünf verschiedenen Frauen“, die die chilenischen Künstler:innen Alvaro Solar und Cristina Collao im Jahr 2020 in dem Buch „Grenzenlose Hoffnung – Erinnerungen in Zeiten der Flucht“ veröffentlicht haben. Das Buch erschien im Berliner Hirnkost Verlag und ist das Ergebnis eines biografischen Theaterprojekts des Ensembles „Theater Aber Andersrum”. Menschen im Exil, Geflüchtete, Menschen, deren Eltern als Gastarbeiter:innen nach Deutschland kamen, Menschen, die als Kinder, Menschen, die nach abenteuerlichen Wegen in Bremen einen Ort der Ruhe fanden, zumindest vorübergehend, all die Menschen, die in unseren Statistiken mit dem Begriff des sogenannten „Migrationshintergrundes“ geframt werden, sie alle berichten. Es sind Erfolgsgeschichten, auch wenn sich noch nicht alle möglichen Erfolge eingestellt haben und manche sich vielleicht auch nie einstellen werden. Aber es gehört zu den Denkwürdigkeiten der Debatten um Migration, dass mehr oder weniger allen Menschen, die einen etwas dunkleren Teint haben, unterstellt wird, sie wollten sich nicht in die deutsche Gesellschaft „integrieren“. Der Band belegt, wie falsch diese Annahme ist.
Ein anderes Buchprojekt des Hirnkost Verlages präsentiert kaum Erfolgsgeschichten. Der Titel: „Todesursache Flucht: Eine unvollständige Liste“. Die erste Auflage erschien im Jahr 2018, im Jahr 2023 erschien die dritte Auflage. Das Buch erinnert an die Stimmen von Menschen, die in Politik und Medien in der Regel keine Stimmen (mehr) haben. Es bietet im ersten Teil Analysen, Statements, Testimonials zu Leben und Tod von Menschen, die die tödlichste Grenze dieser Welt, das Mittelmeer zwischen Nordafrika und Südeuropa, zu überwinden versuchten und scheiterten. Im zweiten Teil finden wir lange tabellarische Listen der Toten. Einige werden namentlich genannt, die Namen der meisten Menschen sind unbekannt. Bei vielen kann das Herkunftsland genannt, werden, bei allen erfahren wir die konkrete Todesursache sowie die Quelle, auf die sich die beiden Herausgeberinnen, Kristina Milz und Anja Tuckermann, berufen. Die beiden Herausgeberinnen gestalteten mit dem Buch ein Epitaph für all die Menschen, deren Namen niemand nennt.
Ein biografisches Theaterprojekt mit Königen und Königinnen
Doch wie entstanden die Berichte, die in „Grenzenlose Hoffnung“ dokumentiert werden? Verwandelten sich die Menschen, deren Texte wir lesen, im Theater in Schauspieler:innen? Waren sie nur Objekt oder Subjekt des Projektes? Hatten sie den Verlauf selbst in der Hand? Wie viel steuerte die Regie? Es ließe sich vieles denken. In der aktuellen Theaterszene gibt es diverse beachtenswerte Versuche, sich nicht nur mit professionellen, sondern auch mit Laienschauspieler:innen – ich scheue mich, den meines Erachtens despektierlichen Begriff der „Betroffenen“ zu verwenden, auch das Wort von den „Laien“ hat leider etwas Abwertendes – an das Thema heranzuwagen. Das Buch vermittelt viele konkrete und authentische Einblicke in das Leben der sich äußernden Menschen während und nach der Flucht, am Orten des Transits und am Zielort der „Hoffnung“. 65 Menschen erzählen ihre Geschichte. Die erzählten Geschichten können nicht nur gesprochen und vorgetragen, sondern auch gelesen und vielleicht auch vorgelesen werden. Auf jeden Fall würde ich empfehlen, sie laut zu lesen.
Die Texte entstanden in Workshops, die jeweils zwölf Tage dauerten, an deren letztem Tag die Teilnehmenden ihre Geschichte in deutscher Sprache oder in ihrer Muttersprache – jeweils mit Simultanübersetzung via Beamer – vorstellten. Die Workshops waren kostenlos und so etwas wie „eine künstlerische Antwort auf die globale Migrationskrise, (…) wie sie ab 2015 die politische Debatte dominierte, die Bevölkerung hierzulande und in ganz Europa beschäftigte und die Gemüter erhitzte.“ Ich möchte hinzufügen, nicht erst seit 2015, denn Lampedusa, die Insel, die in den Tagen, in denen ich diese Rezension schreibe, wieder im Mittelpunkt europäischer Debatten über Migration, Flucht und Einwanderung steht, war auch schon 2011 Gegenstand umfangreicher Presseberichterstattung. Und auch schon in den 1990er Jahren gab es vergleichbare Debatten. Der einzige Unterschied: seit etwa 2015 profitieren rechtspopulistische und rechtsextremistische Parteien in Umfragen und Wahlen von dieser „Krise“, sodass in der politischen Debatte mehr darüber diskutiert wird, wie man mit diesen Parteien umgehen sollte, als darüber, was mit den Menschen geschieht, deren Hoffnungen und Träume offensichtlich als Anlass dieser Debatten missbraucht werden.
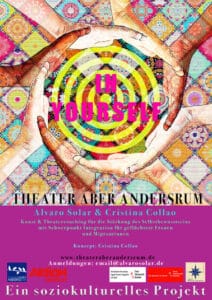
In Yourself – ein Projekt zur Stärkung des Selbstbewusstseins von geflüchteten Frauen und Migrantinnen. Quelle: Internetseite von Theater Aber Andersrum.
Die Texte in „Grenzenlose Hoffnung“ sind Prosatexte, man könnte sie im weitesten Sinne als Testimonials bezeichnen, aber die Form macht den Unterschied. Die Texte sind jeweils zentriert gedruckt und erwecken durch Zeilensprünge und Leerzeilen den Eindruck lyrischer Texte, nicht zuletzt auch in der Art und Weise wie sich das Leben der jeweiligen Sprecher:innen in knappen ausgewählten Worten im doppelten Wortsinn verdichtet. Die in den Texten enthaltenen Geschichten werden mit diesen Stilmitteln zu ausgesprochen individuellen und in sich reflektierenden und reflektierten Botschaften.
Ein Beispiel bietet der 18 Jahre alte Steven, Deutscher, Amerikaner und Nigerianer. Sein Name bedeutet so viel wie „Krone“ und „Die Krone“ ist auch der Titel seines Textes. Er „war früher ein König, ich war der König der Diebe“. Nach einem fehlgeschlagenen Versuch der Polizei, ihn zu Hause zu stellen, schaut er angesichts der Tränen seines Vaters in einen Spiegel: „Ich fand nicht gut, was ich sah. / Ich entschied mich dazu, mich zu ändern.“ Der Text endet mit den Versen: „Seitdem ist alles anders. / Ich trage nicht mehr die Krone der Diebe, / aber ich habe eine andere: // die Krone meines Willens.“
Eine Königin ist Joy aus Nigeria, so auch der Titel ihres Textes: „Die Königin“. Sie kommt „tatsächlich aus einer königlichen Familie“ und hat in ihrer Kindheit ihrer Großmutter zugehört, die „über / Oba Ovonramwen Nogbaisi erzählt, / der war 1888 König von Benin. / Sein Name bedeutet ‚die aufgehende Sonne‘.“ Ihrem Sohn erzählte sie, als er traurig war, von der Stärke des Propheten Daniel in der Löwengrube: „Er war stark und die Löwen respektierten ihn, / weil er auch wie ein Löwe war, und der Löwe / ist der König des Dschungels.“ Diese Stärke lebt sie im Alltag und kontert selbstbewusst rassistische Bemerkungen: „Einmal in Bremen haben meine Kinder / in der Straßenbahn schön gesungen. / Ein älterer Mann sagte: / ‚Geht zurück in euer Land!‘ / Ich wurde nicht sauer, ich fragte einfach zurück: „‘Bist du nie Kind gewesen?“ / Und das war’s, er war ganz still. / Und meine Kinder sangen weiter. / Er hat sicherlich gedacht: ‚Was will diese Schwarze von mir?‘ / Das ist aber auch falsch, ich bin nicht schwarz; / meine schöne Haut hat die Farbe von Schokolade.“ Und wenn sich Menschen nicht neben sie setzen möchten, denkt sie: „Ich bin eine Königin.“
Der Flug in die Freiheit
Die Bilder von Christina Collao begleiten, kommentieren, schaffen Assoziationen und verstärken die Wirkung der Texte auf Hörer:innen und Leser:innen kongenial. Schon auf dem Cover des Buches ist ein Vogel zu sehen. Er schaut aus dem Bild links oben heraus, unten rechts schaut ein Mensch auf den Baum, auf dem der Vogel sitzt. Wird er gleich davonfliegen? Der Baum ist mit einer futuristisch anmutenden Skulptur verbunden, die nach oben dreieckige Fenster aufweist, die den Eindruck eines Raumschiffs erwecken. Diese Struktur erscheint auch in anderen Bildern, so beispielsweise zwischen den Texten „Das Abenteuer leben“ und „Unbeugsam“, diesmal um den Kopf einer Frau herumdrapiert, die dank ihres gazeartigen Gewandes nach oben zu entfliegen verspricht. Auch andere Tiere, aber immer wieder Vögel erscheinen in den Texten, beispielsweise in dem eingangs bereits zitierten Text „Ich bin eine Frau“, der die Stimmen von fünf verschiedenen Frauen in sich vereint: „Wenn ich ein Tier wäre, / dann möchte ich eine Löwin sein, seil sie stark ist. / Ich möchte ein Reh sein, weil es ruhig und friedlich ist. / Eine Möwe, weil sie schön und frei ist. / Eine Taube, sie hat keine Angst vor den Menschen. / Ein Adler, um sehr hoch fliegen zu können.“
Man könnte das Projekt psychologisierend als ein Projekt der Resilienz bezeichnen. In der Tat steckt hinter den kurzen Texten, die alle etwa zwei oder drei, maximal vier Seiten beanspruchen, eine lange Geschichte. Menschen kamen aus Syrien, Afghanistan, Iran, Kurdistan, Albanien, Serbien, Nigeria, Kamerun, Ghana und fanden in Bremen einen Ort, in dem sie zumindest vorübergehend Ruhe finden, manche mit ihrer Familie, manche von ihren Familien getrennt, über Zeiten, deren Dauer sie noch nicht absehen können. Bremen ist durchaus so etwas wie „Heimat“ geworden, und doch gibt es gleichzeitig „Heimweh“. Die Auflösung dieses scheinbaren Widerspruchs ergibt sich nicht unbedingt von selbst, sondern ist eben das natürliche Ergebnis eines langen Lebens. Sevgi, die „im Jahr 1950 / an der türkischen Schwarzmeerküste zur Welt gekommen“ und im Alter von sieben Jahren nach Deutschland kam, nennt sofort ihren Traum ohne von einem Traum zu sprechen. Ähnlich wie bei Steven ist ihr Name ihr Lebensmotto: „Sevgi bedeutet ‚Liebe‘“. Zwei Mal sagt sie dies. Sie erzählt von ihrer Schwangerschaft, vom Tod ihres Mannes, von ihren Schwiegereltern, die sie als „Dienstmädchen“ behandelten, von der Einsamkeit in der Familie. Sechs Monate pflegte sie ihre todkranke Mutter in der Türkei und stellte fest, dass sich ihr „Heimweh“ auf Bremen bezog. „In der Türkei fühle ich mich oft unruhig, / es ist mir zu laut. / Die Menschen dort hören nicht zu, / sie haben keinen Respekt vor den anderen. / Und ganz schlimm: Man darf nicht sagen, was man denkt. / Ich fühle mich in meiner alten Heimat nicht mehr frei. // Deshalb liebe ich Bremen. / Bremen ist meine Heimat.“
Nicht nur die Frauen, aber sie sagen es oft sehr deutlich, sie benennen die patriarchalischen Systeme, denen sie entkommen konnten, sie sprechen über die Misshandlungen, die Degradierung zur Dienstmagd in der Familie des Ehemannes, sprechen über die Kinder, die ihnen genommen wurden. Migration und #MeToo – zwei Seiten einer Medaille? Der Text „Ich bin eine Frau“ zeigt dies besonders klar. Wir hören die Stimmen von fünf verschiedenen Frauen aus Ghana, Kamerun, Afghanistan, Iran und Ägypten. Sie sprechen über ihre Wünsche, ihre Freiheiten und die Freiheiten, die ihnen verwehrt wurden: „Was braucht eine Frau, um glücklich zu sein? / Respekt, Freiheit, Liebe, Treue, Freude, / Frieden, Zärtlichkeit, Ruhe, Solidarität, Freundschaft, / Rechte wie die Männer, Bildung, Mut und Tapferkeit, / um im Leben weiterzukommen.“ In dem Text „Kanzlerin“ stellt sich vor was sie täte, wenn sie dieses Amt ausübte. „Ich würde ein System entwickeln, in dem alle die gleichen Chancen haben, zu studieren, um danach eine gute Arbeit zu finden. / Die Türken genau wie die Deutschen.“
Der Weg durch die Wälder
Mehrere Texte erzählen die Geschichten der Flucht. Samaoullah aus Kundus in Afghanistan kam über die sogenannte „Balkanroute“. Ausführlich beschreibt er die Wege und Umwege, mit dem Bus, zu Fuß, unter der Aufsicht eines Schleppers, immer achtgebend, dass die Polizei nicht zugreift, die Verstecke, das Boot nach Griechenland: „Zwei Monate dauerte meine Odyssee“. Er weiß, dass er nicht entscheiden kann, ob er in Deutschland bleibt, er weiß, dass er eine afghanische Frau heiraten möchte, die Muslima ist. „Sie wird von meiner Familie ausgesucht. / Dann wird sie zu mir nach Deutschland kommen. // Hoffe ich.“ Den Vergleich mit dem „Vielgewanderten“, dessen Geschichte Homer erzählte, wagen auch Alvaro Solar und Christina Collao in der dem Buch vorangestellten Widmung, die ebenso wie alle anderen Texte zentriert als lyrischer Text gestaltet wurde. „Dieses Buch / ist Dank des Mutes / jener Menschen entstanden, / die sich auf den Weg gemacht haben, / um große Entfernungen zu überqueren / und sich dem Unbekannten zu stellen. / Sie sind die Odysseus‘ unserer Zeit, / die aufgebrochen sind, / um / zu ihrer neuen Ithaka / zu gelangen. // Ihnen allen / unseren Respekt / und unser Mitgefühl.“ Flüchtende sind Held:innen.
Nabiuollah aus Afghanistan, erzählt von den Bildern auf seinem Handy, „wo man meine Familie sehen kann. / Es sind aber keine Urlaubsbilder, es ist der Exodus nach Europa.“ Sie sind die Auserwählten, von wem auch immer, die viele Menschen zurückließen, „weil wir so viele waren und kleine Kinder mit dabei hatten.“ Es ist vielleicht nicht das Land, in dem Milch und Honig fließt, aber etwas prosaischer hofft Nabiuollah, dass er und seine Kinder „in dieser neuen Realität aufwachsen können / Und wir endlich das Gleichgewicht für unser Leben finden.“ Eine weitere Reminiszenz an klassisches Bildungsgut finden wir in dem Text von Kaya, der von seinem Vater nach einem sowjetischen Maschinengewehr „Doschka“ genannt wurde. Kayas Text ist mit sechs Seiten einer der längsten Texte und zeichnet sich dadurch aus, dass beschreibende und reflektierende Passagen einander abwechseln, die reflektierenden Passagen im Kursivdruck.
Mehrfach spricht Kaya in den kursiv geschrieben Passagen davon, dass er „als Kind weiterhin verloren im Wald“ war: „Ich war zehn Jahre alt und war im Wald verloren.“ Es war nicht die Lebensmitte wie bei Dante, es war die Kindheit: „Meine Kindheit ist keine Kindheit. / Kinderspiele? Kenne ich nicht.“ Aber da ist die Kraft, die aus dem Weg erwächst: „Ich war der Held, der den Wald / und seine Dunkelheit durchquert / und aus dem Wald stärker und reifer hinausgeht.“ Noch nicht wissend, wie gefährlich der neue Wald in Europa sein würde, mit seinem kalten Klima, der fremden Sprache, den zurückhaltend begegnenden Menschen, aber auch mit einem Versprechen: „Und gleichzeitig / liebe ich an diesem neuen Wald die Freiheit / und all die Möglichkeiten, / die er für mich eröffnet hat.“
Die Begegnungen in diesem „neuen Wald“ sind vielfältig. Die Hauptrolle spielen jedoch die Kräfte, mit denen die Sprecher:innen Zuversicht und Freiheit gewinnen. Gleichwohl benennen sie auch die undurchsichtigen und bürokratischen Asylverfahren, die nicht anerkannten Studiennachweise, den prekären Aufenthaltsstatus, die Hilflosigkeit, die Trennung von Familienangehörigen, aber es ist so wie es Akil aus Aleppo sagt: „Übrigens: Das Schönste an Bremen ist, / dass hier zurzeit keine Bomben fallen.“ Dieser einzelne Satz wurde auch schon vor allen anderen Sätzen als Motto abgedruckt. Frieden ist doch schon erst einmal die Abwesenheit von Krieg, aber das einschränkende „zurzeit“ sollten wir auch nicht überlesen. Aber immerhin. Sheriff aus Kamerun, dessen Vater starb, als er zehn Jahre alt war, sagt: „Ich bin nicht hier, weil ich unbedingt wollte, / ich musste mein Land verlassen, ich floh vor dem Bürgerkrieg.“ Aber in dem Land, in dem es keine Entführungen und Morde gibt, in dem er „dank eines vom Himmel gekommenen Engels“ jetzt leben kann, weiß er, was er erreichen will, „dann sehe ich mich als Automechaniker arbeiten. / Ich habe meine eigene Werkstatt und einige Mitarbeiter. // Ich wünsche mir für meine Zukunft ein schönes Haus, / eine gute Frau, vier Kinder, / und natürlich das schönste Auto der Stadt. / Ich bin sicher, ich werde es schaffen, / weil ich wie der Bambus meines Dorfes in Afrika bin: // stark und resistent, aber flexibel.“
Der Traum heißt im Grunde Normalität. Ob alles „normal“ ist, „normal“ wird, ob es Normalität geben mag? Dies lässt sich durchaus ironisieren, weil alles Prekäre, alle Unsicherheit, alle Risiken sich so vielleicht besser ertragen lassen. Bryan, in Bremen geboren, dessen Eltern aus Ghana kamen, erlebt, dass er mit seinen Freunden „oft komisch angeschaut“ wird, dass er „keine deutschen Freunde“ hat, aber eigentlich ist „Alles normal“. Nein, eines nicht: „Ach so, bevor ich es vergesse: / Ich bin Fan von Bayern München. / Ich weiß, was Sie denken: // ‚Das ist nicht normal!‘“ Ist doch klar, in Bremen!
Die doppelten Standards (nicht nur) der Seenotrettung

Graffiti-Kopie des Fotos von Alan Kurdi der Künstler Justus „Cor“ Becker und Osguz Sen an der Osthafenmole in Frankfurt am Main, Titel: „Europas Tod – Der Tod und das Geld“. Foto: Plenz. Wikimedia Commons, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.
Die Geschichten, die in „Todesursache Flucht“ dokumentiert werden, sind alles andere als „normal“. Aber wir haben uns offenbar an sie so sehr gewöhnt, dass wir sie nicht mehr hören möchten. Die Normalität des Wegschauens und Weghörens bestimmt unsere politischen Debatten. Der Band wurde von 81 Organisationen unterstützt, darunter United4Rescue, ein Zusammenschluss von 850 Organisationen und medico international, die das Projekt auch finanziell gefördert haben. In den Vorworten nennen sie die Ziele, „diesen Menschen ihre Namen und Geschichten zurückgeben“ (United4 Rescue), denn: „Gegenüber dieser politisch erzeugten Ignoranz gilt es, eine globale Solidarität von unten zu verteidigen“ (medico international). United4Rescue und andere Organisationen werden auch von der Bundesregierung unterstützt, die sich so auch bei den Verhandlungen auf europäischer Ebene über Fluchtmigration in – politisch zurzeit wohl nur schwer auflösbare – Widersprüche verstrickt.
Die Widersprüche der staatlichen Migrationspolitik(en) werden in den analytischen Beiträgen von „Todesursache Flucht“ mehrfach genannt. Der Historiker Carlos Collado Seidel erinnert an das Bild des im September 2015 an der türkischen Küste angeschwemmten Alan Kurdi, ein zwei Jahre altes Kind, das mit seinen Eltern vor dem sogenannten „Islamischen Staat“ aus Kobane in Syrien flüchten musste. Dieses Bild sorgte damals – ebenso wie die Rede Angela Merkels mit dem berühmten Satz „Wir schaffen das“ – für eine Solidarität, die aber schnell zerbrach. Angela Merkel geriet kurze Zeit später ebenso unter Druck wie im letzten spanischen Wahlkampf der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez, der sich ebenfalls für einen humanen Umgang mit den Geflüchteten aussprach, andererseits aber nach wie vor die Zäune um die spanischen Enklaven Ceuta und Melilla auf dem afrikanischen Festland erhielt: „Und die messerscharfen Klingen an den Grenzzäunen von Ceuta und Melilla blitzen entgegen den Ankündigungen des Ministerpräsidenten unverändert im Sonnenlicht. Jene, denen es gelingt, den Zaun zu überwinden, werden nach Marokko zurückverfrachtet. Währenddessen werden tagtäglich weitere Leichen an Land gespült.“

Dani Karavan, Pasajes – Memorial Walter Benjamin a Portbou. Foto: Guillem.rubio. Wikimedia Commons, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.
Carlos Collado Seidel erinnert an die Konferenz von Evian im Jahr 1938, als „nach Wegen gesucht wurde, um den im menschenverachtenden NS-Deutschland verfolgten Juden eine Zuflucht zu bieten. Die Konferenz verlief ergebnislos.“ Er zitiert Golda Meir, die berichtet, wie es war, sich anzuhören, „wie furchtbar gern sie (die 32 teilnehmenden Staaten, NR) eine größere Zahl Flüchtlinge aufnehmen würden und wie schrecklich leid es ihnen tue, dass sie das leider nicht tun könnten“. Einen ähnlichen Vergleich zieht der langjährige Leiter der Abteilung Rechtspolitik von Pro Asyl Bernd Mesovic. Er beginnt seinen Beitrag „Namenlose: Gedanken zu Gedenken“ mit dem an den Tod von Walter Benjamin erinnernden Gedenkort „Passagen“ des israelischen Künstlers Dani Karavan: „Wer den Gedenkort gesehen hat, besser gesagt: im Denkmal gewesen ist, wird sich mit dem Blick aufs Meer nicht des Eindrucks erwehren können, dass der chancenlose Blick ins weite Blau das Gedenken an die Hoffnungen vieler Flüchtlinge einschließt, die in der Geschichte den Weg übers Meer versucht haben, sich in seeuntüchtigen Booten oder mit Hilfe von HelferInnen an Land gerettet haben oder mit ihren Hoffnungen gescheitert und gestorben sind.“ Die Leser:innen von „Todesursache Flucht“ werden sich an weitere Beispiele und Analogien erinnern.
Durch solche Analogien wird in keiner Weise die Einzigartigkeit der Shoah in Frage gestellt, es geht einzig und allein darum, dass jedes einzelne Leben zählt, dass die Erinnerung an die Gescheiterten, an die Toten zur kollektiven Erinnerung in Europa gehören muss. Müsste, sollte. Und nicht nur dort: Bernd Mesovic erinnert an die Aufnahme der vietnamesischen Boat People nach dem Abzug der USA aus Vietnam, die Rettungsaktionen der Cap Anamur, Ester Schindell erinnert an die Verschwundenen, die „Desaparecidos“ in lateinamerikanischen Diktaturen und zitiert das 2010 in Kraft getretene Internationale Übereinkommen zum Schutz aller Personen vor dem Verschwindenlassen (International Convention for the Protection of all Persons from Enforced Disappearance, ICPPED), das auch Deutschland ratifiziert hat. Heribert Prantl überschreibt seinen Beitrag mit dem Titel „Die Todsünden Europas – Flüchtlingspolitik mit Todesfolge“ und erinnert an die Pogrome von Hoyerswerda und Rostock-Lichtenhagen, aber auch an den Tod von Geflüchteten im Polizeigewahrsam, namentlich an Aamir Ageeb aus dem Sudan, der am 30. Mai 1999 am Frankfurter Flughafen durch die Gewalt von Grenzschützern erstickte. Die drei Beamten wurden verurteilt. „Der Vorsitzende der Strafkammer verglich die Zustände in der Abschiebehaft mit den Zuständen im irakischen Abu-Ghraib-Gefängnis.“ Ebenso wie Heinrich Bedford-Strohm zitiert er Jesaja. Weinen wir „Krokodilstränen“? Oder gibt es Hoffnung? Heribert Prantl beschreibt die Widersprüche der politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen: „Die Gewalt begann mit Worten und endete mit dem Pogrom von Rostock, mit Mordbrennereien – und der Abschaffung des alten Asylgrundrechts. 2023 = 1992 plus Internet? Heute gibt es aber auch, trotz oder gerade wegen alledem, eine starke zivilgesellschaftliche Bewegung, die sich um Flüchtlinge kümmert. Pro Asyl und Co haben mehr Mitglieder als die AfD.“
Schaut doch endlich hin!
Bis zum 24. Februar 2023 wurden 51.300 Tote dokumentiert, ungeachtet einer zu vermutenden und wahrscheinlichen Dunkelziffer. Kristina Milz und Anja Tuckermann benennen das Dilemma der Zahlen: „Nackte Zahlen schützen uns vor der Nähe die uns befällt, wenn wir Geschichten hören.“ Eben dies ist das Ziel des Buches. Zum Abschluss sehen wir das Foto eines Friedhofes. Es ist der Friedhof von Castellamare del Golfo“ mit seinem Gedenken an einige der am 3. Oktober 2013 Verstorbenen. Im Vordergrund ein Grabstein mit der Inschrift (deutsche Übersetzung): „Vom stürmischen Meer des Lebens / Zum stillen Meer der Ewigkeit / in einer unendlichen Umarmung“ (im italienischen Original: „DAL TEMPESTIVO MARE DELLA VITA / AL QUIETO MARE DELL’ETERNITÁ / IN UN INFINITO ABBRACCIO“).
Aber es gibt auch Geschichten, die gut ausgingen. Robert Mougnol kam aus Kamerun. Er beschreibt – aufgezeichnet hat seinen Bericht Anja Tuckermann – seinen Weg durch Nigeria, durch den Niger, durch Algerien, den Pushback von dort wieder in den Niger, die Ankunft in Libyen, die Überfahrt in einem defekten Boot: „Wir haben nie geschlafen, am Tag nicht, in der Nacht nicht, über uns die Sterne, jeder betete für sich.“ Er nennt die Toten, die Gestorbenen, die Verunglückten, den Versuch der libyischen Küstenwache, das Boot zu versenken, die Rettung durch das Sea-Watch-Schiff. „Wir waren vier Tage auf diesem Schiff. Es hat uns nach Italien gebracht. Als wir nach Italien kamen, waren so viele Polizisten, so viele Leute vom Roten Kreuz und Krankenwagen da, das war so schön. Wir waren so glücklich. Sie haben uns in ein großes Camp gebracht. Ich habe erstmal drei Tage geschlafen.“ Robert Mougnol – so lesen wir – kam mit 17 Jahren nach Deutschland und macht jetzt eine Ausbildung zum Altenpfleger.
Das ist eine Geschichte, eine Geschichte, wie sie auch in „Grenzenlose Hoffnung“ geschildert werden könnte. Die meisten Geschichten sind jedoch Geschichten des Todes, des ungeheuren Drucks angesichts der Ängste vor Polizei und Militär in den Transitländern, den unwürdigen Zuständen in Lagern und auf Polizeistationen in Europa, der ständigen Angst, wieder irgendwohin zurückgeschickt zu werden, wo man niemanden kennt. Faraidun Salam Aziz aus dem irakischen Kurdistan stürzte sich in Apolda aus dem Fenster des Wohnheims. Er hatte um Hilfe gerufen, aber niemand öffnete den abgesperrten Raum. „Ob er sich das Leben nehmen wollte oder hoffte, dem zum Gefängnis gewordenen Zimmer zu entkommen, weiß niemand.“ Jamal Nasser Mahmoudi war einer der 69 am 69. Geburtstag des damaligen Innenministers Horst Seehofer abgeschobenen („rückgeführten“) jungen Menschen aus Afghanistan, die nicht unbedingt aus Afghanistan kamen, denn einige kamen wohl eher aus dem Iran, aber das wird nicht immer so genau recherchiert. Er erhängte sich in Kabul. Darüber und über den merkwürdigen Humor von Horst Seehofer schrieb „die Schriftstellerin Lina Atfah aus Salamiyya in Syrien für Die ZEIT in einem offenen Brief an Horst Seehofer.“ Sie „wurde in ihrer Heimat im Alter von 17 Jahren der Gotteslästerung und Staatsbeleidigung beschuldigt, heute lebt sie in Wanne-Eickel.“ Lina Atfah ist eine der Autorinnen, die das Projekt „Weiter Schreiben“ unterstützt, und Gastautorin des ZEIT-Angebots „10nach8“.
Erzählt die Geschichten!
Weitere Geschichten ließen sich erzählen. Von Gräbern, die es nicht gibt, von Menschen, die verzweifeln und von einigen, die Glück hatten. Das Buch „Todesursache Flucht“ dokumentiert wie zufällig es ist, ob jemand den Weg nach Europa oder nach Deutschland schafft. Wir finden Berichte über die Lage in jordanischen Flüchtlingslagern, über die Behandlung von Geflüchteten in Bulgarien, Griechenland, Rumänien, Kroatien und Polen, über ein Gefängnis in Eritrea, über die Situation an der polnisch-belarussischen Grenze, über die Friedhöfe. Sandra Arbelaez und Fabiola Velasquez dokumentieren den provisorisch angelegten und letztlich unwürdigen Friedhof für Asylsuchende im griechischen Dorf Kato Tritos: „Bisher sind alle Bemühungen, diesen Ort zu einer offiziellen Ruhestätte für verstorbene Geflüchtete und Asylsuchende zu machen, erfolglos geblieben.“ Rolf Gössner nennt in einem Beitrag das Buch „eine verstörende Dokumentation menschlichen Leids und einer humanitären Katastrophe.“
Die Worte, mit denen sich diese vielen Tragödien beschreiben ließen, sind noch nicht erfunden, sodass jeder Bericht, jede Analyse letztlich nur anzudeuten vermag. Einige Gedichte von Geflüchteten, kurze Prosatexte, kommen diesen Tragödien vielleicht besonders nahe. Vielleicht sind lyrische Texte, kurze Prosaformen der angemessene Modus? Erzählen wir die Geschichten, beispielsweise die der jungen Somalierin Samia Yusuf Omar, die bei den Olympischen Spielen in Peking startete, von der Teilnahme an den Olympischen Spielen in London 2012 träumte und bei der Überfahrt vor Malta ertrank. Reinhard Kleist hat ihr in einer Graphic Novel ein Denkmal gesetzt. Ihr Lauf in Peking ist auf youtube zu sehen. Ihre Botschaft: niemals aufgeben! Und die Botschaft an uns? Wer auch nur im Entferntesten glaubt, dass sich Menschen ohne Not und einfach nur in der Hoffnung auf irgendwelche Sozialleistungen in welchem europäischen Land auf immer in ein nicht seetüchtiges Schlauchboot setzen, um das Mittelmeer zu überqueren, versteht gar nichts. Am Anfang ist Verzweiflung, viel Hoffnung, doch welche Geschichten erzählen die Verzweifelten, die Hoffenden? Die Erfolgreichen als Ansporn, die Gescheiterten als Mahnung für eine humane Migrations- und Integrationspolitik. Grund genug, die beiden hier vorgestellten Bücher aus dem Hirnkost Verlag zu erwerben und immer wieder hineinzuschauen.
Norbert Reichel, Bonn
(Anmerkung: Erstveröffentlichung im September 2023, Internetzugriffe zuletzt am 21. September 2023, Titelbild: Pixabay.)