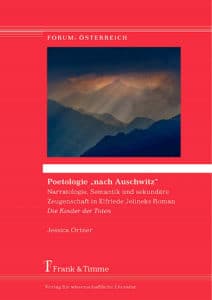Die Shoah erzählen
Jessica Ortner und Jana Hrdličká über scheinbare Hermetik
„Das Haus der Sprache ist mir leider zusammengekracht. Die Sprache ist ja auch gleichzeitig schwungvoll und produktiv wie verhüllend, ähnlich dem Feuer, das diesen Schädel ausgespien hat den Frau Frenzel da jetzt herumträgt: Ein großes J in altdeutscher Schrift ist eingraviert, seine Gattungsbezeichnung, weiter braucht der nichts, dies ist ein Unterrichtsgegenstand, vor dem die jungen Gleichgeister in ihrem eigenen Saft brutzeln, denn die Anatomieprüfung ist schwer. Man darf aber dreimal antreten, diesen Schädel dreimal verleugnen und dazu krähen. Die jungen Ärzte in spe glauben alles, was sie sehen. Ich bin der ewig Seiende, sagt ihnen der Totenschädel, aber das glauben sie nun wieder nicht.“ (Elfriede Jelinek, Die Kinder der Toten, 1995)
Wer die Frage stellt, wie sich die Shoah erzählen, über die Shoah sprechen, ihr in Alltag, Schule, Hochschule, in den Medien, in der Literatur gerecht werden ließe, hat schon die Welt des Unsagbaren betreten, aus der es keinen Ausweg gibt. Jedes Bild, jede Metapher, jeder historische Bericht, der behauptet zu zeigen, wie es gewesen sei, jeder pädagogische Appell – all dies ist fern davon, den Menschen eine Stimme zu geben, die die Shoah nicht überlebt haben.
Aber selbst den Überlebenden versagt angesichts des unsäglichen Leids die Stimme, unbeschadet der vielen gedruckten, gefilmten und archivierten Berichte der Menschen, die manche Historiker*innen oft etwas despektierlich, Pädagog*innen jedoch voller Ehrfurcht Zeitzeug*innen nennen, während diejenigen, die die Shoah nicht (mehr) erinnern wollen, sich auf die Unverständlichkeit der Sprache herausreden, in der über sie gesprochen wird, oder sich in einem bockigen Pathos gefallen, mit dem sie einen endgültigen und diesmal wirklich endgültigen Schlussstrich fordern. Elfriede Jelineks Analyse gilt nicht für Österreich, aber vielleicht ist Österreich auch ein besonders gutes Beispiel: „Die österr. Geschichte will nicht, dass wir in den Spiegel schauen, sie will einfach nicht, dass wir glauben, da wäre etwas (Plastikfolien und Bildröhren) zwischen uns und ihr. Sie will sich mit uns versöhnen“ Bravo! Ausgezeichnet.“
Surreal und tief unter der Oberfläche
Gleichwohl: das Trauma überlebt, nicht nur in Österreich, in Deutschland, auch anderswo, eigentlich überall, es überlebt in den Überlebenden der Zweiten und Dritten Generation. Doch nicht diese, auch die Kinder und Kindeskinder der Täter*innen können sich vor der Präsenz der Toten der Shoah nicht verstecken, die Elfriede Jelinek in ihrem Roman „Die Kinder der Toten“ Wirklichkeit werden lässt. Aber auch hier gibt es natürlich auch ein Gegenmittel, am besten verneinnahmt man die Toten in dem, was gerne als „Erinnerungskultur“ gefeiert wird: „Mitleidig mit uns, weil wir all die Jahre dermaßen heucheln mussten, sprachen wir so oft von ihnen: Unsre Toten. Und Wir.“
Der Roman „Die Kinder der Toten“ von Elfriede Jelinek erschien 50 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, nach dem sich Österreich unter Berufung auf die Moskauer Deklaration der alliierten Außenminister vom 30. Oktober 1943 als das erste Opfer des nationalsozialistischen Eroberungs- und Vernichtungskrieges zu definieren vermochte. Im englischen Originaltext der Deklaration war Österreich „the first free country to fall a victim to Hitlerite aggression“. Und die Österreicher*innen wuschen ihre Hände in Unschuld. Ruth Wodak und ihre Forschungsgruppe betitelten eine Analyse der die Republik Österreich in den 1980er Jahren erschütternden Waldheim- und Wiesenthal-Kreisky-Peter-Affären mit dem Satz „Wir sind alle unschuldige Täter“ (Frankfurt am Main, Suhrkamp Taschenbücher Wissenschaft, 1990). Mit dem Bekenntnis zur Täter*innenschaft war es jedoch so weit nicht her. Man beschränkte sich auf eine Unschuldsbehauptung, die letztlich alle Österreicher*innen freisprach und allen, die etwas anderes behaupteten, gleich der üblen Nachrede bezichtigte und zu Feind*innen Österreichs erklärte. Elfriede Jelinek brachte dies in „Die Kinder der Toten“ auf den Punkt, mit der ganz besonderen Spitze im Futur II: „Wir können sie jedenfalls nicht fassen, das muss ein anderer getan haben. Wir können nicht einmal uns selbst fassen, wenn unsere Taten einmal vorbei sind. Dann werden wir damals nicht zu Hause gewesen sein.“
Der Roman „Die Kinder der Toten“ gehört zu den zentralen literarischen Dokumenten zur österreichischen Nachkriegsgeschichte und nicht nur dies: alles, was auf den 667 Seiten zu lesen ist, ließe sich auf manch andere post-genozidäre Gesellschaft beziehen. Nicht alles, was als „Transitional Justice“ verkauft ist, erfüllt diesen Anspruch. Aufarbeitung und Erinnerungskultur funktionieren auch als Entlastungsmaschine. Elfriede Jelinek ist eine der wenigen im besten Sinne surrealistisch denkenden und schreibenden Autor*innen deutscher Sprache und dies hat möglicherweise durchaus etwas damit zu tun, dass sie Österreicherin ist. Nur in Österreich gibt es Künstler*innen mit Pseudonymen wie Hermes Phettberg oder Stefanie Sargnagel, nur Österreich hat einen Josef Hader oder einen Robert Palfrader alias Kaiser Robert Heinrich I., sodass man vielleicht sogar vermuten dürfte, der Surrealismus wäre in Österreich oder zumindest für Österreich erfunden worden. Es hat durchaus seine Gründe, dass die Psychoanalyse in Wien entstand und dass Hannes Stein – obwohl kein Österreicher – seinen kontrafaktischen Roman „Der Komet“ (Berlin, Galiani, 2013) in Wien und auf dem Mond spielen lässt.
Surrealistische Stilmittel, surreale Bilder verändern die Wahrnehmung, aber vielleicht sind sie auch nicht mehr und nicht weniger als Zeichen einer anderen Wahrnehmung als der, in der wir im Allgemeinen gewohnt sind, die Wirklichkeit zu sehen. Sie provozieren geradezu einen unverstellten und unverstellbaren Blick auf die Welt wie sie ist. So verhält es sich meines Erachtens mit den Romanen und Dramen der Elfriede Jelinek. Der Roman „Die Kinder der Toten“ ist in einer onirischen Sprache geschrieben, mitunter an einen stream of consciousness erinnernd, die es oft schwer macht, den in hoher Geschwindigkeit und Intensität aufeinander folgenden Bildern, Metaphern, Sprachspielen und kryptischen Zitaten mit all ihren oft nur angedeuteten Bezügen zu Vergangenheit und Gegenwart zu folgen. In dem Roman haben wir neben der eigentlichen Handlung, sofern sie überhaupt Handlung genannt werden kann, und der Sprache, die oberflächlich gesehen die deutsche Sprache ist, einen stets präsenten Subtext, der alles Ungesagte, Unausgesprochene, Verdrängte, Ignorierte, Geleugnete an die Oberfläche spült, vor dem es manche Leser*innen grauen mag. Wer sich mit der österreichischen (und ich behaupte auch der deutschen) Vergangenheit befassen möchte, kommt nicht darum herum, diesen Roman zu lesen. Es ist letztlich der Roman zu dem, was wir im Allgemeinen „Erinnerungskultur“ nennen, aber letztlich eigentlich gar nicht erinnern wollen. Das Innere wird nach außen gekehrt.
Genau dies scheint das Ziel des Romans: Provokation von Assoziationen bei den Leser*innen, die verunsichern und erschrecken. Vielleicht auch Einsicht erzeugen? Der Roman hat jedoch keine pädagogische Agenda, er legt offen, er verwendet Elemente des Schauerromans, des Zombiegenres – denkbar wäre eine österreichische Version von „The Walking Dead“ –, pornographischer Literatur und der Psychoanalyse, kombiniert sie mit historischen und politischen Hintergründen, gibt in Rahmenhandlung und Ambiente österreichisches Lokalkolorit. Er demonstriert, was geradezu zwangsläufig in den Leser*innen geschieht, wenn sich jemand mit künstlerischen Mitteln mit der Shoah auseinandersetzt. Leser*innen werden zu Zeug*innen einer Zeit, die sie selbst nicht erlebten und von der sie eigentlich gar nichts wissen wollen. Die scheinbare Metapher des „Auseinandersetzens“ darf dabei durchaus wörtlich verstanden werden, Autorin, Erzähler*in, Leser*in, die Personen des Romans sitzen weit auseinander, werden aber immer wieder nebeneinander-, übereinander-, ineinandergeschoben, verwoben und gedrängt, bis fast so etwas geschehen könnte wie Selbsterkenntnis, aber auch nur fast.
Es ist schon ein wahnsinniges Unterfangen, die emotionale und intellektuelle Präsenz des Romans „Die Kinder der Toten“ in einer Dissertation einzufangen, vielleicht sogar zu mildern oder zumindest zu strukturieren. Jessica Ortner ist dies in ihrer Dissertation mit dem Titel „Poetologie ‚nach Auschwitz‘ – Narratologie, Semantik und sekundäre Zeugenschaft in Elfriede Jelineks Roman Die Kinder der Toten“ gelungen. Die Dissertation erschien in einer überarbeiteten Fassung im Jahr 2016 im Berliner Verlag Frank & Timme als vierter Band der von Helga Mitterbauer und Jacques Lajarrige herausgegebenen Reihe „Forum: Österreich“. Jessica Ortners auf den ersten Blick nüchtern anmutendes Ziel: „Es ist der Hauptfokus dieser Arbeit zu zeigen, wie Sinn und Referenz in der vertikal und räumlich ausgerichteten Bildersprache des Romans hergestellt werden.“
Blutig und blutleer zugleich – Der rote Faden der Geschichte
Jessica Ortner bezeichnet den Roman sehr treffend als „semantisches Mikro-Universum“. Ihre Methode ließe sich auf jedes einzelne Kapitel, fast auf jede einzelne Seite anwenden, umso verdienstvoller ist ihr Versuch, aus dem Roman eine Art roten Faden – bei dem Gegenstand müsste man von einem blutigen Faden sprechen, der aber gerade durch die Blutleere des Personals umso blutiger wird – herauszulesen. Sie erleichtert es den Leser*innen ihres Buches, einen eigenen Weg durch das scheinbare Gewirr des Romans zu bahnen. Der Roman hat einen durchaus linear lesbaren Plot, doch wird diese Linearität ständig in Frage gestellt, zerstört und oft erst offensichtlich, wenn man Hunderte von Seiten weitergelesen hat. Ebenso verhält es sich mit der Shoah: sie ist linear erzählbar, sie war geplant, wurde mit scheinbar rational verfassten Instrumenten, mit der rationalen Vernunft einer gnadenlosen Bürokratie vorangetrieben und umgesetzt. All dies lässt sich in den Monographien von Saul Friedländer oder Raul Hilberg nachlesen. Und doch fällt es selbst aufmerksamsten und bestinformierten Leser*innen mehr als schwer, die Shoah als kohärente Geschichte zu begreifen und dann auch noch zu erzählen.
Jessica Ortner schreibt: „Da dem Leser sowohl ein Verstehen der Shoah als auch der erzählten Geschichte verwehrt bleibt, kann die eingeschriebene Leserrolle zugleich als die eines Zeugen verstanden werden, der das Gelesene nicht zu einer kohärenten Geschichte ordnen kann und als die eines Zuhörers, der die ‚historische Wahrheit‘ nur durch einen kreativen Akt erkennen kann.“ Sie bemüht die von Gérard Genette (1930-2018) in seinen Büchern und Aufsätzen vorgestellte Figur des „impliziten Lesers“, der „erstens den desorientierten Blickwinkel des traumatisierten Opfers einnehmen muss, zweitens die Position des idealen Zuhörers, der die Unmöglichkeit zu verstehen bezeugt, und drittens in ein ‚Leser-Wir‘ inkludiert wird, das die Tätergeneration repräsentiert und von vornherein von Einsicht ausgeschlossen ist.“
Anders gesagt: es gibt keine pädagogische Lösung, keine pädagogisch aufarbeitbare Bewältigung der Shoah, es kann sie nicht geben. Die Shoah findet immer wieder ihren Weg in die tiefsten Ängste und Schrecken, die ein Mensch sich nur vorstellen mag. Gerade darin liegt ihre Einzigartigkeit, die immer wieder bestritten wird, um sich den Schrecken vom Leib zu halten. Die Shoah findet diesen Weg in die Gedächtnisse, Gefühle und Gedanken der Lebenden wie die wieder in Körper hineindrängenden namen- und körperlosen Gemordeten mit Hilfe der Körper der drei ebenfalls toten Protagonist*innen des Romans, Gudrun Bichler, Karin Frenzel und Edgar Gstranz ihren Weg in eine neue Körperlichkeit finden. Dies alles vollzieht sich in der fiktiven Pension Alpenrose. Österreichische Pensionen mit diesem Namen findet man über die Suchmaschinen des Internets zu Hauf. Die Pension Alpenrose des Romans spiegelt das Muster jeder österreichischen Heimatliebe und all der Bilder, in denen Österreich von Fremden, von Tourist*innen gesehen werden möchte, eine Fotoidylle in bezaubernder Berglandschaft. „Die Kinder der Toten“ schließt hier die Tradition der Dorfgeschichte mit ein.
Doch selbst aus der schönsten Idylle lässt sich der Schrecken der Shoah nicht heraushalten, auch wenn man es zunächst nicht merkt. Dem folgt die Erzählung, die nicht von vornherein alles Wissenswerte und Wissbare offenbart. Jessica Ortner notiert geradezu nüchtern, „dass die Handlungselemente im Roman nicht linear geordnet sind. Die Ereignisse stehen quasi außerhalb der Zeit und werden nach dem Prinzip der Nachträglichkeit mehrmals erzählt.“ Ihr Fazit: damit werde „das Trauma als strukturierendes Prinzip des Romans etabliert.“ Insofern erscheint es geradezu konsequent, dass der Roman mit dem Unfall zweier Busse auf einer unterspülten und teilweise abgebrochenen, sich somit verengenden Straße beginnt, auf der in einer Richtung nur der Absturz als Ausweg wirkt. Die Idylle der Bergwelt vergeht in Muren, Felsabbrüchen, Unwettern. Sie ist ständig bedroht, lebt mehr oder weniger nur in der Vorstellungswelt der touristischen Werbeprospekte und Heimatfilme.
Wo es eine Pension Alpenrose gibt, ist auch ein Marienwallfahrtsort, Maria Zell, nicht weit. Elfriede Jelinek konstrastiert die katholische Kirche mit der Synagoge: „Die Synagoge will nicht und nicht fürs Foto freundlich dreinschauen.“ Maria ist „die verkörperte Unschuldigkeit“, sie belegt den Ort, den die Österreicher*innen besuchen, „damit sie wieder einen guten Platz in der Geschichte bekommen können.“ Selbst die Fahrten „im Panoramabus nach Polen“ werden zum „Vergnügen“, „wenn wir, von breiten Ledergürteln zusammengehaltene Beschließer, die wir unsere Taten immer brav hinter uns abgeschlossen haben, mit dem Kameradschafts-Bund rasseln, weil wir wo hinein wollen – dieser Ausspruch entspricht mir ganz.“ Der österreichische Katholizismus siegt, Christus vincit, Wallfahrt und Gedenkstättenbesuch werden zu touristischen Konsumerlebnissen mit Erlösungsperspektive: „Der bischöfliche Segen wird den Kunden in den Rachen geworfen, damit sie sich weiterhin verschweigen und nicht verplappern, was sie in der Rüstung ihrer Ecclesia, die der fliehenden Synagoge auf ewig nachsetzt alles gedreht, genagelt, zerschnitten, geklebt und dann wieder weggeschmissen haben.“
Das Trauma der Überlebenden und das unterstellbare Trauma der Toten, wenn sie doch Überlebende wäre, was sie – wie der Roman zeigt – nur als Zombies, als Untote sein können, fügen sich zum kollektiven Trauma in einem „‚Geschichtsraum‘, in dem das historische Trauma der Shoah die österreichische Gesellschaft in Form von unzähligen Untoten nachträglich heimsucht.“ Jessica Ortner weist darauf hin, dass Elfriede Jelinek den Begriff „Geschichtsraum“ an einer Stelle verwendet, in der sich Karin Frenzel selbst beobachtet, nicht als Spiegelbild, sondern als geradezu reale zweite abgespaltene Karin Frenzel. Jessica Ortner kann sich mit ihrer Sichtweise auf mehrere Interpret*innen des Romans berufen, die den Roman als „postmodernen Geschichtsraum“ beziehungsweise als „unautorisierte Produktion von Geschichtsräumen (verstehen), die keine kohärente Darstellung der Geschichte liefern, sondern eine anachronistische Wiederholung des blutigen Verschwinden-Machens der Millionen von Menschen.“ Die Leser*innen finden sich – so widerspenstig sie sein mögen – in diesen „Geschichtsräumen“ wieder.
Dies betrifft nicht nur die Räume, auch die „Zeitlichkeit des Romans“, die – so Jessica Ortner – sich „als eine vertikale Stapelung mehrerer Bedeutungs- und Zeitebenen“ darstellt. „Wie ein Trauma, das niemals vergeht, durchkreuzen die Untoten Zeit und Raum und brechen unvermutet in die Gegenwart ein.“ Die Untoten sind nicht nur Gegenstand, Anlass der post-traumatischen Emotionen der zu sekundären Zeitzeug*innen mutierenden Leser*innen, sie sind das, was in erinnerungskulturellen Reden und auf Denkmälern als ständige Mahnung beschworen wird. Nur handelt es sich bei diesen Mahnungen nicht um etwas außerhalb der eigenen Psyche Liegendes, sondern um etwas in diese Eindringendes und in keiner Zukunft mehr Herausdiskutierbares, eine Art von Psycho-Forming, wie es sich meines Erachtens in dem programmatischen Titel eines Buches der deutschen Diplomatin Juliane Lepsius (*1924) wiederfindet, dessen Absicht für viele Berichte von Zeitzeug*innen stehen mag: „Es taucht in Träumen wieder auf“ (Düsseldorf, Droste, 1991). Aber es sind nicht nur die Träume! Die Shoah ist der rote, der blutige und gleichzeitig blutleere Faden, der den Plot des Romans definiert.
Sprache des „Absurden“
Jessica Ortner erschließt sich und uns, den zu Zeug*innen gemachten Leser*innen, den Roman in fünf Teilen und neun Kapiteln. Der Titel ihres Buches – „Poetologie ‚nach Auschwitz‘“ – zitiert Theodor W. Adornos oft unzulässig vereinfacht rezipiertes Diktum, dass nach Auschwitz kein Gedicht mehr geschrieben werden könne, das er im Übrigen später in „Negative Dialektik“ auch selbst relativierte. Wolfgang Hildesheimer (1916-1991) formulierte, sich beispielhaft auf Samuel Beckett (1906-1989) und Günter Eich (1907-1972) beziehend, die These, nur in Gedichten, in Textfragmenten, die er „absurde Prosa“ nennt, wäre es möglich, sich in der zerbrochenen und zerstörten Welt nach Auschwitz zu orientieren: „Die Welt schweigt, sie gibt keinen Urtext her. Pathetisch gesagt: der Sinn der Schöpfung enthüllt sich nicht, im Gegenteil: er wird immer rätselhafter, – wir können hinzufügen: seit Auschwitz. Hier denn ist der Ansatzpunkt der absurden Prosa: nicht das Auffinden des Urtextes sondern das Sich-Abfinden damit, dass er nicht gefunden wird; das Registrieren der Ersatzantworten, die Objektivierung des individuellen Ichs als Empfänger dieser antworten, die Möglichkeiten, sich in dem zur Verfügung gestellten Raum einzurichten, und nicht zuletzt: das niemals endende Erstaunen darüber, wie gut sich andere in diesem Raum eingerichtet haben. Der Schriftsteller, für den dies ein Thema ist, hat kein anderes. Es genügt auch.“ (in: Wolfgang Hildesheimer, Die Wirklichkeit des Absurden, in: Interpretationen James Joyce, Georg Büchner, Zwei Frankfurter Vorlesungen, Frankfurt am Main, edition suhrkamp, 1969)
Wolfgang Hildesheimer Begriff der „absurden Prosa“ ließe sich durchaus auf Elfriede Jelineks Prosa anwenden. Elfriede Jelinek setzt auf „Mehrdeutigkeit“, auf Ambivalenz und Vielfalt, „als strukturierendes Prinzip“. Dies geschehe – Jessica Ortner verweist auf Sigrid Löffler – über „eine Vielfalt von Intertexten“. Sigrid Löffler schrieb (zitiert nach Jessica Ortner), Elfriede Jelineks Texte seien „montiert aus Werbe- Zeitungs- und Bibelsprache, aus Trivial- und Hochliteratur (…). Sie überblendet und collagiert Zitate aus Medien, Religion, Technik, Politik und Philosophie; sie verwischt die Grenzen zwischen Sinn und Unsinn, sie karikiert und verzerrt Dichterstimmen, transformiert Zitate aus antiken Mythen oder aus der Psychoanalyse und versetzt sie mit Trash-Fernsehen und Soap-Operas.“ Solche „Intertexte“ findet Wolfgang Hildesheimer bei James Joyce in „Finnegans Wake“. Den Anfang des achten Kapitels, das mit dem Namen der Protagonistin Anna Livia Plurabelle zitiert wird, hat Wolfgang Hildesheimer übersetzt und kommentiert. Im Ergebnis stellt er fest: „Ein Mythos artikuliert sich selbst (…). Zum Schluss bleibt er als ein vergangenes, nicht mehr wegzudenkendes Erlebnis im Bewusstsein des Lesers oder Hörers, Traum und Alpdruck eines zyklischen Ablaufs, und bereit, sofort wieder von vorn zu beginnen.“ Der Inhalt finde sich nur in der Sprache, „außerhalb der Sprache ist hier kein Inhalt.“
Elfriede Jelinek geht viele Schritte weiter. Die Shoah ist der Inhalt von „Die Kinder der Toten“, in dem Roman sucht sich die Shoah über das Medium der Autorin beziehungsweise Erzählinstanzen – so absurd es klingen mag – ihre Sprache, die sie nie abschließend finden wird, aber in aller Vielfalt, in allen Ambivalenzen, dem Cross-Over der Laute und Wort- und Satzbestandteile Leser*innen und Hörer*innen verschreckend aufdrängt. Die Präsenz der Shoah lässt sich niemals leugnen und gerade eine Leugnung bezeugt – paradoxes Zeichen – ihre Präsenz. Das, was Hildesheimer das „Absurde“ genannt hätte und was ich in einer surrealistischen Tradition sehe, findet sich in der Vielfalt, den Ambivalenzen, der Mehrdeutigkeit jedes einzelnen Satzes. Jessica Ortner geht davon aus, „dass Jelinek Mythen nicht nur zerstört, sondern auch aktiv zur Konstruktion von Bedeutung einsetzt.“ Adornos Wort interpretiert sie wie folgt: „In dem oft zitierten Essay Adornos will dieser nicht grundsätzlich die Kunst nach Auschwitz verbieten, sondern die Trennung zwischen Kultur und Gesellschaft infrage stellen.“
Die Sprache des Romans ist die Sprache der Unbehausten, die die Toten der Shoah ja auch tatsächlich sind. Sie haben keine Gräber, es ist – so Paul Celan in der „Todesfuge“ – „ein Grab in den Wolken da liegt man nicht eng“. Jessica Ortner analysiert das „Raum-Zeit-Gefüge“ des Romans in Auseinandersetzung mit Martin Heideggers Rede von der Sprache als „Haus des Seins“. „Dieser unheimliche und unberechenbare Raum stellte eine Opposition zu Heideggers Vorstellung des ‚Wohnens‘ und des ‚In-der-Welt-Seins‘ dar.“ Sie zitiert Elfriede Jelinek: „Das Haus aus Sprache ist mir leider zusammengekracht.“ Eben dies ist auch der Hintergrund von Adornos Diktum zur Poesie nach Auschwitz. Es geht Jessica Ortner letztlich um die Frage, „wie in KdT (Jessica Ortner kürzt durchgehend den Romantitel ab, sodass er vielleicht sogar den Charakter einer Marke bekommt, NR) Sinn generiert wird.“ Sie setzt sich mit verschiedenen Autor*innen auseinander, die diese Frage unterschiedlich beantworten, weil es so gut wie unmöglich ist, die Shoah mittels „eines mimetischen Verfahrens“ zu erschließen. Der Sinn entsteht in den Leser*innen, an die schon hohe Anforderungen gestellt werden, wenn sie den Roman in die Hand nehmen und zu lesen beginnen: „Das gleichzeitige Erzählten verschiedener zeitlicher Ebenen und die daraus resultierende Mehrdeutigkeit sind zu einem Prinzip erhoben, das den zentralen Verweis auf die Shoah und die vergessene Schuld Österreichs im Intertext, Hypertext oder Subtext des Romans versteckt.“ Es entsteht in den Leser*innen so etwas wie die von Claude Lévi-Strauss (1908-2009) formulierte „Bricolage“.
Schornsteine, Asche
Literarische Texte über die Shoah werden gerne als hermetische Texte bezeichnet. Diese Zuschreibung betrifft auch Elfriede Jelineks „Kinder der Toten“. Allerdings beantwortet eine solche Zuschreibung nicht die Frage, ob das Hermetische dieser Texte, das erst einmal nur signalisiert, dass diejenigen, die den Begriff verwenden, vor dem Text kapitulieren, mit gewählten Worten sagen, dass sie nichts oder nur wenig verstanden hätten. Jana Hrdličková hat sich mit dieser Frage in ihrer Habilitationsschrift auseinandergesetzt, die im Jahr 2021 bei Frank & Timme mit dem Titel „Zweiter Weltkrieg und Shoah in der deutschsprachigen hermetischen Lyrik nach 1945 erschienen ist. Sie fragt, ob das, was als „hermetisch“ bezeichnet wird, eine bewusste verschlüsselnde Absicht, die sogar als „esoterisch“ eingeordnet werden könnte, signalisiert oder ob das „Hermetische“ erst in den Leser*innen entsteht, sozusagen ein „Rezeptionsbefund“ ist: „Die Unmöglichkeit, den Begriff der Hermetik kohärent zu definieren, korrespondiert hierbei mit der Eigenschaft der hermetischen Werke, nach dem Schock des Zweiten Weltkriegs und der Shoah keinen kohärenten Sinn mehr bieten zu können.“
Jana Hrdličková analysiert das „Hermetische“ in der Lyrik von Erich Arendt (1903-1984), Ingeborg Bachmann (1926-1973), Paul Celan (1920-1970), Ernst Meister (1911-1979) und Nelly Sachs (1891-1970). Im Zentrum ihrer Arbeit stehen fünf Interpretationen von Gedichtpaaren dieser Autor*innen, sie bietet eine Einführung in die Begrifflichkeit des „Hermetischen“, einen Forschungsbericht, Biogramme der fünf Autor*innen. Sie rahmt ihre Interpretationen mit einer Geschichte der hermetischen Lyrik in der deutschsprachigen Literatur der Nachkriegszeit bis in die 2000er Jahre. Sie zeigt, wie sich die die Shoah überlebenden Autor*innen Nelly Sachs und Paul Celan, auch Ingeborg Bachmann, die als Täter-Tochter keine Shoah-Überlebende im engeren Sinne ist, sich aufeinander beziehen. Sie zitiert kryptische Umschreibungen der Shoah bei Paul Celan – „das, was geschah“ – und Ingeborg Bachmann – „was auch geschieht“ – oder auch kryptische Zitate wie in dem Imperativ „zum Tod fall dir nichts ein“ bei Ingeborg Bachmann, die sich möglicherweise direkt auf Karl Kraus mit dessen Satz bezieht: „Zu Hitler fällt mir nichts ein“.
Hauptakteur der Gedichte, die Jana Hrdličková mit viel Empathie und Musikalität interpretiert, ist oft genug die Sprache, die auch unmittelbar angesprochen wird, beispielsweise bei Ingeborg Bachmann mit „Ihr Worte“. Nelly Sachs spricht in „O die Schornsteine“ ein Symbol der Shoah schlechthin an. Ohnehin finden sich in Texten zur Shoah immer wieder die mit dem Verbrennen der Leichen verbundenen Motive „Asche“ und „Schornsteine“, auch bei Elfriede Jelinek, die das „Wasser“, eines der zerstörerischen und zugleich wieder das Vergangene an den Tag bringenden Motive sprechen lässt: „Ich kann kiloweise Fleisch tragen, schwerelose zappelnde Pakete, das spüre ich gar nicht, meinem Kollegen, dem Schornstein geht es da ganz ähnlich. Der transportiert unglaubliche Menschenmassen, ohne dass er eigentlich was davon spürt, und die meisten von ihnen tragen noch die Stempel ihrer Eltern, das Zeichen der Mutter, das Gemächtnis des Vaters, egal, alle miteinander können mühelos den Zaun des Feuers einreißen und dann weitereilen, all die kraftlosen Häuschen hinter sich lassend, die einst ihre Körper waren. So gut wie kein Widerstand ist von denen zu erwarten, es lohnt sich nicht einmal, ihnen die Hosentür vor der Nase zuzusperren.“
Einen wichtigen Unterschied sollten wir nicht übersehen: Elfriede Jelinek wurde im Jahr 1946 geboren, sie gehört zur Nachkriegsgeneration, während alle Autor*innen, über die Jana Hrdličková schreibt, Krieg oder Shoah er- und überlebt haben. Hier liegt ein wesentlicher Punkt, die Retraumatisierung beim Sprechen über die Shoah: „Die Worte über die Shoah würden demnach, wenn sie versuchen würden, den jeweiligen verantwortlichen Täter / Mitläufer zu bezeichnen und zu richten, laut Celan nur ihre Opfer entblößen und treffen. Ihre Traumata würden sich somit perpetuieren (…).“ Je verschlossener, „hermetischer“ die Sprache erscheinen mag, umso klar wird die Einzigartigkeit der Shoah, die so oft und immer wieder von denen, die sie vergessen wollen, bestritten wird.
Jana Hrdličková benennt „die Schwierigkeit, dem Trauma des Krieges und der Shoah zu begegnen.“ Letztlich „geht es aber um eine auch pathetisch gefärbte Artikulation dieses menschheitlichen Traumas und um die Erfassung seiner Singularität.“ Das eigentliche Thema Elfriede Jelineks ist das Sprechen über die Shoah, die Frage nach einer Erzählung der Shoah, das in sich aber stets der Frage stellen muss, wie das, was die Leser*innen aufwecken und aufschrecken soll, auf diejenigen wirkt, die die Shoah erlebten. Das Thema des Suizids, des Aufenthalts in Kliniken prägt – dies beschreibt Jana Hrdličková ausführlich – das Leben der Überlebenden nach der Shoah. Möglicherweise dient die Verschlüsselung der Motive auch dem eigenen Schutz. Diese Hypothese formuliert Jana Hrdličková in ihrer Interpretation der Gedichte „Mein Vogel“ von Ingeborg Bachmann und „Der Albatros“ von Erich Arendt. Elfriede Jelinek schreibt aus der Distanz, als Tochter eines jüdischen Vaters, der die Shoah in einem als kriegswichtig erachteten Betrieb überlebte, aber dann in – wie man so sagt – geistiger Verwirrung starb.
Jana Hrdličková zitiert Reaktionen auf die Texte der von ihr besprochenen Autor*innen, beispielsweise auf Paul Celans Vortrag der „Todesfuge“ in der Gruppe 47, auf die Hans Egon Holthusen, ehemaliger SS- und NSDAP-Mann mit dem Vorwurf reagierte, der Autor habe wie Goebbels vorgetragen. Sie zitiert aber auch Walter A. Berendsohn (1884-1984), der – so schrieb es Nelly Sachs in einem Brief vom 18. Mai 1946 – die Sprache solcher Gedichte als die einzige Möglichkeit verstand, sich der Shoah sprachlich zu nähern: „Es mit realistischen Mitteln darzustellen ist wirkungslos, weil sich die erschrockene Seele wehrt, dies alles in sich aufzunehmen, und sich bald verschließt und verhärtet, um leben zu können.“ Andere rechneten die „Todesfuge“ und andere Gedichte Paul Celans zur „poésie pure“ und entkleideten sie somit jeden Bezugs zur Wirklichkeit, die Gedichte wurden mit der Zeit „lesebuchreif gedroschen“.
Tiefe, Gewalt
Jana Hrdličková verwendet den Begriff des „Hermetischen“ daher nur „mit Vorbehalt“: „Die Unmöglichkeit, den Begriff der Hermetik kohärent zu definieren, korrespondiert hierbei mit der Eigenschaft der hermetischen Werke, nach dem Schock des Zweiten Weltkriegs und der Shoah keinen kohärenten Sinn mehr bieten zu können.“ Mit Umberto Eco (1932-2016) spricht sie von einem „offenen Kunstwerk“. Möglicherweise ist die Debatte um die „Hermetik“, die Widerspenstigkeit literarischer Texte zur Shoah nicht mehr und nicht weniger als eine Debatte darüber, ob man überhaupt über die Shoah schreiben könne.
Jana Hrdličková sieht in den von ihr vorgestellten lyrischen Texten sogar einen „Modernisierungsschub“. Das mag auf das erste Lesen fortschrittsgläubig und entlastend klingen und der Literatur eine Entwicklung zuzuschieben, wie sie in Wirtschafts- und Wissenschaftsprozessen angestrebt wird. So hätten das auch manche Politiker*innen sicherlich gerne. Nichts falscher als das: „Die Vehemenz, Komplexität und Widersprüchlichkeit der zeitgeschichtlichen und zeitgenössischen Vorgänge, auf die es adäquat zu antworten galt, weil man an sie nicht zuletzt durch private Traumata gekettet war, zerschlugen die tradierte Form wie die tradierten Normen auch bei den anderen hier untersuchten Autor*innen und riefen verfremdende, modernistisch und avantgardistisch inspirierte, häufig surrealistisch anmutende Techniken auf den Plan, die das Verständnis bei einem traditionell erzogenen Publikum manchmal schwierig, manchmal unmöglich machen.“ Die Shoah lässt sich nicht auf allgemeine Betrachtungen über den Tod an sich reduzieren, es gibt keine Philosophie oder gar Ethik der Shoah. Ähnliche Gedanken formuliert Jessica Ortner: Elfriede Jelineks „Die Kinder der Toten“ „erwarten einen Leser, der die komplexe Erzählform als Anspielung auf Österreichs Vergangenheit versteht.“
Jessica Ortner bezieht sich auf Algirdas Julien Greimas (1917-1992) und seinen Begriff der „Isotopie“. Im Grunde geht es um die Verbindung zwischen Zeichen, Worten, Sätzen, Textpassagen, die Greimas – so Jessica Ortner – in ihrer Gesamtheit mit „einem Kreuzworträtsel“ vergleicht, allerdings mit dem Unterschied, dass es keine eindeutige und abschließende Lösung gibt, die sich dann in der nächsten Ausgabe der Zeitung überprüfen ließe. Insofern müsse man von „Polyisotopizität“ sprechen, um die „Tiefenstruktur“ eines Textes zu erfassen, sofern sich diese überhaupt erfassen lässt. Diese „Tiefenstruktur“ ist in sich ambivalent, hat in sich viele verschiedene Abzweigungen, Sackgassen, Umleitungen, denn ihr Inhalt ist eben nicht nur die Shoah wie sie war, sondern auch die Art und Weise – eigentlich müsste man im Plural schreiben: Arten und Weisen –, in der die Shoah nach 1945 erzählt und ihrer gedacht wird. „Auf einer das Romangeschehen selbst überschreitenden Ebene verweist das irreale, phantastische Bild der ‚Toten‘ sowohl auf die Shoah-Opfer als auch darauf, dass diese aus dem öffentlichen Diskurs und Bewusstsein Österreichs ausgeschlossen sind. Das Phantasma dient dazu, die geheuchelte Unschuld der Mitläufergeneration, die von nichts gewusst haben will und angibt, die Deportierten vor ihrem Verschwinden nicht gekannt zu haben, zu parodieren. Dieser Logik folgend wird die Wiederkehr der Toten als Einbruch eines Unbekannten dargestellt.“
Um diesem „Unbekannten“ auf die Spur zu kommen, bedürfen wir der „Narratologie“, der „Semantik“ und der „Bildfeldanalyse“. Dies sind die drei Begriffe, die Jessica als Überschriften des Mittelteils ihres Buches verwendet. Diese drei Begriffe sind der Urgrund literaturwissenschaftlichen Arbeitens, der historisch-politische Schlüsse ermöglicht und illustriert, wie sie im fünften Teil mit dem Begriff „der sekundären Zeugenschaft“ und in den „Schlussbetrachtungen“ formuliert werden: „An die Stelle eines Schreibens, das die Illusion des impliziten Erzählers mit autonomem Bewusstsein und allwissender Perspektive schafft, tritt eine impotente Erzählinstanz, die im eigenen Sprechen den fehlenden Diskurs marginalisierter Gesellschaftsgruppen aufzeigen will. Jelineks umfassende Gesellschaftskritik in KdT und in ihrem Werk überhaupt wird erst im Licht ihrer Ausweitung des Faschismusbegriffs voll verständlich. Dieser umfasst mehrere Aspekte, die in ihrem ungewöhnlichen Shoah-Roman entfaltet werden. Einer dieser Aspekte ist das fortgesetzte Vergessen der Opfer, das schon in der Art ihrer Vernichtung vorprogrammiert wurde. Jelinek richtet den Fokus nicht allein auf den massenhaften biologischen Tod der Opfer des nationalsozialistischen Regimes, sondern auch auf den symbolischen Tod (…).“
Ich zitiere diesen Teil der „Schlussbetrachtungen“ Jessica Ortners auch, um die Diskrepanz zwischen wissenschaftlicher und poetischer Sprache zu illustrieren. Dies ist keine Kritik an der Sprache Jessica Ortners, im Gegenteil, es ist geradezu zwingend, sich den Roman mit wissenschaftlicher Nüchternheit zu erschließen, um sich überhaupt wieder auf den surrealen Originaltext einlassen zu können. Ideal wäre eine parallele Lektüre beider Bücher, des Romans und der Dissertation, stets wissend um die traumatisierte Sprache eines Paul Celan oder einer Nelly Sachs, auch einer Ingeborg Bachmann. Dann lässt sich mit der Zeit schon erahnen, was „Poetologie nach Auschwitz“ bedeuten mag und dass möglicherweise der künstlerische, poetische Versuch, sich dem Schrecken der Shoah zu nähern, unabdingbar ist, nicht weil auf diese Weise alles klar würde, sondern weil auf diese Weise alles bisher Verdrängte offen zu Tage gebracht wird.
Die Offenbarung des Ineinanders der verschiedenen Wirklichkeiten des Romans, der Shoah und ihrer Leugnung oder Verharmlosung in der österreichischen Alltagspraxis spiegelt sich in den Bildern, beispielsweise in der Parallelisierung von „Wassermassen und Menschenmassen“, dem Erdrutsch als „Aufstand der Natur“, dem im Zombie-Motiv inhärenten Kannibalismus-Motiv. Die Natur wird „zur Bühne einer Massenhysterie“. Als Beispiel wählt Jessica Ortner „die buchstäbliche Darstellung eines Freiluftkonzerts, das von einem starken Regen überrascht wird, mit der Bedeutung eines ungehemmten Gewaltakts. (…) Indem das musikalische Großereignis eines Freiluftkonzerts implizit mit den nationalsozialistischen Großversammlungen gleichgesetzt wird, verweist der ‚Massenniederschlag‘ sowohl auf einen Wolkenbruch als auch auf die Begeisterung der Menge und die antisemitischen Ausschreitungen und Pogrome, wie sie beispielsweise in der Reichspogromnacht 1938 stattfanden. Das ‚Wasser der Massen‘ nimmt an einem Gewaltakt teil, in dem auch die metaphorische Verwendung des Worts ‚spitze‘ sylleptisch angewandt wird. Als lexikalisierte Metapher sagt das Wort ‚spitze‘ aus, dass etwas umwerfend gut ist. Hier wird diese lexikalisierte Trope auf das ursprüngliche Substantiv ‚Spitze‘ zurückgeführt, das im Duden als ein ‚spitzes, scharfes Ende von etwas‘ wie beispielsweise einer Lanze definiert wird. Auch der Neologismus ‚Spitzenniederschlag‘ ist somit Ausdruck eines faschistischen Gewaltakts.“
Nichts ist hermetisch
Ingeborg Bachmann, die die Zeit der Shoah überlebt hat, aber – wie schon gesagt – keine Überlebende im engeren Sinne ist, hat sich immer wieder die Frage gestellt, was Literatur angesichts des Grauens überhaupt leisten könne, nicht nur in Bezug auf Paul Celan, dessen Gedicht „Todesfuge“ sie in ihrer ersten Frankfurter Vorlesung mit dem Titel „Fragen und Scheinfragen“ eine „Grabschrift“ nennt, eine Bezeichnung, die auch Paul Celan verwendete. Jana Hrdličková zitiert ihn mit der Bezeichnung seiner Gedichte als „Grabmal“, „Grabschrift“ oder „Grab“.
Ingeborg Bachmann entdeckt die nicht mehr verdrängbare, ständig präsente Wirklichkeit in den Gedichten eines anderen Autors, der kein Überlebender der Shoah, wohl aber wie sie ein Überlebender dieser Zeit ist, bei dem fast 20 Jahre älteren Günter Eich: „Die Gedichte, so verschiedenartig, sind nicht genießbar, aber erkenntnishaltig, als müssten sie ein einer Zeit äußerster Sprachnot aus äußerster Kontaktlosigkeit etwas leisten, um die Not abzutragen.“ Treffend trägt der letzte Gedichtband Paul Celans, mit dem Ingeborg Bachmann die Vorlesung „Fragen und Scheinfragen“ beschließt, den Titel „Sprachgitter“. Ingeborg Bachmann: „Die Metaphern sind verschwunden, die Worte haben jede Verkleidung, Verhüllung abgelegt, kein Wort liegt mehr einem anderen zu, berauscht ein anderes. Nach einer schmerzlichen Wendung, einer äußerst harten Überprüfung der Bezüge von Wort und Welt, kommt es zu neuen Definitionen.“ Vielleicht suggerieren Gedichte in ihrer komprimierten Gestalt die Möglichkeit solch „neuer Definitionen“, doch werden diese unmittelbar nach der Lektüre wieder in Frage gestellt oder provozieren neue immer mehr Tiefe verlangende Fragen, die dann in der Summe, die natürlich immer mehr ist als die Summe ihrer Teile, sich in einem Roman wie „Die Kinder der Toten“ materialisieren.
Die Intensität der Bilder lässt sich möglicherweise mit dem Begriff der „absoluten Metapher“ erfassen, den Jessica Ortner Hugo Friedrich entlehnt. Sie findet vergleichbare Formen bei Paul Celan, nicht zuletzt in der „Todesfuge“. Dieses Gedicht wurde Generationen von Schüler*innen im Deutschunterricht vorgelegt, Generationen von Schüler*innen wurde zugemutet, die Metaphorik des von den Lehrer*innen als hermetisch gelesenen Textes zu entschlüsseln, aber gerade in diesem Auftrag lag der Versuch, die Shoah zu dematerialisieren, es wurde – so Jana Hrdličková „lesebuchreif gedroschen“. Indem die Bilder des Gedichtes zu Metaphern erklärt wurden, verschwand der Sinn des Gedichtes. Es gibt in der „Todesfuge“ kein einziges Wort, kein einziges Bild, das nicht die Wirklichkeit des Vernichtungslagers spiegelt. Die „schwarze Milch der Frühe“, das „aschene Haar“, das „Grab in den Wolken“, der „Meister aus Deutschland“ – sie haben alle ihren realen Grund. In der zwei Mal wiederholten Aufforderung „spielt auf nun zum Tanz“ werden die Orchester der Konzentrations- und Vernichtungslager wieder lebendig. In Auschwitz gab es sechs Lagerorchester, eines davon war das Frauenorchester, das verniedlichend immer wieder als Mädchenorchester bezeichnet wird. Jessica Ortner verweist auf die Rede Paul Celans zur Verleihung des Büchner-Preises („Der Meridian – Rede anlässlich der Verleihung des Georg-Büchner-Preises“, 1960): „Er distanzierte sich von der Auffassung der Metapher als einer Substitution ‚von Schon-Gegenwärtigem mit Schon-Gegenwärtigem‘ und definierte das Gedicht als den Ort, in dem ‚alle Tropen und Metaphern ad absurdum geführt werden wollen‘, womit der abbildliche Diskurs verlassen werde.“
Die Unzulänglichkeit metaphorischen Sprechens lässt sich auf jeden Versuch beziehen, die Shoah zu erzählen. Ob Literatur „Sekundäre Zeugenschaft“ – so überschreibt Jessica Ortner den fünften Teil des Buches – begründen könne, bleibt offen: „Jelineks Weigerung, eine lineare, widerspruchsfreie Erzählung der Shoah zu schaffen, kann als ein metasprachlicher Verweis auf die Schwierigkeit der Zeugenaussage verstanden werden.“ Dies betrifft alle Berichte von Überlebenden der Shoah, für die bei aller Authentizität dieselben Vorbehalte gelten mögen wie für jede andere Aussage von Zeug*innen vor Gericht, nur mit dem Unterschied, dass hier in dem Sprechakt der Bewertung des Wahrheitsgehalts dieser Zeitzeugenaussage wiederum eine eigene Zeugenaussage liegt, die des zweiten, diesmal „symbolischen Tods“. Karin Frenzel stirbt mehrere Tode, als Zeugin ihrer selbst und als Zeugin der in die Welt hineindrängenden Toten der Shoah: „In Karins scheiterndem Versuch, auf die Toten aufmerksam zu machen, wird indessen eine Impotenz zu sprechen inszeniert, die dem Schweigen der Toten einen Platz einzuräumen versucht.“
Die Schwierigkeit, über die Shoah zu sprechen, als Überlebende*r, als Leser*in, als Hörer*in, als Historiker*in und letztlich als Literat*in, wird z einem zentralen Thema des Romans, in allen Varianten der Deformation der historischen Wahrheit. Möglicherweise kommen literarische Versuche, sich der unfassbaren Wirklichkeit der Shoah zu nähern, der historischen Wahrheit relativ nahe. Dies mag für Paul Celans „Todesfuge“ gelten, für Elfriede Jelineks „Die Kinder der Toten“ und sicherlich – vielleicht ist die Graphic Novel die dritte geeignete Gattung – für Art Spiegelmans „Maus“.
Wenn jedoch selbst die Literatur schweigt, wird geschehen, was Michel Foucault (1926-1984) am Schluss seines Buches „Les mots et les choses“ prophezeit (1966 bei Gallimard erschienen, deutsch: „Die Ordnung der Dinge“, Übersetzung von Ulrich Köppen, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1971): „Wenn diese Dispositionen (des Wissens, NR) verschwänden, so wie sie erschienen sind, wenn durch irgendein Ereignis, dessen Möglichkeit wir höchstens vorausahnen können, aber dessen Form oder Verheißung wir im Augenblick noch nicht kennen, diese Dispositionen ins Wanken gerieten, wie an der Grenze des achtzehnten Jahrhunderts die Grundlage des klassischen Denkens es tat, dann kann man sehr wohl wetten, dass der Mensch verschwindet wie am Meeresufer ein Gesicht im Sand.“
Norbert Reichel, Bonn
(Anmerkung: Erstveröffentlichung im Dezember 2022. Das Titelbild zeigt einen Ausschnitt von Yvan Goll, Fruit from Saturn © Bürgerstiftung für verfolgte Künste – Else-Lasker-Schüler-Zentrum – Kunstsammlung Gerhard Schneider. Zum selben Thema siehe auch vom Juni 2025 den Text über zwei Bücher von Norbert Gutenberg im Verlag Frank & Timme zur Todesfuge und zu den Gedichten von Selma Meerbaum-Eisinger: „Vermächtnisse der Bukowina“. Internetlink zum Verlag Frank & Timme aktualisiert am 7. Juli 2025.)