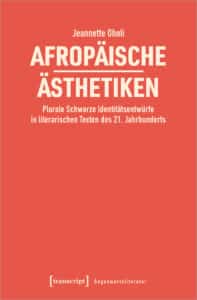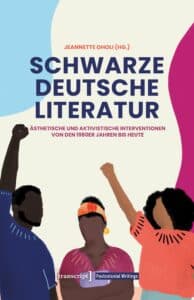Für eine „Germanistik der radikalen Vielfalt“
Jeannette Oholi über die Potenziale afropäischer und afrodeutscher Literatur
„Wir neigen zu der Auffassung, daß eine strenge Arbeitsteilung zwischennationaler, Vergleichender und Allgemeiner Literaturwissenschaft weder durchführbar noch wünschenswert ist. Wer sich mit der nationalen Literaturwissenschaft beschäftigt, sollte sich klarmachen, daß er verpflichtet ist, seinen Gesichtskreis zu erweitern, und hin und wieder Abstecher in andere Literaturen oder der Literatur verwandte Gebiete zu unternehmen. Der Komparatist hingen sollte von Zeit zu Zeit in den enger begrenzten Bereich einer Nationalliteratur zurückkehren, um wenigstens mit einem Fuß auf festem Boden zu bleiben.“ (Henry H. H. Remak, Definition und Funktion der Vergleichenden Literaturwissenschaft, 1961, zitiert nach: Horst Rüdiger, Hg., Komparatistik – Aufgaben und Methoden, Stuttgart / Berlin / Köln / Mainz, Kohlhammer, 1973)
Der Literaturwissenschaftler Henry H. H. Remak schrieb diesen Text vor etwa 65 Jahren in einer Zeit, in der man sich noch auf sicherem Boden zu befinden glaubte, wenn man von „Nationalliteratur“ oder gelegentlich auch von „Weltliteratur“ sprach. Aber so wie sich das Verständnis von „Nationen“ wandelte, hätte sich auch der Begriff von „Nationalliteratur“ wandeln müssen und damit auch der Begriff der „Welt“. Der Begriff der „Nation“ hätte ohnehin als Begriff des 19. Jahrhunderts in einer wissenschaftlichen Untersuchung nur noch einen Platz als deren Gegenstand, nicht jedoch als deren Voraussetzung einnehmen dürfen.
Wenn jemand den Versuch wagen wollte, den Begriff der „Nationalliteratur“ zu definieren, wäre es vielleicht hilfreich, sich auf die Sprache zu konzentrieren, in der die jeweilige Literatur geschrieben wurde und wird. Der Begriff der „Nation“ löst sich dann sehr schnell auf, denn diejenigen, die heute Literatur in deutscher, englischer, französischer oder welcher Sprache auch immer schreiben, können auf zahlreiche Quellen, Traditionen und Identitäten zurückgreifen, die in den 1960er Jahren in Europa kaum bekannt waren. Unter den belletristischen Neuerscheinungen der vergangenen 30 bis 40 Jahre in Deutschland finden sich Autor:innen mit den unterschiedlichsten Familiengeschichten, über die sich eine Reise durch alle Länder und Kontinente gestalten ließe. Doch nehmen Literaturwissenschaften und schulische Lehrpläne dies auch wahr? Vielleicht lohnt es sich, dieser Frage anhand des Beispiels der afrodeutschen oder afropäischen Literatur nachzugehen. Ich darf versprechen, dass sich in der Auflösung der Begriffe des „Nationalen“ und – daraus folgend – des „Internationalen“ neue Perspektiven und Welten erschließen lassen, aber auch, dass die Grenzen zwischen literaturwissenschaftlichem und aktivistischem Engagement zerfließen werden.
Grundlagen afropäischer Literatur(wissenschaften)
Jeannette Oholi hat sich in zwei bei transcript in Bielefeld erschienenen Büchern mit dem Stellenwert und der Rolle afrodeutscher, afropäischer oder Schwarzer Literatur – diese drei Bezeichnungen finden sich in Wissenschaft und Publizistik – in Deutschland und in Europa exemplarisch auseinandergesetzt. Im Jahr 2024 erschien ihre Gießener Dissertation „Afropäische Ästhetiken – Plurale Schwarze Identitätsentwürfe in literarischen Texten des 21. Jahrhunderts, im Jahr 2025 folgte der Sammelband „Schwarze deutsche Literatur – ästhetische und aktivistische Interventionen von den 1980er Jahren bis heute“. Vereinfacht ließe sich sagen: Dem Theorieband folgte ein Band über die Praxis. Beide Bände jedoch zeichnen sich durch fundierte Analyse anregender literarischer Texte aus und bieten so ganz nebenbei einen anregenden Überblick über afrodeutsche beziehungsweise afropäische Literatur. Wer diese Literatur entdecken möchte, wird hier genügend Lesetipps finden.
Die reale Grundlage der beiden Bücher bietet der Reisebericht „Afropean – Notes from Black Europe“ von Johny Pitts (Allan Lane, 2019). Johny Pitts kommt zu dem Schluss: „Africa was right where I was standing. (…) These scattered fragments of Afropean experience had formed a mosaic inside my mind, not monolithic, but not entirely amorphous either; rather, the Afropean reality was a bricolage of blackness and I’d experienced an Africa that was both in and of Europe.” Wer sich mit afropäischer Literatur befasst, klärt somit auch und vielleicht sogar in erster Linie den eigenen Standpunkt, postkoloniale und intersektionelle Aspekte ebenso inbegriffen wie Rassismus- und Exklusionserfahrungen. Afrika ist eben mehr als ein geographischer Begriff, Afrika wird zu einer Einstellung, zu einer Art Status.
Vielleicht passt es in diesem Kontext, dass im Spätsommer 2025 eine Debatte entstand, dass die gängige die wahren Größenverhältnisse verzerrende Mercator-Darstellung der Welt durch eine realistische Darstellung abgelöst werden sollte (eine sehr anschaulichen Überblick boten Otto Wöhrbach und Natalie Ille im Tagesspiegel: „Die älteste Desinformationskampagne der Welt“). Im Mercator-Schnitt sind Afrika und Grönland gleich groß (möglicherweise motivierte dies Trump, sich für Grönland zu interessieren). Tatsächlich passen jedoch China, Indien, die USA, Japan, die Europäische Union und letztlich die Schweiz in Afrika hinein. Großbritannien ist etwa so groß wie Madagaskar, Russland etwa so groß wie Sahara und Sahel. Die Frage, zu der die von Jeannette Oholi vorgestellten Autor:innen Antworten suchen, lautet mehr oder weniger, wie viel Afrika in den europäischen Literaturen zu finden ist und wie sich Afrikanisches und Europäisches durch diese Begegnung verändern. Eine damit verbundene Frage lautet, wie sehr der Schwarze Feminismus der 1980er Jahre zur Emanzipation eines Schwarzen deutschen beziehungsweise europäischen Bewusstseins beigetragen hat, das sich auch die afrodeutsche Literatur durchdringt. All dies ist Gegenstand der beiden Bücher von Jeannette Oholi: Wie groß ist Afrika in der deutschen (französischen, englischen, europäischen) Literatur?
Auf dem Weg zu einer „Germanistik der radikalen Vielfalt“
Jeannette Oholi plädiert in ihrer Dissertation für eine „Germanistik der radikalen Vielfalt“: „Die Germanistik der radikalen Vielfalt initiiert einen Perspektivwechsel, da sie Pluralität in den Mittelpunkt rückt und diese – genauso wie Migration – normalisiert.“ Dieser Ansatz ist zwangsläufig komparatistisch, geht aber weit über traditionelle komparatistische Arbeiten hinaus, weil er sich eben nicht auf das Verhältnis zwischen verschiedenen europäischen Literaturen beschränkt. Ihre Ergebnisse ließen sich auf andere Literaturen übertragen. Daher gibt es in der Dissertation auch Kapitel zu britischen und französischen Texten. In beiden Bänden spielen US-amerikanische Autor:innen eine wichtige Rolle. Anstelle der Germanistik ließe sich somit auch jede beliebige andere Literaturwissenschaft nennen. Die von Jeannette Oholi angewandte Methode ließe sich wiederum auf andere mit einem Bindestrich bezeichnete Literaturen übertragen, zum Beispiel auf jüdische Autor:innen, die in deutscher (oder französischer oder englischer) Sprache schreiben und veröffentlichen. All diesen Autor:innen gemeinsam ist ein Habitus des „Widerstands“. Literatur und Literaturwissenschaft sind zugleich politische Statements und wirken als politischer Aktivismus. Diese Begriffe muss man wörtlich nehmen! „Die Germanistik der radikalen Vielfalt ist eine widerständige Analyseperspektive (…).“ Sie befreit afrikanische Quellen, Traditionen, Motive aus der „Ghettoisierung in einem besonderen Afrikaprogramm“, die der Romanist János Riesz, Mitbegründer der interdisziplinären Afrikanologie an der Universität Bayreuth, im Jahr 1980 angesichts der Präsentation des Schwerpunkts Afrika auf der Frankfurter Buchmesse beklagte (zitiert nach Paweł Zajas, Sozialistische Transnationalisierung, Wiesbaden, Harassowitz, 2025).
Ihre These entwickelt Jeannette Oholi zunächst in einem Methodenkapitel („Plurale Schwarze Identitäten in einem weiß imaginierten Europa: Eine postmigrantische Annäherung“). In drei weiteren Kapiteln stellt sie zehn Autor:innen detailliert vor. Diese drei Kapitel tragen die programmatischen Überschriften „Bewegungen“, „Verbindungen“ und „Uneindeutigkeiten“. Ein fünftes Kapitel mit dem Titel „Fazit und Ausblick“ schließt den Kreis. Analysiert werden Texte von Chantal-Fleur Sandjon, Helen Oyeyemi und Yrsa Daley-Ward im Kapitel „Bewegungen“, Texte von Philipp Khabo Koepsell, Sharon Dodua Otoo, Bernardine Evaristo und Kiyémis (die einzige französischsprachige Autorin im Buch) im Kapitel „Verbindungen“, Olivia Wenzel, Stefanie Lahya Aukongo und Lemn Sissay im Kapitel „Uneindeutigkeiten“.
Schwarze, afropäische oder afrodeutsche Literatur ist keine weitere Spielart von „Nationalliteratur“. Sie lässt sich auch nicht nicht als eigene literarische Gattung abgrenzen. Sie ist kein monolithischer Block. Jeannette Oholi wendet sich gemeinsam mit den von ihr vorgestellten Autor:innen gegen dieses in den Köpfen vieler Literaturwissenschaftler:innen und Lehrkräfte vorherrschende Bild. Ihr Gegenprogramm geht von dem Begriff des „Queering“ aus, wie ihn Fatima El-Tayeb verwendet. So „werden alternative Narrative von ‚Europäischsein‘ sichtbar, die das plurale Europa widerspiegeln.“ Sie beruft sich ferner auf Max Czollek und seinen Begriff der „Desintegration“ (in: „Desintegriert euch!“ München, Hanser, 2018), den sie als „widerständige Haltung gegen die weiße Dominanzgesellschaft“ versteht.
Der bestimmte Artikel in „die weiße Dominanzgesellschaft“ verweist auf eine Praxis der bewussten oder gegebenenfalls auch unbewussten Exklusion oder vielleicht besser gesagt der Ignoranz eines in den letzten vier Jahrzehnten immer bedeutender werdenden Teils deutscher Literatur. In Deutschland gibt es – dies wird durchgehend in beiden Büchern von Jeannette Oholi thematisiert – keine eigenen Lehrstühle für „Black Studies“. „Black Studies“ wären allerdings ungeachtet der Verdienste von János Riesz und Kolleg:innen etwas anderes als die Afrikanistik, zu der an der Universität Bayreuth gelehrt und geforscht wird. Es geht um Literatur von Schwarzen Autor:innen oder Autor:innen of Color in deutscher Sprache, es geht um die afrodeutsche beziehungsweise afropäische Perspektive mit all ihren Erfahrungen. Mitunter fühlt man sich an das Schicksal der Diplomarbeit von May Ayim erinnert, die an einer Universität abgelehnt wurde, weil es doch in Deutschland gar keinen Rassismus gäbe. Die Arbeit wurde später an einer anderen Universität angenommen und in dem von May Ayim, Katharina Oguntoye und Dagmar Schultz herausgegebenen Band „Farbe bekennen – Afro-deutsche Frauen auf den Spuren ihrer Geschichte“ (Berlin, Orlanda Frauenbuchverlag, 1986, Neuauflage im Jahr 2020 bei Orlanda).
Es wäre sicherlich von Interesse, einmal Lehrpläne, Schullektüren und Abituraufgaben im Fach Deutsch zu analysieren. Dort dürfte es noch viel problematischer aussehen als in der Germanistik. In dem Aufsatz „Von Bewegungen, Entgrenzungen und Gleichzeitigkeiten: Schwarze deutsche Literatur als polyphone Tradition lesen“ (in: Genealogy+Critique 10/1, 2024) verweist Jeannette Oholi auf außeruniversitäre und „nicht-staatliche Archive und Bibliotheken wie die Vera Heyer Bibliothek als Teil von Each One Teach One (EOTO e.V.) in Berlin, die Theodor Wonja Michael Bibliothek in Köln, die Fasiathek in Hamburg sowie die kürzlich gegründete Schwarze Kinderbibliothek in Bremen“, alle Fundgruben afrodeutscher, afroeuroopäischer beziehungsweise Schwarzer Literatur, die in Schulen und Hochschulen noch zu entdecken wäre (Internetlinks eingefügt von NR).
Gestaltungsprinzip Polyphonie
Wodurch zeichnet sich eine multiperspektivische afrodeutsche oder afropäische Literatur aus? Ein Schlüsselbegriff ist „Polyphonie“, die Jeannette Oholi in ihrer Dissertation als „ästhetisches Gestaltungsprinzip“ der Vielfalt definiert. Diese „Polyphonie“ bezieht sich nicht nur auf den Stellenwert afrodeutscher Literatur als Teil der deutschen Literatur als Gesamtheit, sondern auch ihre verschiedenen Erscheinungsformen. Afrodeutsche, afropäische Literatur ist weder nach außen noch nach innen ein monolithischer Block. Es gibt eben nicht nur die „Single Story“, die Chimamanda Ngozi Adichie in „The Danger of a Single Story“ dekonstruierte.
Jeannette Oholi konkretisiert diese These in dem eben schon genannten Aufsatz „Bewegungen, Entgrenzungen und Gleichzeitigkeiten“: „Die Polyphonie spiegelt Bewegungen wider und hat Entgrenzungen zur Folge, da durch sie die Pluralität Schwarzer deutscher Literaturen sichtbar wird. Sie steht quer zur verengten und begrenzten Rezeption Schwarzer Autor*innen und macht stattdessen ein vielschichtiges Netz von Stimmen sichtbar, die Räume innerhalb des literarischen Feldes schaffen oder (neu) besetzen.“ „Afropolitanismus“ und „Eurozentrismus“ werden dann zu Kampfbegriffen. Erst die Überwindung des „Eurozentrismus“ schaffe eine „globale Perspektive“:
Gesellschaftlich und politisch formuliert verweist dies – so Jeannette Oholi – auf den von dem Arabisten und Islamwissenschaftler Thomas Bauer eingeführten Begriff der „Ambiguitätstoleranz“ (programmatisch zum Beispiel in „Die Vereindeutigung der Welt – Über den Verlust an Mehrdeutigkeit und Vielfalt“, Stuttgart, Reclam, 2018). „Die Gegenwartsliteratur Schwarzer Autor*innen wird so zu einem Ort, an dem Erinnerungen vielstimmig verhandelt und neugeschrieben werden.“ „Pluralität“ ist keine „Bindestrichidentität“. Eine pluralistische Ästhetik manifestiert sich in den Stilmitteln: „Die Pluralität zeigt sich nicht nur inhaltlich, beispielsweise in der Figurenkonstellation oder darin, was die Stimmen in den Gedichten thematisieren, sondern auch in der Ästhetik, denn die Ästhetik der literarischen Texte zeichnen sich ebenfalls durch Bewegungen, Verbindungen und Uneindeutigkeiten aus, wenn Autor*innen beispielsweise mit Textgattungen experimentieren und neue literarische Formen entstehen.“ Stilmittel sind beispielsweise dialogisches oder fragmentarisches Erzählen, freie Rhythmen, Wegfall von Satzzeichen, Aufspaltung von Sätzen in eine Reihe von Wörtern, die jeweils eine eigene Zeile beanspruchen.
Sprache fließt, ihre „Fluidität“ schafft eine diachrone Ebene, die die synchrone Wahrnehmung durchdringt. Sie schafft ein Gefühl für die Veränderlichkeit der Erzählung und des Erzählten, weil es immer „eine Vielzahl von Möglichkeiten“ gibt und eben nicht darauf ankommt, eine bestimmte Möglichkeit ein für alle Mal auszuwählen, sondern Vielfalt, „Pluralität“, anzuerkennen. Die jeweiligen Stilmittel müssen natürlich nicht neu erfunden werden, denn es gibt sie ohnehin schon in experimenteller Literatur, zum Beispiel in Konkreter Poesie oder auch in nicht linear erzählten Romanen, ungeachtet der Familiengeschichte und Lebenswelten der Autor:innen. Das Besondere in der afrodeutschen beziehungsweise afropäischen Literatur ist jedoch ihre Ausweitung: Materielle Wirklichkeiten, Landschaften, Gegenstände reflektieren und dekonstruieren Identitäten zugleich.
Jede Erzählung, jeder potenzielle Gegenstand einer Erzählung, jede erzählte Person verlangt, dass sie in der Lektüre weitererzählt, kreativ gebrochen wird, weil das Erzählte immer nur als „Fragment“ erzählt werden kann. Bezogen auf das Monodrama „Something Dark“ von Lemn Sissay schreibt Jeannette Oholi: „Das fragmentarische Erzählen unterstreicht die Pluralität der Identität des Erzählers.“ Individualität und Pluralität sind eben untrennbar miteinander verbunden, sodass die Frage nach einer festgefügten „Identität“ sich letztlich erübrigen sollte. Was ist „europäisch“, was ist „deutsch“, was „französisch“, was „afrikanisch“? In diesen Überlegungen erhält der im Alltagssprachgebrauch auf geschlechtliche Vielfalt angewandte Begriff des „Queering“ eine neue Bedeutung. „Dieses Queering hat zur Folge, dass sich Schwarze Figuren und Stimmen in den literarischen Texten als Subjekte in ihrer Pluralität erzählen.“
Jeannette Oholi verknüpft in diesem Sinne die folgenden Begriffe miteinander: „postmigrantisch“, „subversiv“, „emanzipatorisch“. Sie wendet den von Shermin Langhoff in die Debatte eingeführten Begriff des „Postmigrantischen“ in der Literaturwissenschaft an: „Das Postmigrantische als kritische Perspektive zu nutzen, bedeutet, Rassifizierung und Marginalisierung von Schwarzen Menschen in Europa als Realität sichtbar zu machen und diese zugleich in einen größeren Kontext intersektionaler Herrschafts- und Rassismuskritik zu stellen.“ Eine solche Literaturwissenschaft ist im besten Sinne parteilich, nicht im marxistischen Sinne des Wortes, wohl aber im Sinne jeder auf Anerkennung von Vielfalt ausgerichteten Verfasstheit einer Gesellschaft. In diesem Kontext entsteht „Afropea“ als „ein Raum, der durch das Streben Schwarzer Europäer*innen und die Entfaltung ihrer pluralen Identitäten entsteht.“
„Heimat“ ist dann – beispielsweise bei Chantal-Fleur Sandjon – „nicht an einen geografischen Ort gebunden“, auch die Textgattungen verfließen ineinander, wie beispielweise bei Yrsa Daley-Ward, Lemn Sissay oder Aukongo. Lyrisches und Erzählerisches vermischen sich, auch mit ungewöhnlichen Schreibweisen (bei Aukongo zum Beispiel Unterstriche, Großbuchstaben mitten in einem Wort, freie Rhythmen) durchdringen einander, lassen neue Perspektiven entstehen. Sharon Dodua Otoo macht in „Adas Raum“ die Verbindungen zwischen den Schicksalen und Erlebnissen von vier Personen mit dem Namen Ada in verschiedenen Zeiten erfahrbar: „Alle vier Ada-Figuren sind transtemporal und transnational miteinander verbunden, da ihre Erfahrungen und Geschichten miteinander resonieren.“
Ein denkbares Gegenbild zur „Heimat“ wäre eine Variante des Exils, das Leben in einer Art Diaspora. Auf der einen Seite steht – so interpretiert Jeannette Oholi Kiyémi – „die durch die Assimilation entstandene gesellschaftliche Enge“, auf der anderen Seite entsteht ein neu zu entdeckender Reichtum: „Die afrodiasporische Frau besteht in ihrem Innersten somit aus einer Vielzahl von Verbindungen, die sich aus Wegen, Erzählungen und Bewegungen zusammensetzen.“ Literatur wird zum Medium eines neuen Selbstbewusstseins, von Selbstwirksamkeit: „Die Stimme schafft somit neue Räume, in denen sie sich in ihrer Pluralität entfalten kann.“ In diesem Kontext fügen sich bei Oliva Wenzel in „1.000 Serpentinen Angst“ Reisen, Bahnhöfe, Snackautomaten, Sprach- und Perspektivwechsel zu Metaphern einer „Vielzahl von Möglichkeiten“. Allerdings gehe es nicht darum, eine dieser Möglichkeiten auszuwählen und damit andere auszuschließen, sondern die Pluralität in sich aufzunehmen und sich in ihr zu bewegen. Literatur wird zur „Selbstbefreiung“, zum Handeln in einem selbst gestalteten „Empowermentprozess“. Aber natürlich bleibt es immer prekär, nie abgeschlossen, exemplarisch formuliert in Versen von Aukongo: „Mein Gender balanciert auf dem seidenen Faden (…) / Irgendwo dazwischen (…) / als mehrfachverwobene, geschlungene / radikale Femme of Color“ (im Original kursiv). Intersektionalität ist somit nichts anderes als die in sich und dem eigenen Schreiben erfahrene Polyphonie.
„Kunst als Mittel zum Überleben“
Der von Jeannette Oholi herausgegebene Sammelband „Schwarze Deutsche Literatur“ darf als multiperspektivische Fortsetzung der in ihrer Dissertation entfalteten Thesen gelesen werden. Die Grenzen zwischen literaturwissenschaftlichem und aktivistisch-politischem Engagement zerfließen, „Polyphonie“ spiegelt sich literarisch wie politisch in 15 Beiträgen von 19 Autor:innen, allerdings durchaus mit einem gemeinsamen Ziel, der Anerkennung afrodeutscher und afropäischer Biografien und Lebenswelten sowie ihrer Literatur. Jeannette Oholi widmet den Band Philipp Khabo Koepsell, „Poet, Aktivist, Archivar und Wegbereiter in der Erforschung Schwarzer deutscher Literatur“ und benennt damit ihren eigenen Anspruch: Wissenschaft, Aktivismus, Popularisierung durchdringen einander. Laura Högner zitiert in ihrem Beitrag über „Kritische Darstellung weißer Männlichkeiten und des white gaze in Sharon Dodua Otoos Adas Raum“ ebenfalls Philipp Khabo Koepsell mit der entspannten und entspannenden Bemerkung: „wir können deutsch sein – aber wir müssen es nicht“.
Der Band gliedert sich in vier Abschnitte: „Aktivismus und Literatur(wissenschaft)“, „Erinnerung und Wissensproduktion“, „Ästhetiken und Literaturtraditionen“ sowie „Entgrenzungen und Genres“. Eine zentrale Rolle spielen immer wieder die 1980er Jahre und die inspirierende Rolle von Audre Lorde und May Ayim. Es geht allerdings nicht nur um afrodeutsche Autor:innen, so bietet Yeliz Çetin unter der Überschrift „Poetische Widerstände“ einen Vergleich der Lyrik von May Ayim und Hatice Açikgöz, eingeleitet – wie könnte es anders sein – mit drei Sätzen aus dem Grußwort von Audre Lorde zu „Farbe bekennen“: „Wir wollen wir selbst sein, so wie wir uns definieren. Wir sind kein Fragment eurer Fantasie oder eurer Wünsche. Wir sind nicht das Salz eurer Sehnsucht.“ Yeliz Çetin, selbst auch als Literatin unterwegs, wendet sich damit gegen die vielen verschiedenen Projektionen, die Autor:innen auf ihrem literarischen Weg behindern: „Schreiben ist Sprache und bedeutet eine Ausdrucksmöglichkeit, in einem sicheren Rahmen Worte zu finden und für sich zu sprechen, wo sonst keine Räume existieren und die eigene Stimme nicht gehört wird.“
In der Einleitung formuliert Jeannette Oholi zwei Punkte, die aus meiner Sicht zeigen, dass sich diese Einsicht und Programmatik nicht von selbst ergibt, nicht einmal für diejenigen, die als „Afropeans“ oder „Afrodeutsche“ ein biographisches Interesse haben. Im ersten Satz schreibt sie: „Ich musste über 5000 Kilometer reisen um von Farbe bekennen zu erfahren.“ Dies mag durchaus an den Curricula deutscher Universitäten liegen. In Dakar im Senegal fragte sie eine Nachbarin nach dem Buch. Aus der folgenden Lektüre dieses Buches entfaltet sie den eigentlichen Auftrag, dem sich die Autor:innen von „Schwarze deutsche Literatur“ verpflichtet sehen, auch wenn es ungeheuer schwer zu sein scheint, ihre Perspektiven, die in ihrer Forschung zentralen Werke in der gängigen Germanistik zu platzieren. „Erschwert wird dieser Kampf auch durch die postulierte Trennung von Aktivismus und Wissenschaft, die nach wie vor wirkungsmächtig ist und reale Auswirkungen auf die Erforschung deutscher Literatur hat.“ Schwarze Literatur wird somit zu einer „Bewegungsgeschichte“.
Was als „afrodeutsche Frauenbewegung“ begann, wurde auch zu einer literarischen Bewegung mit Wirkungen nicht nur auf afrodeutsche Autor:innen. Dazu Laurel Chougourou in ihrem Beitrag über „May Ayim und Audre Lorde – Transgenerationale Erinnerungsarbeit als Form afrodeutschen feministischen Widerstands“: „Die afrodeutsche Frauenbewegung hat es geschafft, nationale Diskurse zu hinterfragen und zu prägen und historische Ereignisse, wie die der Kolonialzeit, in den dominanten Wissenskanon einzustreuen. Sie hat maßgeblich einen sozialen Wandel herbeigeführt.“
Dieses Ziel sollte jedoch nicht mit Eskapismus verwechselt werden, es geht um Empowerment, um die Erfahrung von Selbstwirksamkeit: „An May Ayims grenzenlose Lyrik anknüpfend, auf sie aufbauend und sie ergänzend schreiben bis heute Schwarze Menschen und People of Color lyrische Texte, um sich selbst und gegenseitig zu empowern.“ Es geht letztlich um die Dekonstruktion von „Machtstrukturen“. Hatice Açikgöz folgt dem von May Ayim vorgelebten Weg. Yeliz Çetin zitiert sie aus dem Vorwort von „fancy immigrantin“ (2023 bei w_orten&meer erschienen): „dieses buch ist offiziell politisch (…) schreibe in deine rezension, das frau açikgöz‘ buch autobiografisch ist und sie ohne ihre mehrfache marginalisierung keinen dieser texte hätte schreiben können.“ Es ließe sich von einer Bestandsaufnahme sprechen, in der „kulturelle vielfalt“ zwar immer wieder in Sonntagsreden beschworen werden mag, jedoch zurzeit nicht mehr ist als „eine fata morgana / im land der diversität“. Sharon Dodua Otoo sagt im Gespräch mit Selma Rezgui und Laura Marie Sturtz, es sei „kaum möglich, nicht politisch zu schreiben“. Der Titel dieses Gesprächs ist Programm: „Aktivistisch Lesen und Schreiben“.
Literatur(wissenschaft) ist und bleibt politisch
Doch wie ließe sich Schwarze deutsche Literatur popularisieren? Claudia Sackel bezieht sich auf Gedichte von May Ayim und Stefanie-Lahya Aukongo. Auch sie sieht wie Jeannette Oholi in ihrer Dissertation in Schwarzer beziehungsweise afrodeutscher Literatur „ein polyphones Netz_Werk, das sich durch das Oszillieren verschiedener Stimmen und Temporalitäten konstituiert“. Identität gibt es ebenso nur im Plural wie Politik und Poetik, in der ständigen und gegenseitigen, im Grunde dialektischen Durchdringung. „Ich habe vorgeschlagen, Schwarze deutsche Literatur als transgressive Netz_Werke zu lesen, die offen und dialogisch organisiert sind und vielschichtige Poetiken und Politiken der Relationalität, Transmedialität und Translingualität zu entwerfen.“
Es ließe sich hinzufügen: und zu lesen! Eine Aufforderung an Produzent:innen wie Rezipient:innen von Literatur und letztlich auch eine Aufforderung an Literaturwissenschaft zum Dialog mit Literatur, der nicht distanziert gepflegt werden sollte, sondern partizipativ, als Teil der Bewegung. Letztlich ist dies eine hermeneutische Grundweisheit, denn Literatur lässt sich nur so lesen, betrachten, analysieren, indem die Lesenden, Betrachtenden, Analysierenden in sie eintauchen. Thanapon Danpakdee tut dies am Beispiel von Olivia Wenzels Roman „1000 Serpentinen Angst“. Er „betrachtet die Produktion eines alternativen Wissens als Interventions- und Widerstandsstrategie des Romans.“ Deborah Fallis befasst sich mit der Spiegelung rechter Gewalt in Schwarzer deutscher Lyrik: „Zwischen Klage und Widerstand“: „Betrachtet man die Schwarze Literaturtradition in Deutschland, finden sich zahlreiche Texte, die sich mit dem Erleben und Überleben rassistischer Gewalt auseinandersetzen, viele davon Gedichte. Die Form des Gedichts erlaubt in besonderem Maße sprachliche Verdichtung, zu der Mehrdeutigkeit und Ambivalenzen gehören, aber auch komplexe, da räumlich begrenzte, Konzeption von Perspektivität.“ Sie zitiert Sharon Dodua Otto, die dieselbe Botschaft als politische Aufforderung formuliert: „Für uns als Schwarze Künstler_innen wird die künstlerische Produktion (…) eine Strategie, eine Praxis des Widerstands, eine Praxis dessen, was bell hooks ‚talking back‘ genannt hat. (…) Wir nutzen Kunst als Mittel zum Überleben.“
bell hooks ist auch Gewährsautor:in im Beitrag von Laura Högner, die sich ausgehend unter anderem von Toni Morrison und Frantz Fanon mit den „Schwierigkeiten der Subjektkonstitution für Schwarze Menschen in einer weiß dominierten Gesellschaft“ befasst. „bell hooks konfrontiert den white gaze mit dem oppositional gaze“, der „als Instrument des Widerstands gegen intersektionale Diskriminierung“ zu verstehen sei. Damit nähert sich W.E.B. Du Bois an, der 1903 die These vom „double consciousness“ formulierte, oder auch „Judith Butlers Ansatz des gefährdeten Lebens (2010)“ und der von Kimberley Crenshaw 1991 postulierten Trias von „race, gender und class“. Laura Högner bietet geradezu einen geistesgeschichtlichen tour d‘horizon zur Genese der von W.E.B. Du Bois bis heute reichenden Entwicklungen, die sich nicht zuletzt dadurch auszeichnen, das sich etwa seit den 1980er Jahren immer mehr Frauen an der Debatte beteiligten und damit den Blick für die intersektionellen Verschränkungen von Machtverhältnissen öffneten. Letztlich geht es um eine Auflösung der Machtverhältnisse, die sich jedoch zunächst als Umkehrung fassen lässt. „Fanon entlarvt also die weiße Dominanzgesellschaft als das tatsächliche Andere und kehrt damit die vorherrschende Wahrnehmungskonvention um.“ Etwa zwei Jahrzehnte später wurde daraus eine feministische Debatte, die Fanon wahrscheinlich noch nicht einkalkuliert hatte.
Schwarze deutsche beziehungsweise Schwarze europäische Literatur weitet den Blick. Sigrid G. Köhler bringt dies in ihrem Beitrag über „Untergründe, Zeitgeflechte und der Einsatz des Erzählens“ auf den Punkt: „Sie erzählen deutsche Geschichte nicht als nationale, europäische oder westliche Geschichte, sondern als Teil einer transatlantischen Kulturgeschichte, für die nicht zuletzt Kolonialismus, Rassismus und Versklavung konstitutiv waren und immer noch sind.“ Timothy Brown spricht am Beispiel des Romans „Biskaya“ von SchwarzRund eine „Ästhetik der Wideraneignung“. Erinnerungskulturen, Herkünfte, Genealogien, mehr oder weniger diasporische Identitäten (auch all diese nur im Plural zu erfassen) sind Teil der „Idee von fluiden Identitäten“. Queerness ist nicht nur ein möglicher Inhalt, sondern die Methode, mit der sich diese sich stets verändernde Vielfalt erfassen lässt. Eine solche Literatur ist auf keinen Fall der traditionelle „Opferporn“, „immer etwas über den Kampf und das Leid Schwarzer Menschen in einer weißen Gesellschaft“, den unbedarfte Leser:innen von Schwarzer Literatur „erwarten“ – so Patricia Eckermann, Autorin von „Elektro Krause“ (Köln, eckermann, 2021), im Gespräch über Schwarze Deutsche Phantastik, an dem sich auch Sarah Fortuun Heinze und James A. Sullivan beteiligen.
Jeannette Oholi und die von ihr zu Rate gezogenen Autor:innen argumentieren literarisch und politisch zugleich. Literarisches Schaffen wird zum Instrument von „Aktivismus“ und ist zugleich so viel mehr. In ihrer Dissertation schreibt Jeannette Oholi über Aukongo einen grundlegenden Satz, der auch auf alle anderen von ihr vorgestellten Autor:innen passt: „In Aukongos Gedichten lässt sich eine Verschränkung von Aktivismus, Widerstand, Ästhetik und Identitätsbildung beobachten (…)“ So kann es gelingen, „die eigene Existenz als gelebte Realität in die Gegenwart einzuschreiben“ und die gängigen Erwartungshaltungen zu durchbrechen.
Das, was in den Literaturwissenschaften geschehen sollte, unterscheidet sich von den grundlegenden politischen Debatten nicht. Hier lohnt sich ein Blick in das neue Buch von Minna Salami: „Can Feminism be African? A Most Paradoxical Question“ (London, Harper Collins, 2025). In der ZEIT vom 8. Mai 2025 fasste Minna Salami die Ergebnisse ihres neuen Buches in einem beeindruckenden Essay zusammen, durchaus in der Tradition von Kimberley Crenshaw, bell hooks oder Audre Lorde.
Minna Salami wendet sich gegen die in der medialen Berichterstattung gängigen Stereotypsierungen: „Afrikanischer Feminismus wird oft auf Leiden reduziert – Krieg, Hunger, schlechte Infrastruktur.“ Aber das ließe sich ändern, durch Sprache oder eben durch Literatur: „Die Verhärtung der Wahrnehmung durch Sprache aufzulösen, heißt, den Boden für eine andere Weise des Sehens zu bereiten – und dadurch für eine andere Weise der Koexistenz. Im Zentrum dieser Erkundung liegen die Spannungen zwischen afrikanischer Identität und feministischem Sein. Sie sind nicht nur politischer oder kultureller Art; sie sind ontologisch. Sie betreffen nicht weniger als das Recht, das Afrikanischsein als Frauen, als Feministinnen, als vollwertige Wesen zu definieren und zu leben. Dieses Recht hat immer gefehlt.“
Es waren vor allem Männer, die bestimmten, was Afrika sei. Es waren vor allem weiße Frauen, die definierten, was Feminismus sei. So wie Männer oder weiße Frauen ihre jeweiligen Perspektiven absolut setzten, so neigen auch deutsche und europäische Literaturwissenschaftler:innen und Literaturjournalist:innen dazu, ihre traditionelle deutsche (oder europäische) Sicht auf jede beliebige Literatur anzuwenden und sich nach wie vor in dem überholten Bild eines Nebeneinander verschiedener „Nationalliteraturen“ zu ergehen.
Minna Salami geht es um feministische Perspektiven in und zu Afrika, Jeannette Oholi um die Potenziale afrodeutscher und afropäischer Literatur und Literaturwissenschaften für Empowerment und Selbstwirksamkeit in Europa. Beides ist meines Erachtens untrennbar miteinander verbunden und dürfte sich gegenseitig bereichern. Literatur ist immer vielstimmig und voller unterschiedlicher Perspektiven. Sie erschließt sich aus der Sprache, den Lebenswelten und Umwelten der Autor:innen, ihren Erfahrungen, Erinnerungen und Visionen. Die Perspektive der Literaturwissenschaften der Zukunft ist die von Jeannette Oholi vertretene „Germanistik der radikalen Vielfalt“! Das ist letztlich ein kohärentes und höchst anspruchsvolles literaturwissenschaftliches Programm, gerade auch für die Komparatistik. In diesem Programm haben Begriffe wie „Nationalliteratur“ oder „Weltliteratur“ keinen Platz mehr, denn jede Literatur schafft „Welt“ und „Welten“.
Norbert Reichel, Bonn
(Anmerkungen: Erstveröffentlichung im November 2025, Internetzugriffe zuletzt am 2. November 2025. Titelbild: Beate Blatz.)