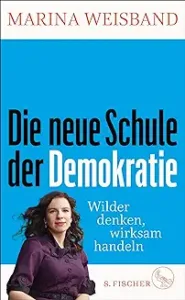Radikal, demokratisch, pädagogisch
Die Psychologin Marina Weisband über Zuversicht und Resilienz
„Der Mensch kann entweder bloß dressirt, abgerichtet, mechanisch unterwiesen oder wirklich aufgeklärt werden. Man dressirt Hunde, Pferde, und man kann auch Menschen dressiren. (…) Mit dem Dressiren aber ist es noch nicht ausgerichtet, sondern es kommt vorzüglich darauf an, daß Kinder denken lernen.“ (Immanuel Kant, Über Pädagogik, 1803)
Im Frühjahr 2024 veröffentlichte Marina Weisband ihr neues Buch „Die neue Schule der Demokratie – Wilder denken, wirksam handeln“. Thema ist das von ihr geleitete aula-Projekt. „Selbstwirksamkeit und Eigenerfahrung“ sind die Grundlagen. Aber nicht nur dies: das Projekt vermittelt Einsichten in die Debatten um die Verknüpfung repräsentativer, deliberativer und direkter Formen der Demokratie. Vor allem – so die Botschaft – sollten wir niemals die Hoffnung aufgeben, eine bessere Welt zu schaffen. Dies ist das Geheimnis der Zuversicht. Das Buch präsentiert – wie alle Bücher von Marina Weisband – komplexe und komplizierte Sachverhalte auch für Lai:innen verständlich, von denen sich manche aufgrund der konkreten Fallbeispiele sicherlich angeregt fühlen dürften, die Botschaften des aula-Projektes für eigenes demokratisches Engagement zu nutzen. Schwer ist das nicht, man muss es sich nur zutrauen!
Wildes Denken ist radikales Denken
Norbert Reichel: Mit Ihrem neuen Buch können wir gut an die Inhalte unseres vorangegangenen Gesprächs anknüpfen, das den etwas provokativen Titel trägt: „Eine Machtfrage“. Sie zeigen, dass wir Menschen, auch Kinder, viel mehr Macht hätten, unsere Welt zu gestalten, wenn wir es uns nur zutrauten. Der Untertitel Ihres neuen Buches weist den Weg: „Wilder denken, wirksam handeln“. „Lebe wild und gefährlich“ – das war das Motto einer Plakat- und Postkartenaktion zu Beginn der 1980er Jahre. Von wem der Satz wirklich stammt, ist reichlich umstritten, aber das macht den Satz nicht weniger attraktiv. Was hat es mit dieser „Wildheit“ auf sich?
Marina Weisband: Wildes Denken ist die Voraussetzung für wirksames Handeln. Gefahr ist immer eine Folge von Risiko. Risiko ist immer ein Fortschritt. Wenn wir wirksam handeln wollen, müssen wir uns die Frage stellen, was wäre, wenn es uns wirklich darauf ankäme, die Welt so zu gestalten wie wir sie wollen. Dazu müssen wir erst einmal auch wissen, wie wollen wir denn die Welt? Wie könnte die Welt denn sein? Das ist eine Fähigkeit, die viele von uns nicht üben. Das ist wie ein Muskel, der trainiert werden muss. Die Kunst, die Welt nicht nur zu sehen, wie sie ist, sondern auch wie sie sein könnte.
Das wird uns an Schule aktiv abtrainiert, weil wir hauptsächlich Erwartungen zu erfüllen haben und nichts an unserem Umfeld verändern können. Wir gehen dann ins weitere Leben ohne diese Fähigkeit. Aber wir brauchen Kreativität, das Querfeldeindenken, wenn wir die wirklichen Probleme unserer Zeit lösen wollen, die unvergleichlich komplexer sind als die eingefahrenen Bahnen, die wir bisher gewohnt sind.
Norbert Reichel: Sie sagen, „wildes Denken“ werde uns an Schulen abtrainiert, wie sieht es an Hochschulen aus?
Marina Weisband: Das gilt überall. Schulen sind extrem bürokratisierte Systeme, aber auch an den Hochschulen erleben wir eine zunehmende Verschulung der Lehre. Wir arbeiten für Credits, wir arbeiten für den Abschluss, wir wollen einen Beruf, schlimmstenfalls (sie lacht) wollen wir in die Wissenschaft gehen. Es gibt viele Erwartungen, die wir zu erfüllen haben.
Wild zu denken bedeutet in gewissem Sinne radikal zu sein. Das ist ein Privileg, das Studenten früher stärker hatten, aber sie hatten nur selten die Freiheit, aus ihren wilden tanzenden Ideen nach und nach echte Vorschläge zu bauen, die die Gesellschaft verändern.
Norbert Reichel: Sie verbinden den Begriff der Wildheit mit dem der Radikalität. Radikalität kann aber auch den Blick verengen, sodass jemand nur seine eigene Sicht der Dinge gelten lässt. Sie fordern aber, dass man die Sicht der anderen respektiert.
Marina Weisband: Auch darin liegt eine gewisse Radikalität. Ich muss sagen, ich bin in den letzten Jahren sehr radikal geworden, im Wortursprung: „an die Wurzel gehen“. Ich stelle mir die Frage, was wäre, wenn es mir wirklich darauf ankäme, dieses Ziel zu erreichen. Wenn es mir wirklich darauf ankommt, aus meiner Schule eine bessere Schule zu machen, habe ich bestimmte Vorstellungen, wie das aussehen sollte? Ich bin verantwortlich für mich und für meine Mitmenschen. Deshalb gilt, dass ich meine Vorstellungen mit denen meiner Mitmenschen abgleiche. Ich schreibe in dem Buch sehr viel über den Prozess des Abwägens, des Streitens, des Argumentierens, des Bedürfnisse Formulierens.
Ein Beispiel: Ich möchte den Klimawandel, die Klimakatastrophe aufhalten, das ist ein radikales Bedürfnis. Ich möchte an die Wurzel dieses Problems gehen, ich möchte mich fragen, was wäre, wenn es mir wirklich darauf ankommt. Das ist mein Ziel. Ich werde bestimmte Mittel im Kopf haben, die ich mir gut und cool vorstelle, die aber für andere Menschen lebensbedrohlich sein könnten oder die sie sich nicht leisten können.
Da kommt das zweite Element ins Spiel: das Zuhören, das Offensein, die Welt mit offenen Augen sehen, meine Mitmenschen wirklich hören. Das kann ich, wenn ich mir selbst meiner Sache sicher bin. Man denkt immer, je sicherer ich mir bin, desto weniger höre ich anderen zu. Die Wahrheit ist, am wenigsten hören sehr unsichere Menschen zu, denn unsichere Menschen haben Angst, dass eine neue Ansicht ihr Weltbild zerstören könnte. Je gefestigter mein Weltbild ist, desto offener bin ich, anderen wirklich zuzuhören, weil ich mir über meine Ziele sehr im Klaren bin.
Norbert Reichel: Wer unsicher ist, vereinfacht, reduziert Komplexität. Sie fordern ein Bekenntnis zur Komplexität der Welt.
Marina Weisband: Ich hätte das Buch auch nennen können: „Überleben in einer komplexen Welt“. Es ist nun einmal so. Die Welt ist komplex und wir stehen vor einer Entscheidung, die vielleicht auch keine ist. Komplexe Dinge lassen sich nicht mit einer Bevölkerung lösen, die Angst hat vor Komplexität. Wir müssen lernen, sie zu ertragen, damit zu leben, und wir müssen lernen, danach zu handeln.
Das ist der zweite Teil des Untertitels meines Buches: „Wirksam handeln“. Diesen Begriff habe ich bei Hannah Arendt entliehen. Ich möchte, dass Menschen nicht einfach nur verwalten, nicht einfach nur den nächsten Tag bestreiten, sondern sich die wilde Idee setzen, ich möchte es anders machen und ich möchte es auch umsetzen. Das Handeln in einer komplexen Welt ist möglich. Es erfordert Kommunikation und die Zusammenarbeit von Vielen. Das ist das Schöne an Demokratie. Kaum ein anderes System ist in Wirklichkeit so geeignet, mit Komplexität umzugehen, weil das Entscheidungsorgan so komplex und vielfältig ist.
Norbert Reichel: Manche verstehen Demokratie aber so, dass es ausreichen müsse, mit 50,01 Prozent eine Mehrheit zu haben und dann macht man eben das, was man möchte. Manche behaupten sogar, sie verträten die Mehrheit, obwohl sie diese 50,01 Prozent nie erreichen, sie nennen das dann „Wille des Volkes“ oder so ähnlich.
Marina Weisband: Es ist vielleicht eine Verfehlung in unserer Demokratie, über sich selbst zu bilden. Für mich ist der Kern der Demokratie nicht „Wählen“. Er ist auch nicht „Toleranz“. Das sind alles wichtige Dinge in einer Demokratie, aber das ist nicht der Kern. Der Kern ist für mich das Selbstverständnis, ich bin für mich und für meine Mitmenschen verantwortlich. Ich bin nicht Opfer meiner Gesellschaft, nicht Besucher meiner Gesellschaft, ich bin nicht Konsument, sondern ich bin Gestalter. Dieses Selbstverständlich versuche ich meinen Schüler:innen beizubringen. Damit gehe ich aber auch vor Erwachsenen hausieren. Es ist nie zu spät, das eigene Selbstverständnis zu verändern.
Norbert Reichel: Deshalb rede ich gerne von „liberaler Demokratie“. In dem Wort „liberal“ steckt der Respekt vor den anderen oder anders gesagt: meine Freiheit hat ihre Grenzen an der Freiheit der anderen.
Marina Weisband: Das folgt daraus. Wenn ich meine Mitmenschen als gemeinsame Gestalter sehe, dann folgt daraus automatisch die Toleranz, folgt automatisch die Fähigkeit anzuerkennen, dass jemand Anderes vielleicht eine gute Idee hat, dafür eine Mehrheit schaffen kann, Kraft guter Argumente, Kraft von Überzeugung, gemeinsamer Überlegungen und Anstrengungen.
Kunden und Manager
Norbert Reichel: In Ihrem Buch kritisieren Sie, dass Menschen sich viel zu oft mit der Rolle der Konsumenten begnügen. Sie fordern: „Aus Konsumenten Gestalter machen“.
Marina Weisband: Es ist nicht mein Menschenbild, dass Menschen zum Konsumieren neigen. Es ist das, wozu wir erzogen werden. Wir werden dazu erzogen von der Werbung. In Zeitschriften, im Internet werde ich als Konsumentin angesprochen, meine Tochter wird auf ihrem Tablet als Konsumentin angesprochen. Wenn ich in die Innenstadt gehe, kann ich praktisch nichts tun außer zu konsumieren. Wenn ich im öffentlichen Raum verweilen möchte, muss ich konsumieren. Mir wird subtil ein Lebensbild, das Lebensziel angetragen, dass ich arbeiten muss, um Geld zu verdienen, um zu konsumieren. Das ist offenbar mein Lebenszweck.
Auch grundlegende Werte werden in Deutschland mit Konsumgütern gleichgesetzt. Das sage ich als jemand, der nach Deutschland emigriert ist und daher Vergleichsmöglichkeiten hat. „Freiheit“ wird in Deutschland oft mit dem Begriff „Auto“ verknüpft, oder „Erholung“ eng mit „Flugurlaub“. Oder „Erwachsene“ werden mit der eigenen „Schrankwand“ „erwachsen“. (Beide lachen). Das ist so eine Sache aus den 1980er und 1990er Jahren. Das hat mit dem „Wirtschaftswunder“ zu tun, als alles immer „wuchs“. So wurde das „Konsumieren“ zu einem kulturellen Ziel stilisiert. Wir dürfen uns auch keine Illusionen machen. Unser gesamtes Wirtschaftssystem ist abhängig davon, dass wir konsumieren. Das heißt, wir fangen dann auch an so zu handeln.
Ich beziehe mich dabei auf das Buch von Hedwig Richter und Bernd Ulrich „Demokratie und Revolution“ (Köln, Kiepenheuer & Witsch, 2024). Es ist vor allem diese Politische Kommunikation, das Sich-nicht-trauen, Leuten etwas zuzumuten, weil Wähler anfangen, sich zu verhalten wie Kunden, und Politiker anfangen, sich zu verhalten wie Manager. Dann sind wir nicht mehr im Politiker-Wähler-Dialog, in dem Politiker erklären, das sind die Herausforderungen, vor denen wir stehen, sagen, das sind die Wege, wie wir sie bewältigen können, das sind die Wege, für die ich mich aufgrund meiner Vorkenntnisse entscheiden würde. Stattdessen lautet die Botschaft: „Es ist alles gut und es wird sich nichts für Sie verändern.“ Wir werden alle versuchen, einen nahtlosen Service zu leisten.
Wenn der nicht mehr gewährleistet ist, beschweren wir uns beim Manager. Dann werden Wähler:innen auch sehr wütend. Wir sehen das an den Bauernprotesten: „Wie könnt ihr es wagen, uns so etwas zuzumuten?“ Und Politik rudert zurück: „Nein, wir wollten euch nichts zumuten! Das war nicht unser Ziel!“
Natürlich ist es Ziel der Politik, Menschen etwas zuzumuten. Wir wollen organisieren, wie wir zusammenleben. Dazu müssen wir Entscheidungen treffen. Manche profitieren von diesen Entscheidungen, andere haben Einbußen. Dann ist es Aufgabe der Politik, Einbußen zu erklären, weil man sonst auf längere Sicht mehr verliert. Es ist Aufgabe der Politik, den Bauern zu erklären, dass Klimaschutz in erster Linie gut für die Bauern ist.
Norbert Reichel: Und dass das nichts damit zu tun hat, ob Diesel ein paar Cent teurer oder billiger ist. Dass es viele andere Faktoren gibt, die eine Rolle spielen. Es gab ja die Borchert-Kommission, die viel Vernünftiges aufgeschrieben hat, das aber kaum in der Öffentlichkeit diskutiert wurde.
Marina Weisband: Absolut richtig. Und das findet in der politischen Kommunikation nicht statt, weil wir eine Politik haben, die Angst davor hat, den Kund:innen etwas zuzumuten. Aber man kann Kund:innen keine Komplexität erklären. Man muss aber Demokrat:innen Komplexität erklären.
Norbert Reichel: Aus Kund:innen Demokrat:innen machen – das wäre das Ziel. Aber was machen wir dann mit dem Bundeskanzler, meines Erachtens der Prototyp für das von Ihnen beschriebene Bild eines Politikers, der sich selbst als Manager und die Bevölkerung als Kunden versteht.
Marina Weisband: Er ist personell nicht geeignet, Bundeskanzler in einer Demokratie zu sein. Er erklärt nicht. Er saß auf einem Podium und sagte, wenn wir den Kohleausstieg vorziehen, wer erklärt dann den Kohlearbeitern, dass sie dann keinen Job mehr haben? Ich saß da und dachte, du erklärst das, das ist deine Aufgabe. Aber das, was du machst, das ist Arbeitsverweigerung.
Norbert Reichel: Abgesehen davon fehlt ihm offenbar die Fantasie, Alternativen für die Arbeit der Menschen in der Kohleregion zu erarbeiten Timothy Garton Ash hat kürzlich in der New York Review of Books einen Artikel veröffentlicht, in dem er Olaf Scholz als Übergangskanzler bezeichnete und fragte: „Big Germany, What Now?“ Er zitierte auch Constanze Stelzenmüller, die einmal gesagt hatte, Deutschland habe die Energieversorgung an Russland, die Sicherheit an die USA und die Wirtschaft an China delegiert.
Marina Weisband: Ich will das nicht an ihm persönlich festmachen. Er ist ja nicht der Einzige. Er ist Kanzler in einer langen Reihe von Kanzlern und einer Kanzlerin, die in erster Linie verwaltet haben. Wir haben ein politisches System, das auf Verwaltung aus ist, das an vielen Stellen keine Politik mehr macht.
Das hängt mit dieser Angst zusammen, nicht wiedergewählt zu werden, das hängt auch mit der medialen Vermittlung von Politik zusammen. Es ist nicht so, dass alle Politiker:innen dumm oder schlecht wären, im Gegenteil: wir sogar einige sehr gute Politiker:innen. Aber die werden abgestraft. Das liegt auch an unserem medialen System. Das ist aufgebaut wie ein Auto- oder ein Pferderennen, es gewinnt, wer als erster ins Ziel kommt, wer den besten Service erbringen kann. Diese Politik ist im Prinzip ein Handwerksbetrieb.
Politik der kleinen Dinge
Norbert Reichel: In Ihrem Buch nennen Sie eine Menge von Beispielen, wie man in einer Schule Demokratie gestalten kann. Sie beschreiben die Debatte um einen Gebetsraum. Die Schüler:innen stellen fest, dass auch Angehörige anderer Religionen einen solchen Raum wünschen, auch die Schüler:innen, die keiner Religion angehören. Es entstand ein Raum, in den alle sich zurückziehen konnten, um zu meditieren oder zu beten. Sie beschreiben die Klasse, in der über die Anschaffung eines Klassenhamsters diskutiert wurde. Als sich herausstellte, dass ein Kind auf Hamster allergisch reagiert, wurde auf die Anschaffung verzichtet, Minderheitenschutz par excellence. Beim Schulfrühstück wurde über die Zeiten debattiert. Ein hoch politisches Thema war und ist durchweg der Zustand der Schultoiletten. Inzwischen gibt es sogar eine Kampagne der German Toilet Organization: „Toiletten machen Schule“.
Marina Weisband: Das ist das Schöne. Politik beginnt lange bevor wir merken, dass es Politik ist. Es ist nicht nur so, dass alles, was in dem aula-Projekt geschah, politisch ist. Alles, was vorher geschah, war auch politisch. Es ist ja politisch, dass Kinder nicht entscheiden dürfen, wann sie lernen wollen, wann sie Hunger haben dürfen, wann sie auf die Toilette gehen können. Es ist politisch, dass sie nicht entscheiden können, wie ihr Raum aussieht, oder ob sie im Sitzen, Stehen oder Gehen lernen wollen. All das ist schon Politik. Aber wenn wir es gewohnt sind, merken wir es nicht.
Norbert Reichel: Alle zur selben Zeit im selben Raum mit der selben Methode.
Marina Weisband: Die preußische Schule wollten den perfekten Soldaten oder später den perfekten Fabrikarbeiter vorbereiten. Seitdem hat sich an Schule oberflächlich viel verändert, aber an dem Kern, an der Funktion von Schule wenig.
Meine radikale Frage: Was wäre, wenn es uns wirklich darauf ankäme, mündige Bürger:innen zu erlauben.
Norbert Reichel: Wir müssen sie erst einmal wollen.
Marina Weisband: Ich hoffe, dass ich in dem Buch auch darauf eingehe, warum man das will und wollen sollte. Denn Demokratie ist sichtbar in Gefahr. Darüber hinaus sind wir sichtbar in Gefahr, nicht mit der Komplexität unserer Welt zurechtzukommen. Sie nannten gerade das Beispiel des Gebetsraums. Verstehen Sie was dort passiert ist, wie dort der Frieden gesichert wurde? Diese Idee hätte sich nicht so weiterentwickelt, wenn nur gefragt worden wäre: Wollt ihr einen Gebetsraum für Muslime, ja oder nein? Diese Idee wäre auch nicht so weit gekommen, hätte man jemanden gewählt, der sich um die Sache kümmert. Diese Idee entstand nur, weil viele Beteiligte mit ihren unterschiedlichen Interessen und Anliegen direkt an Fragestellung und Lösung mitgewirkt haben. Das ist es, wie Demokratie in Zukunft sein muss.
Norbert Reichel: Man müsste sich also erst einmal Gedanken machen, was in einem Raum, in den Menschen sich zurückziehen können, geschehen könnte.
Marina Weisband: Richtig. Verschiedene Menschen werden verschiedene Antworten finden. Wenn Sie zum Beispiel mit einem Mann darüber sprechen, werden Sie zu völlig anderen Schlüssen kommen als wenn Sie mit einer Frau darüber sprechen. Frauen haben eine geschärftere Aufmerksamkeit dafür, wie sich einsame Räume, wie sich Macht missbrauchen lässt. Wir haben das bei der Entwicklung digitaler Tools, die immer noch vorwiegend in Männergruppen entwickelt werden. Da geht es um die Moderation von Plattformen, vom Teilen von Daten. Wenn Frauen sich beteiligen, sagen sie sofort: Das kann aber für Harassment genutzt werden. Das kann genutzt werden, dass mich jemand stalkt. Solche Gedanken haben Männer nur selten, weil sie viel weniger mit solchen Phänomenen zu tun haben.
Norbert Reichel: Auch das Elend der Entwicklung von KI. In dem Buch „Code & Vorurteil“, das von vier Kolleg:innen der Bildungsstätte Anne Frank im Verbrecher Verlag herausgegeben worden ist, gibt es eine Fülle von Beispielen. Eins davon: Eine etwa 40jährige Frau möchte im Internet etwas kaufen und auf Rechnung bezahlen. Sie durfte nicht, denn die KI geht davon aus, dass 40jährige Frauen geschieden und alleinerziehend sind, dass sie in prekären finanziellen Verhältnissen leben.
Marina Weisband: Wir packen unsere sozialen Vorurteile in Codes. Deshalb ist Code immer besser, je diverser die Teams sind, die sie entwickeln. Das gilt genauso für Gesetze. Man könnte auch sagen, Gesetze sind der Code der Gesellschaft. Minderheitenschutz, das Voraussehen von praktischen Problemen: Wenn ich eine Pflegereform mache und keine Pflegenden beteilige, werde ich im realen Ablauf Probleme kriegen. Ein Beispiel war auch die vorübergehende Senkung der Mehrwertsteuer. Da hat man offenbar nicht mit kleinen Betrieben gesprochen, die ihre gesamten Kassensysteme umprogrammieren mussten, und das nur für ein paar Monate und dann wieder zurück. Wir sehen, dass bei vielen Entscheidungen die Menschen, die essenziell wichtig wären, um diese Entscheidungen vorzubereiten und die Folgen abzuschätzen, nicht mit am Tisch sitzen.
Bei den Sanktionspaketen gegen Russland wurden keine russischen Oppositionellen gefragt. Das Ergebnis war, dass man Putin in die Hände gespielt hat, ohne es zu wollen und ohne es zu wissen. Aber das hätten Oppositionelle von Anfang benennen können, weil sie wissen, wie das Oligarchensystem von innen funktioniert.
Was in Schulen möglich ist, was nicht
Norbert Reichel: Wie konnte man im aula-Projekt solche Komplexitäten sichtbar machen?
Marina Weisband: Die größte Komplexität bietet das Umfeld Schule, in dem das Projekt stattfindet. Wir haben unglaublich viele Stakeholder und unheimlich enge Beschränkungen von außen. Das ist einmal das Schulgesetz, das sehr eng einschränkt, was Schüler:innen gestalten dürfen, was nicht. Wir haben ein sehr sehr enges Zeitkorsett, weil es so viel Curriculum gibt, das sich die jungen Leute in die Köpfe kloppen müssen, um es bei Prüfungen wiederzugeben und dann sofort wieder zu vergessen. Niemand hat etwas von diesen Prüfungen. Gleichzeitig beschränken sie alles, was man in Schule machen könnte. Wir haben kaum Zeit für Demokratiebildung, weil wir Fakten auswendig lernen müssen, um sie bei einer Prüfung wiederzugeben.
Die Komplexität liegt auch bei den Lehrer:innen, die ganz verschiedene Anliegen haben und beispielsweise oft glauben, für ihre Berufsausübung, dafür, dass sie den Kindern helfen können, im Vornhinein wissen müssen, was passiert. Alles muss berechenbar sein, weil sie glauben, dass sonst ein Chaos ausbricht, das negativ für alle Beteiligten ist.
Norbert Reichel: Lehrer:innen sind oft unsicher. Und wer unsicher wird, agiert oft dogmatisch.
Marina Weisband: Menschen, die unsicher sind, sind dogmatisch. Auf Lehrer:innen wirkt so viel Druck ein, von allen Seiten. Wir brauchen viel Fingerspitzengefühl, müssen viel zuhören, mit den einzelnen Leuten arbeiten. Das ist die Komplexität daran. Wir müssen gemeinsam hinterfragen, was ist eigentlich Autorität für uns? Heißt das, dass du alles vorher weißt, oder besteht deine Autorität vielleicht darin, dass du zeigst, wie du mit Nicht-Wissen umgehst. Denn das ist es, was du deinen Schüler:innen beibringen musst, dass sie im Modell lernen.
Norbert Reichel: Wir haben über Beispiele gesprochen, die das Zusammenleben in der Schule betreffen. Gibt es Beispiele, in denen über Inhalte und Methoden des Unterrichts beraten wurde?
Marina Weisband: Das gab es dort, wo das Curriculum Freiheiten ließ. Beispielsweise wenn es darum ging, welches Buch wir aus der Romantik lesen. Aber die Wahrheit ist, dass nicht einmal die Lehrer:innen bestimmen können, was im Unterricht unterrichtet wird. Das deutsche Schulsystem ist nicht danach ausgerichtet, dass Schüler:innen selbst bestimmen können, was sie lernen wollen, worauf sie neugierig sind, wofür sie diese Woche brennen. Oder auch nur, worauf sie sich vielleicht länger als 45 Minuten am Stück interessieren.
In einem Podcast habe ich eine Schulglocke mitgebracht als das erste Disziplinargeräusch, mit dem wir im Leben in Verbindung kommen, weil es meine Gedankengänge abreißt, weil es mich dazu zwingt, meine Tätigkeit zu einem vorgegebenen Zeitpunkt zu wechseln: Jetzt bist du nicht mehr neugierig auf Englisch, jetzt bist du neugierig auf Mathe! So funktionieren Menschen nicht. Da stoßen wir leider an Systemgrenzen, die zurzeit nur von Privatschulen gesprengt werden dürfen. Es wäre mein Ziel, dass auch Regelschulen die sehr sehr gut erprobten, seit Jahrzehnten psychologisch bekannten (sie betont die Worte sehr emphatisch, dehnt sie) Mechanismen und Freiheiten zu geben, die bisher nur Modellschulen haben. Aber ich glaube, das ist noch ein weiter Weg. Das ist auch eine andere Front, an der ich kämpfe. Das kann ich nicht über aula leisten, wir sind hier bei einer gesellschaftlichen Debatte.
Norbert Reichel: Das hat meines Erachtens auch wieder etwas mit der Konsummentalität zu tun, über die wir sprachen. Viele Eltern erwarten von der Schule, dass diese ihre Kinder so fördert, dass die ein Einser-Abitur erwerben und dann viel Geld verdienen. Schon bei der Einschulung fragen manche Eltern die Lehrer:innen, was sie tun müssten, damit ihr Kind die Gymnasialempfehlung erhält und ein tolles Abitur schafft.
Marina Weisband: Mit dem Phänomen habe ich sehr viel zu tun. An Gymnasien ist diese Einstellung sehr prävalent und sehr problematisch. Das liegt auch daran, wie Eltern erzogen worden sind oder teilweise auch an Systemzwängen. Sie wollen für ihre Kinder ein bequemes Leben in Freiheit. Freiheit ist bei uns aber so eng mit materiellem Wohlstand verknüpft, dass Eltern für ihre Kinder diesen materiellen Wohlstand wünschen. Der Weg dahin sieht dann so aus: Sei gut in der Schule, mach ein Einserabitur, studiere, habe einen guten Job. Dass diese Erzählung nicht mehr stimmt, steht auf einem völlig anderen Blatt.
Norbert Reichel: So plakatieren es auch die Parteien, jetzt kurz vor der Europawahl. Überall steht „Wohlstand“ drauf. Aber niemand definiert, was „Wohlstand“ ist.
Marina Weisband: Wir erleben, wie die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht. Es geht vielen dann nur noch darum, dass sie auf der richtigen Seite stehen.
„Das ewige Dennoch“ (Leo Baeck)
Norbert Reichel: Wenn wir uns die aktuellen Problemlagen – oder wie Politiker:innen gerne sagen: „Herausforderungen“ – anschauen, geht es ans Eingemachte. Die Klimakrise ist nur ein Punkt, aber sie bewirkt, dass Menschen in Ozeanien ihre Heimat verlieren werden, wenn der Meeresspiegel weiter so steigt. Wo sollen die Menschen dann hin?
Marina Weisband: Die Wahrheit ist, dass die Welt ganz anders aussehen wird als unsere heutige Welt. Ulrike Hermann hat diesen berühmten Satz von Maik Fisher zitiert, es sei inzwischen leichter, sich das Ende der Welt vorzustellen als das Ende des Kapitalismus. Die Wahrheit ist, dass Menschen spüren, dass wir an planetare, an logische Grenzen geraten. Ich glaube, das spüren alle Menschen, ich glaube, das spüren auch AfD-Wähler:innen. Das spürt das gesamte politische Spektrum. Es unterscheidet sich darin, wie man darauf reagieren will. Das meiste geschieht unbewusst. Viele Leute werden von ihrem eigenen Bewusstsein vor der Erkenntnis geschützt, dass Dinge sich verändern, dass sie große Angst davor haben, dass sie sich verändern.
Ich habe das Privileg einer Biographie, in der ich diese sehr radikalen Veränderungen mehrfach überlebt habe, in der meiner Familie auch historisch diese sehr radikalen Veränderungen überlebt hat. Ich weiß, dass das Leben danach weitergeht, dass es sogar besser werden kann, auch wenn die Veränderungen an sich katastrophal sind. Die meisten Menschen in Deutschland haben diese Erfahrung nie gemacht.
Eine katastrophale Veränderung stellen wir uns als Kollektiv als das Ende der Welt vor. Und dahin will gedanklich niemand. Deshalb verdrängen wir die Probleme, weil wir Angst vor Veränderungen haben und Angst davor haben, wo wir landen, wenn diese Veränderungen geschehen.
Norbert Reichel: Aber wie ließe sich erreichen, sodass eine Gesellschaft insgesamt zu dem Schluss kommt, ich nehme die Veränderungen, die diskutiert werden, positiv auf und versuche, die Veränderungen zu gestalten. Das geschieht ja im aula-Projekt in der Schulgemeinschaft. Wie lässt sich die Erfahrung aus dem schulischen aula-Projekt auf solche gesellschaftlichen Prozesse übertragen, die ja nun um ein Vielfaches komplexer sind als die einzelnen Prozesse in der Schule?
Marina Weisband: Bisher ist mein bester Ansatz ein schulisches Projekt, weil alle Menschen in die Schule gehen müssen. Schulpflicht finde ich selbst als Liberale gut. Aber diese Menschen werden erwachsen und sie werden die Gesellschaft bilden. Ich glaube, wir haben es nicht auf dem Schirm, dass 100 Prozent der zukünftigen Generationen Kinder sind. Kinder werden immer wie eine Minderheit behandelt, die nicht wirklich wichtig sind. Sie sind bestenfalls eine Randerscheinung. Aber alle Kinder gehen durch die Schule. Wenn ich die Schule verändere, verändere ich die Sozialisation der Kinder.
Was die Erwachsenen betrifft, kann ich nur aus der Geschichte lernen. C.G. Jung hat versucht, ein ganzes Volk zu therapieren. Er ist damit kläglich gescheitert. Ich kann kein ganzes Volk therapieren. Ich kann nicht mit einer ganzen Bevölkerung Resilienzübungen machen. Ich fürchte, es wird darauf hinauslaufen, dass die Menschen diese katastrophalen Erfahrungen machen werden und das werden wir.
Alles, was ich kann, ist durch die Republik zu touren und über Resilienz zu sprechen, über meine Erfahrungen zu sprechen. Etwas zu versichern, was viele Leute mir nicht glauben werden, weil sie es nicht erlebt haben. Aber sie werden es glauben, wenn sie es erlebt haben. Auch nach Katastrophen gibt es einen Tag. Es geht weiter.
Norbert Reichel: In dem „Day after“ steckt ein Weltuntergangsszenario, mit dem in Hollywood die Filmgesellschaften viel Geld verdienen.
Marina Weisband: Ganz ehrlich: Nach der Shoah haben Menschen Kinder bekommen, Lieder gesungen, waren glücklich. Meine Familie hat die Shoah überlebt.
Norbert Reichel: Andreas Nachama wies mich auf ein Wort von Leo Baeck hin: „Das ewige Dennoch“.
Marina Weisband: Für die, die überlebt haben, ging das Leben weiter. Ich sage nicht, dass das etwas Gutes ist. Ich spreche die katastrophalste aller Katastrophen in der Geschichte an. Die zukünftigen Veränderungen werden nicht so katastrophal sein wie die Shoah. Sie werden überlebbar sein. Vielleicht finden wir uns dabei glücklicher, wenn wir uns weniger Dinge leisten können, wenn wir uns mehr um die Familie kümmern können, im Kopf entspannter sind, nicht mehr im Dauerstress, immer erreichbar zu sein, ständig e-mails beantworten zu müssen. Vielleicht mag ich es, nicht ständig viel Geld zu verdienen, um mir den Mallorca-Urlaub leisten zu können, weil es vielleicht keine Flüge nach Mallorca mehr gibt. Vielleicht freut es mich.
Norbert Reichel: Auch manche Mallorquiner wird das vielleicht freuen.
Marina Weisband: Die Mallorquiner haben dann ganz andere Probleme. Wir sind nicht diejenigen, die am meisten unter den unmittelbaren Auswirkungen des Klimawandels leiden werden. Für viele Menschen wird es weit katastrophaler. Für uns ist realistisch, dass wir uns radikal weniger Dinge leisten können. Das wird aber etwas sehr Gutes für die Welt. Ich wage zu unterstellen, dass es etwas Gutes für uns ist.
Norbert Reichel: So plädieren auch Hedwig Richter und Bernd Ulrich in ihrem Buch.
Marina Weisband: Dafür plädiert Ulrike Hermann, dafür plädieren viele Leute, die Vordenker:innen sind, die aber damit auch viel Angst auslösen. Ich möchte mich nicht abfällig über Menschen äußern, die verunsichert sind, weil so viel Selbstwertgefühl mit materiellen Werten verknüpft ist. Wenn mein ganzes Leben so ausgesehen hat, dann habe ich Angst, diese Dinge zu verlieren, weil ich Angst habe, meinen Selbstwert zu verlieren. Das ist etwas, das wir Menschen mit drakonischen Kräften schützen.
Ich möchte mit Projekten wie aula, mit meinen Talks Menschen darauf vorbereiten, Trost ineinander zu finden, ihrer Selbstwirksamkeit, ihrem Humor, ihrer Kultur, weil ihnen das niemand wegnehmen kann.
Welche Ziele? Welche Vision?
Norbert Reichel: Manche üben sich vielleicht zu sehr in Selbstberuhigung, wozu meines Erachtens auch viele Politiker:innen, gerade auch der Bundeskanzler beitragen. Das zeigt sich exemplarisch bei der Frage der Unterstützung der Ukraine. Manche glauben, wenn ich keine Waffen liefere oder vielleicht nur die Hälfte, dann ist Putin nicht ganz so böse, dann wird er mich schon in Ruhe lassen. Politiker:innen wie Michael Roth, die einen realistischen Blick auf Putin haben, werden als „Kriegstreiber“ beschimpft und auf einem Parteitag mit höhnischen Gelächter abgestraft, meines Erachtens auch eine Variante von Täter-Opfer-Umkehr. Ich erlebe ständig, gerade in sozialdemokratischen oder in grünen Kreisen, dass so gedacht wird. Letztens sagte mir jemand, wenn ich in Frieden mit Putin leben kann, ist es gut. Egal wie.
Marina Weisband: Ein sehr großes „Wenn“! Das sehr viel Arbeit macht.
Norbert Reichel: Wie komme ich mit der deliberativen Methode, die Sie in aula erfolgreich erprobt haben, da weiter? Ich akzeptiere die Positionen anderer, andererseits verlange ich auch, dass die Position der Ukrainer:innen, Ihre und meine Position ernstgenommen werden. Das fehlt mir in solchen Debatten jedoch immer mehr. Wie kann aula hier helfen?
Marina Weisband: aula ist eine Methode für Menschen, die einander kennen, einen physischen Raum teilen, die viel Zeit miteinander verbringen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Es ist mir schon gelungen, Leute, die keine Waffen an die Ukraine liefern wollten, grundsätzlich von der Richtigkeit einer Unterstützung der Ukraine mit Waffenlieferungen zu überzeugen möchte. Aber das waren längere persönliche Gespräche, das funktioniert nicht auf der Ebene eines Parteitags. Da geht es nicht um Inhalte, da geht es um Macht, um Bestätigung. Ich glaube auch nicht, dass Michael Roth für seine Ansichten abgestraft wurde, ich glaube, dass er abgestraft wurde, weil er dem Kanzler widersprochen hatte.
Norbert Reichel: Vielleicht beides.
Marina Weisband: Vielleicht beides. Bei der SPD gibt es diese tiefliegende kognitive Verzerrung, was Putin betrifft. Aber wenn ich jemanden mit einer kognitiven Verzerrung konfrontieren will, muss dies im direkten Gespräch geschehen. Wenn ich die Zeit habe und das persönliche Verhältnis kann das gelingen. Deshalb beginnt deliberative Demokratie immer im Kleinen, sie vernetzt diese kleinen lokalen Zellen.
Das entspricht übrigens der anarchistischen Theorie. Wenn ich eine organisierte Gesellschaft ohne Macht haben will, ist sie immer in diesen kleinen persönlichen Zellen organisiert, weil ich auf dieser Ebene Menschen überzeugen kann, weil ich sie kenne. Wenn ich das auf das Parteiensystem übertrage, benötige ich Überzeugungsarbeit bei den Entscheider:innen, andererseits an den Stammtischen. Der Stammtisch ist in unserer Demokratie die Keimzelle der deliberativen Bewegung. Die Stammtische vernetzen sich in den Kreisverbänden, diese in den Landesverbänden, diese in den Bundesverbänden, und das landet dann auf dem Parteitag.
Ich glaube, das Parteiensystem ist veraltet. Wir brauchen eine neue Organisationsform. Jede Organisationsform einer deliberativen Demokratie, die wir finden, wird immer eine Vernetzung auf der Grundlage von privaten Gesprächen sein. Denn so funktionieren wir Menschen.
Norbert Reichel: Vielleicht sollten wir uns auch von der Vorstellung verabschieden, die Parteien, die sich in einer Regierung zusammenfinden, dürften sich nicht streiten.
Marina Weisband: Ich bin skeptisch. Ich glaube, wir haben gar nicht die Vorstellung, dass eine Regierung sich einig sein muss. Wir haben zurzeit das Gegenteil. Wir haben eine offen zerstrittene Regierung, die auch keinen Hehl daraus macht, durchaus vergleichbar mit Israel. Aber wir haben ein Verkehrs- und ein Finanzministerium, die in ihrem Menschenbild etwas anderes vertreten als das Wirtschafsministerium. Oder die Zielsetzung des Außenministeriums ist so gravierend anders als die des Bundeskanzlers. Wir haben etwas, das eine Entität sein sollte, eine Regierung, die Ziele setzt und umsetzt, bei der aber die rechte und die linke Hand nicht nur verschiedene Dinge tun, sondern aktiv ins Kämpfen geraten. Ich frage mich schon, ob ich damit Probleme lösen kann. Ich mag auch nicht, dass eine Regierung in sich kämpft. Wir brauchen Entscheidungen, und keine Entscheidung ist schlimmer als eine falsche Entscheidung.
Die FDP macht eine völlig andere Politik als die Grünen, für völlig andere Wähler:innen als die Grünen. Wenn ich eine Regierung habe, die ressortübergreifend komplexe Probleme lösen muss, kann ich nicht zwei grundlegend verschiedene Ziele haben, auf die sie hinwirkt. Die einen sagen, wir müssen arme Familien schützen und fördern, die anderen sagen, wir müssen den Sozialstaat abbauen. Und beide brettern nach vorne. Das ergibt eine Nullpolitik. Und das haben wir zurzeit.
Norbert Reichel: Wie kommen wir da raus?
Marina Weisband: Das Problem liegt darin, dass wir keine Vision haben. Wir haben keine Ziele, auf die wir hinarbeiten. Deshalb können Wähler:innen auch keine Partei für ihre Ziele wählen. Ich weiß, welche Partei ich wähle, aber ich habe es satt, heftige Bauchschmerzen zu haben, wenn ich eine Partei wähle. Ich möchte eine Partei wählen, die auf eine Zukunft hinarbeitet, die ich wirklich teile, eine Partei, die dafür eintritt, das zu tun, worauf es wirklich ankommt, und nicht eine Partei, die nur antritt, um regieren zu können.
Norbert Reichel: Ich hatte vor einer Wahl noch nie so heftige Bauchschmerzen wie vor der Europawahl.
Marina Weisband: Ich glaube, so geht es uns allen. Ich glaube, sogar viele AfD-Wähler:innen wählen die Partei nicht ohne Bauchschmerzen. Ich sage das ohne jedes Verständnis für AfD-Wähler:innen. Das ist hoch gefährlich, was diese Partei tut. Aber ich glaube, dass wir in Wirklichkeit gar nicht so verschieden sind, dass wir nur verschiedene Schlüsse ziehen. Die Unsicherheit, dass wir keine Politik haben, die eine Vision für Morgen hat, teilen wir alle.
Norbert Reichel: Wäre Gerechtigkeit ein Begriff, auf den man sich einigen könnte? Ich frage mich beispielsweise, wie kann es sein, dass auch Menschen, die mehr als 200.000 EUR im Jahr verdienen, einen Inflationsausgleich und Zuschüsse zu den gestiegenen Energiepreisen erhalten.
Marina Weisband: Da werden Ihnen alle widersprechen, die mehr als 200.000 EUR verdienen und die sind rund um den Bundestag gut vernetzt. Gerechtigkeit begreifen die Leute immer so, dass sie mehr bekommen als sie zurzeit haben. Ich glaube aber, dass die Bevölkerung weiter ist als die Politik.
Diskursverschiebungen
Norbert Reichel: Die Grünen hatten vor der letzten Bundestagswahl das Motto „Bereit, weil ihr es seid“. Ich hatte den Eindruck, es gab damals einen Moment, in dem das wirklich stimmte. Viel wäre möglich gewesen, auch wenn es hätte Einschränkungen geben müssen.
Marina Weisband: Ich habe den Eindruck, ein Teil der Bevölkerung war so weit, aber dann waren es die Grünen nicht mehr. Aus Angst vor dem anderen Teil der Bevölkerung? Aus Angst vor den politischen Konsequenzen? Manche glauben, wenn ich Gegenwind bekomme, müsste ich weniger entschlossen auftreten. Aber die Wahrheit ist, dass die Leute, die den Gegenwind merken, dass ich unsicher bin, dass ich nicht an meine eigene Lösung glaube. Ich glaube, je stärker ich vertrete, dass ich wirklich an meine Lösung glaube, dass der Weg, den ich eingeschlagen habe, der richtige ist, umso weniger Gegenwind bekomme ich. Das stellen die Grünen falsch an, das stellt die Regierung falsch an, das stellen fast sämtliche Politiker:innen in der Öffentlichkeit falsch an, vielleicht mit Ausnahme der AfD, aber das ist eine andere Geschichte.
Je radikaler ich selbst werde, im besten Sinne radikal, je problemorientierter, komplexitätsoffener, ehrlicher ich selbst bin, desto überzeugender bin ich.
Norbert Reichel: Den Kontext mit der AfD habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
Marina Weisband: Die AfD macht sich radikal. Und je radikaler sie wird, desto schwächer werden die anderen, desto mehr Anhänger:innen gewinnt sie.
Norbert Reichel: Das ließe sich auch für das Bündnis Sahra Wagenknecht sagen.
Marina Weisband: Und die Grünen machen sich offensiv unradikal. Die Grünen sind peinlich kompromissbereit. Kompromiss nicht im guten Sinne, im Sinne des Zuhörens, sondern ich lasse mich von dir von meinen Zielen abbringen, weil ich vielleicht nicht ganz an meine Ziele glaube. Ich will nicht unterstellen, dass das so ist. Es ist vielleicht eine falsch verstandene Vernunft, eine falschverstandene Staatmännischkeit. Das Problem haben auch die amerikanischen Demokraten. Oh, wenn wir nicht auf die andere Seite zugehen, funktioniert die Politik nicht. Wir sind diejenigen, die für Einigkeit verantwortlich sind. Wir machen einen Schritt auf die Republikaner zu. Was machen die Republikaner? Sie machen einen weiteren Schritt von den Demokraten weg. Sie werden noch radikaler, und die Demokraten machen noch einen Schritt auf sie zu, und so verschiebt sich der gesamte politische Diskurs.
Norbert Reichel: Hase-Igel-Politik. Unsere Leser:innen werden manch weiteres Beispiel finden.
Marina Weisband: Und deshalb werbe ich dafür, radikal zu sein. Deshalb werbe ich dafür, wirklich daran zu glauben, dass wir eine gerechte Gesellschaft brauchen. Deshalb werbe ich dafür, wirklich daran zu glauben, dass Kinder buchstäblich die Zukunft sind und dass sie ein so unfassbar wichtiger Teil unserer Gesellschaft sind. Ich bin radikal in dieser Überzeugung. Ich lasse mich nicht überzeugen, dass das nicht so sei.
Norbert Reichel: Brauchen wir eine anti-kapitalistische Politik?
Marina Weisband: In der Antikapitalismus-Debatte steht für mich die sehr sehr große Frage nach dem grünen Wachstum im Vordergrund. Ich bin skeptisch, ob es das gibt. Aber wenn es das grüne Wachstum gäbe, bräuchten wir keinen Antikapitalismus, wenn nicht ja. Aber das ist nicht mein Ansatz, weil in den Begriff des Antikapitalismus viel hineininterpretiert wird. Mein Ansatz als Psychologin wäre, dass wir viel mehr auf das setzen müssen, was uns gesund macht: zwischenmenschliche Beziehungen, Gespräche, die Klärung unserer ehrlichen Bedürfnisse und den politischen Diskurs darüber, wie diese Bedürfnisse erfüllt werden können.
Vielleicht doch eine Vision?
Norbert Reichel: Degrowth?
Marina Weisband: Die Wahrheit ist, Degrowth ist mit Kapitalismus nicht vereinbar. Das funktioniert ökonomisch nicht. Ja, ich möchte gerne weniger arbeiten, mir weniger leisten können, dafür aber Innenstädte haben, in denen ich mich frei bewegen kann ohne zu konsumieren, anderen Menschen begegne.
Norbert Reichel: Manche Innenstädte sind leer, weil es da nichts mehr zu konsumieren gibt.
Marina Weisband: Aber vielleicht brauche ich diese Geschäfte alle gar nicht. Vielleicht stattdessen ein offenes Café, in das ich selbstgekochte Sachen mitbringen kann oder gemeinschaftlich mit anderen kochen kann. Ein Raum, in dem offene Gärten sind, die ich gemeinsam mit anderen pflegen kann. Oder einen Raum, wo Nähmaschinen sind, youtube-Studios, Bibliotheken, offene Volkshochschulen. Ich hätte so viele Ideen für leerstehende Gebäude. Wozu brauche ich die 70. Halskette, die nur produziert wird, um sie zu verkaufen? Ich brauche das alles nicht. Die wenigsten Menschen brauchen das. Es ist absolut schädlich, dass wir in dieses System gezwungen werden, in dieses Hamsterrad. Jede technische Erleichterung sorgt nur dafür, dass wir mehr Arbeit haben, weil wir dann eine e-mail schneller beantworten können. Also müssen wir mehr e-mails beantworten. Das wird mit KI noch viel viel schlimmer und wir werden nicht diejenigen sein, die davon profitieren. Diejenigen, denen die KI-Unternehmen gehören, werden davon profitieren.
Norbert Reichel: Milliardenschwere Leute.
Marina Weisband: Die Reichen werden reicher, die Armen ärmer. Den Reichen gehört der Raum. Es ist ja jetzt schon so: Wir haben keine offenen digitalen Räume, wir werden auch bald keine offenen physischen Räume mehr haben. In einer solchen Welt möchte ich nicht leben.
Norbert Reichel: Die ehemals kommunalen Grundstücke gehören in vielen Städten nicht mehr den Kommunen.
Marina Weisband: Das wird zunehmen. Ich kann mir aber eine Welt vorstellen, in der wir glücklich sind, weniger Zeit in Erwerbsarbeit investieren, mehr Zeit in Familie und Freundschaften, gesund kochen, Natur genießen, sein und leben. Wir haben nur dieses eine Leben und verbringen so viel Zeit in Büros, um nach Mallorca zu fliegen oder Uhren zu kaufen. Wir verlieren auf diesem Weg so viele Menschen, die das alles nicht können und die darunter extrem leiden. Ich weiß nicht, ob wir in der besten aller Welten leben und ob Veränderung wirklich so schlimm wäre.
Norbert Reichel: In der besten aller Welten sicher nicht. Aber wir müssen sie auch nicht abreißen und niederbrennen. Das aber ist bei Rechtsextremisten der Punkt.
Marina Weisband: Ja, wir müssen die Welt nicht abreißen. Ich glaube, das ist die beste Nachricht. Wir wären schon mit kleinen Veränderungen weiter. Ich habe heute gepostet: Ich beantworte E-Mails wie Briefe. Eine E-Mail darf auch ein paar Tage liegen. Manche empfinden das vielleicht als unhöflich. Ein Brief bräuchte auch ein paar Tage und dann ein paar Tage für die Antwort. Ich lasse mir von Technik, die mir die Arbeit erleichtern soll, nicht vorschreiben, dass ich jetzt mehr Korrespondenz zu erledigen habe. Nur weil ich es kann. Das ist der Rebound-Effekt, der alles kaputt macht.
Norbert Reichel: Degrowth heißt auch sich mehr Zeit lassen.
Marina Weisband: Das betreibe ich radikal. Meine Krankheit hilft mir dabei, weil sie mich dazu zwingt. Aber das ist etwas, in dem ich viel radikaler geworden bin. ich bestehe auf meiner Zeit. Ich erinnere mich jeden Tag daran, dass ich nur ein Leben habe. Ich weiß, dass ich ziemlich privilegiert bin, dass in Unternehmen Menschen, die auf niedrigen Posten arbeiten, gezwungen werden, E-Mails schnell zu beantworten. Das geht nicht an sie, das geht an ihre Chefs. Denn wenn mein Chef entspannter ist, erhalten auch Mitarbeiter:innen mehr Zeit. Dann sehen wir, was Shareholder-Kapitalismus bedeutet. Das ist es, was alle antreibt, E-Mails schneller zu beantworten, um mehr Kapitalgewinne zu generieren. Für irgendjemanden, der nicht ich bin. Dagegen sollten wir aufbegehren. Wir sollten uns nicht gegenseitig sabotieren, indem wir sagen, ich bin aber schneller als der andere Mitarbeiter, stelle mich ein! Dieser Entwicklung sollten wir uns verweigern. Das ist keine Revolution, sondern ein Beharren darauf, dass wir unser Leben so leben wollen, wie wir es leben wollen.
Norbert Reichel: Manche tun das. Der Generation Z wird oft vorgeworfen, die jungen Leute wären nicht fleißig genug. Vielleicht kann man das auch anders herum sehen: Sie sind nicht mehr bereit, sich ausbeuten zu lassen. Oder in Variation von Kant: Nicht nur raus aus der „selbstverschuldeten Unmündigkeit“, sondern raus aus der selbstverschuldeten Sklaverei!
Marina Weisband: Kant wird viel zitiert. (lacht). Ich habe seine Schrift zur Zukunft der Pädagogik von 1803 gelesen und gedacht: Das ist die Schule der Zukunft! Er hat Prinzipien formuliert, von denen wir noch weit entfernt sind.
(Anmerkungen: Erstveröffentlichung im Juni 2024, Internetzugriffe zuletzt am 18. Juni 2024. Titelbild: © Stiftung SPI / Thomas Richert.)