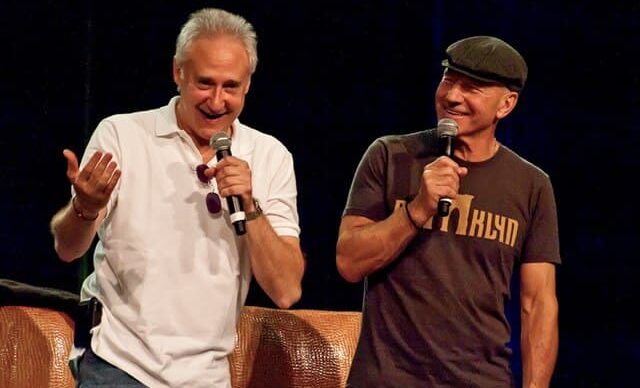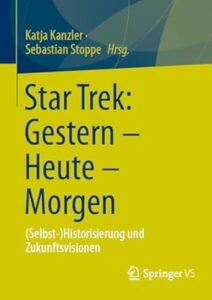Utopisch oder dystopisch? Realistisch!
Katja Kanzler und Sebastian Stoppe über Star Trek im 21. Jahrhundert
„Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden.“ (Arthur C. Clarke, Drittes Gesetz)
In der zweiten Episode der zweiten Staffel von „Discovery“ (DIS) mit dem Titel „The New Eden“ zitiert Commander Michael Burnham dieses Gesetz in einem Gespräch mit Captain Christopher Pike. Allerdings ist die Frage der Unterscheidbarkeit beziehungsweise der Nicht-Unterscheidbarkeit von Technologie und Magie auch eine Frage des Zeitpunktes. In „A Connecticut Yankee in King Arthur’s Court“ lässt Mark Twain die Hauptperson, Hank Morgan, eine Sonnenfinsternis vorhersagen. Natürlich ex eventu, für die Zeitgenossen im sechsten Jahrhundert scheint es jedoch Magie. Ähnlich ist es mit so mancher Innovation aus dem Star-Trek-Universum. Im vierten Star-Trek-Film, „The Voyage Home“ landet die Crew der Enterprise im 20. Jahrhundert. Scotty versucht wie gewohnt mit einem Computer zu sprechen. Es funktioniert natürlich nicht. Aber aus heutiger Sicht, in den 2020er Jahren, mit Siri und Alexa sieht das schon wieder anders aus.
Technologische Entwicklung ist die erste zentrale Voraussetzung der Funktionalität von Science Fiction. Die zweite ist die soziologische, politische und ethische Dimension. Dies gilt insbesondere für Star Trek, das von Beginn an ein ganz konkretes politisch-soziales Szenario möglicher Zukunft entwirft. Die Amerikanistin Katja Kanzler und der Politik- und Medienwissenschaftler Sebastian Stoppe haben sich mit diesen Kontexten bereits in ihren Dissertationen auseinandergesetzt, Katja Kanzler in „Infinite Diversity in Infinite Combinations“ (Heidelberg, Universitätsverlag Winter, 2004) im Kontext Race und Gender, Sebastian Stoppe in „Unterwegs zu neuen Welten – Star Trek als politische Utopie“ (Darmstadt, Büchner, 2014) in einem Vergleich von Star Trek mit Klassikern der utopischen Literatur (Thomas Morus, Campanella, Bacon). Gemeinsam haben sie 2024 den Sammelband „Star Trek: Gestern – Heute – Morgen – (Selbst-)Historisierung und Zukunftsvisionen“ (Wiesbaden, VS Springer) herausgegeben. In 13 Kapiteln debattieren 15 Autor:innen verschiedene Inhalte von Star Trek, Forschungen, Diversity, Zeitbezüge und Visionen, im Verhältnis von Utopie und Dystopie, Ethik und Recht und die Bedeutung des Fandom, das die Weiterentwicklung von Star Trek maßgeblich beeinflusst.
In ihrem Vorwort nennen Katja Kanzler und Sebastian Stoppe die zentrale Botschaft von Star Trek: „Leitbild des Franchises war dabei von Beginn der wohlwollende Ausblick auf eine bessere Zukunft der Menschheit.“ Diese humanistische Vision schließe an John F. Kennedys „New Frontier“ an, habe sich jedoch auch immer in dystopischen Szenarien bewähren müssen. Star Trek zeigt zum Beispiel den genialen und rücksichtslosen Khan Noonien Singh, mit den von ihm verursachten Eugenischen Kriegen, die in den 1990er Jahren stattgefunden haben sollen. Khan Noonien Singh steht in einer Reihe verschiedener Verkörperungen des Mad Scientist. Prototyp sind die verschiedenen Generationen von Doctor Soong, die alle von Brent Spiner gespielt werden, der auch Soongs Geschöpfe Data, Lore und B4 spielte. Doctor Soong erscheint als Doctor Arik Soong in „Enterprise“ (ENT, in: „The Augments“) und in der ersten Staffel von „Picard“ (PIC), über Noonien Singhs Tochter La’an Noonien Singh als Sicherheitsoffizierin der Enterprise in „Strange New Worlds“ (SNW).
Katja Kanzler und Sebastian Stoppe betonen, dass Star Trek eine eigene Geschichtsschreibung geschaffen hat, die sich auch in den verschiedenen Darstellungen der Timelines von Star Trek in den diversen Internetforen spiegelt. Das Thema der „Selbsthistorisierung“ und des „Fortschrittsglaubens“ durchzieht auch die Beiträge des Sammelbandes, beispielsweise den Beitrag von Christian E.W. Kremser. „Unentwegt kämpfen die Serienprotagonist:innen gegen die dunklen Seiten der Föderation und verteidigen ihr Verständnis von dessen Vision. Während also in TNG die ‚Utopie‘ noch als Selbstverständlichkeit präsentiert wird, muss sie in DS9 immer wieder gegen (innere und äußere) Feinde verteidigt werden.“ Aber was bedeutet dies in „Zeiten multipler Krisen, wie wir sie gerade erleben“? Solche Krisen und Konflikte erleben wir auch in Star Trek. Christian E.W. Kremser zitiert Benjamin Sisko: „Well, it’s easy to be a saint in paradise, but the Maquis do not live in paradise.” („The Maquis II”). Der Dominion War stellt alles in Frage, wofür die Föderation meint zu stehen: „Angesichts des Krieges müssen nämlich unentwegt Entscheidungen getroffen werden, welche die Angehörigen der Föderation vor eine moralische Zerreißprobe stellen.“ Ähnliche Konflikte sehen wir beispielsweise in der dritten Staffel von ENT, ständig in VOY, in PIC. Insofern dürfte die Frage des Verhältnisses von Utopie und Dystopie eine zentrale Frage in Star Trek geworden sein.
Wurde Star Trek dunkler, dystopischer?
Norbert Reichel: Sebastian, du hast in einer Fortschreibung deiner Dissertation ein Kapitel mit der These eingefügt, dass Star Trek mit DIS dunkler geworden sei. In eurem Sammelband sprach auch Thorsten Walch davon, dass Star Trek dystopischer werde. Bezogen auf die dritte Staffel von DIS spricht er von einer „dystopisch gewordenen Utopie“. Jan Siefert nannte seinen Beitrag ausdrücklich „Die dunkle Seite der Utopie“. Für die Crews sei es auch immer ein Thema, ihre eigenen dunklen Seiten zu überwinden. Möglicherweise habe Star Trek mit seiner Hinwendung zu Dystopien unter den Science-Fiction-Serien und -Filmen sogar sein „Alleinstellungsmerkmal verloren“.
Charakteristisch für Star Trek ist meines Erachtens jedoch auch, dass es immer wieder irgendeine rettende Lösung gibt. Gerade in DIS erleben wir, wie die Crew um Michael Burnham und schließlich die gesamte Föderation sich gegen genozidale Mächte wehren müssen. In der zweiten Staffel ist es zum Beispiel die aus dem Ruder gelaufene KI „Control“, in der vierten Staffel die von der Spezies 10C auf den Weg gebrachte Anomalie („DMA“). Michael Burnham muss sich gegen Tarka, ihren Lebensmenschen Booker und die Militärchefin der Föderation durchsetzen, die die DMA vernichten wollen. Sie glaubt, dass es eine diplomatische Lösung geben muss. Diese gelingt dann auch und es stellt sich heraus, dass Spezies 10C gar nicht wusste, was sie mit der DMA angerichtet hatte. Die Erde und Vulcan (inzwischen Ni’Var) werden gerettet. Die Gefahr entstand nicht durch militärische Bedrohung, sondern war ein Kollateralschäden einer Industriekultur, durchaus mit Anklängen an die Bedrohungen, die wir zurzeit für Klima und Artenvielfalt erleben. Ist Star Trek wirklich dunkler, dystopischer geworden oder wurden einfach nur die Zeiten dunkler, an denen sich die Drehbuchautor:innen dann orientieren?
Sebastian Stoppe: Ich glaube schon, dass Star Trek in der ersten und zweiten Staffel von DIS dunkler geworden ist. Abgesehen davon, dass viele Fans der Originalserie (TOS) und von „The Next Generation“ (TNG) zunächst mit der Erzählweise von DIS nicht zurechtkamen. Das hängt aber auch mit veränderten Sehgewohnheiten zusammen. Der Start von DIS ist 2017 in eine Zeit hineingekommen, in der wir die erste Präsidentschaft von Donald Trump erlebten, in der die Welt insgesamt düsterer geworden ist, gerade im Hinblick auf globale Ereignisse. Das hat sich in den ersten beiden Staffeln sehr stark niedergeschlagen, gerade in den sehr düsteren Schilderungen des klingonischen Krieges. Dann kam mit der Zeit aber wieder der bekannte Star-Trek-Moment, der Optimismus, der unbedingte Glaube, dass man die Welt besser machen will und kann. Das zeigt sich schon am Ende der ersten Staffel. Es gibt diesen Moment, als Michael Burnham bei der Ordensverleihung sagt, wofür die Föderation, wofür Star Trek eigentlich steht. Sie fasst dies in ganz wenigen Sätzen zusammen. Hier erscheint wieder dieser Optimismus, trotz aller Pessimismen, trotz aller düsteren Weltsichten, dass man den Glauben an ein gutes Ende niemals aufgeben darf.
Norbert Reichel: Diese negative Weltsicht begann ja schon in in der dritten Staffel von ENT. Die Crew unter Captain Jonathan Archer macht sich auf die Suche nach der Species der Xindi, die bereits eine Schneise der Verwüstung von Florida bis Venezuela verursacht haben und offensichtlich die Absicht haben, die gesamte Erde zu vernichten.
Sebastian Stoppe: Diese Staffel von ENT war stark durch die Ereignisse von 9/11 geprägt. Da fing diese düstere Weltsicht an. Wir finden sie allerdings auch in den Reboot-Filmen der alternativen Kelvin-Zeitlinie. Deren Sicht ist noch einmal deutlich militaristischer als in den vorangegangenen Serienformaten.
Katja Kanzler: Letztlich kann man bis zu „Deep Space Nine“ (DS9) zurückgehen, zum Dominion War. Ich wage jedoch auch die steile These, dass das Pendel jetzt schon wieder zurückschwingt. SNW bietet ein viel ausgewogeneres, gut austariertes Wechselspiel von Optimismus und Pessimismus, wenn wir es einmal so nennen wollen. Ich sehe bei Star Trek, aber auch bei anderen Science-Fiction-Serien die Anerkennung, dass die Probleme riesig geworden sind, wir aber vielleicht deshalb gerade jetzt Utopie brauchen, das, was Star Trek von Anfang an ausgemacht hat, die Frage, wie eine bessere Gesellschaft aussehen könnte. Ich bin zunächst einmal zuversichtlich und möchte die Augen aufhalten, wie weit das Pendel wieder in Richtung Utopie ausschlägt.
Norbert Reichel: Wir warten auf die dritte Staffel von SNW. Am Ende der zweiten Staffel hatten wir einen ungewöhnlichen Cliffhänger. Die Spezies der Gorn, die im Unterschied zu dem eher tapsig wirkenden Sauropsiden in TOS wie leibhaftige Höllenhunde aussehen, droht offenbar der Menschheit mit Vernichtung. Wir werden auch beobachten, ob und wenn ja wie sich die zweite Präsidentschaft von Donald Trump in Hollywood auswirkt. Aber gibt es Unterschiede zwischen Star Trek und anderen Serien?
Katja Kanzler: Ja und nein. Nein, weil ich glaube, dass sämtliche Populärkultur, wenn sie halbwegs relevant sein muss, sich der Welt um sie herum widmen muss. Ja, weil Star Trek sich von Anfang an ins Programm geschrieben hat, dass es die Welt kommentieren will. Schon in TOS hat sich Star Trek ein klares politisches Programm gegeben. Vor diesem Hintergrund ist auch unser neuer Band entstanden. Wir wollten uns anschauen, wie sich die neueren Star-Trek-Serien mit der eigenen Geschichte auseinandersetzen. Man sieht immer wieder, dass die neueren Produktionen zu der Frage zurückkommen, was es hier und jetzt bedeutet, ein populäres Produkt sein zu wollen, als Film wie als Fernsehserie.
Sebastian Stoppe: Das würde ich unterschreiben. Man findet immer wieder diese Rückbezüge. Stark ist es bei PIC ausgeprägt, noch viel mehr bei „Lower Decks“ (LD). Durchweg sehen wir einen Rückgriff auf die Ära von TNG. Im Grunde wird appelliert, auf die eigene Geschichte zu schauen und daraus abzuleiten, was man Besseres schaffen kann. In der ersten Staffel von PIC könnte man Picard als eine Art „grumpy old man“ sehen. Aber das wäre zu oberflächlich gedacht. Picard ist sehr vom Zustand der Föderation enttäuscht, bis zu dem Zeitpunkt, an dem er sagt, ich werfe alles hin, und das auch tut. Der konkrete Anlass ist die Geschichte um die Flüchtlinge von Romulus. Das reflektiert ja ein hochaktuelles Thema. Wir sehen es in Europa, in Deutschland, in den USA, gerade jetzt mit Trumps Vorgehen gegen illegale Immigration. Picard besinnt sich auf seine eigene Geschichte und sagt, er sei in der Sternenflotte für etwas anderes angetreten. Er fragt sich, wofür er und die Sternenflotte eigentlich stehen: Hatte ich nicht eine andere Idee? Ich möchte nicht, dass es so endet!
Star Trek hat einen riesigen Werkzeugkasten, eine riesige Palette, aus der sich die Drehbuchautoren bedienen können. Es ist möglich, für die Personen eine eigene Geschichte zu entwerfen und sie aus dieser Geschichte lernen zu lassen. Das war uns in unserem Buch auch so wichtig und es war spannend zu sehen, wie die Autorinnen und Autoren die Parallelität zwischen der Star-Trek-Erzählung und unserer realen Welt sehen.
Norbert Reichel: PIC ist ein gutes Beispiel. Es zeigt auch den Trend, die Gegner immer schlimmer darzustellen. Verhandlungen, wie sie in VOY Captain Janeway mit den Borg führte, sind in DIS und PIC nicht mehr möglich. Eine Steigerung ist auch das Bündnis der Borg Queen mit dem Dominion in PIC. Alles Böse der Galaxie verbindet sich. Interessant ist natürlich der Schluss der dritten Staffel, in der – gegen die ursprünglichen Absichten von Patrick Stewart, aber auf Betreiben der Produzenten – eine Reunion der Crew von TNG das gesamte Problem löst. Zumindest vorerst. Patrick Stewart deutete ja an, dass er einem eigenen Film zur Reihe nicht abgeneigt sei.
Sebastian Stoppe: Hier vermischen sich mehrere Dinge. Zum einen der Blick auf die eigene Geschichte, zum anderen hat man aus erzähltechnischer Sicht einige lose Enden wieder aufgenommen, zum Beispiel im Hinblick auf das Dominion die Frage, was eigentlich mit dem Virus passiert ist, mit dem Section 31 über Odo die Formwandler infiziert hatte. War die Heilung Odos mit seiner Rückkehr in den Great Link für alle nachhaltig wirksam? Was wurde eigentlich nach den Ereignissen in „The First Contact“ aus der Borg-Queen? Die Idee, die Crew von TNG zusammenzubringen, war gar nicht so schlecht, weil sich so aus der Sicht des Fandoms eine Art Lagerfeuermoment ergab. Mir ging es auch so. Ich saß bei den letzten Episoden da und dachte, so war das, als ich früher aus der Schule kam und mir Star Trek auf Sat1 angeschaut habe.
Norbert Reichel: Krieg und Frieden, Diplomatie, Künstliche Intelligenzen – das sind Themen im Kontext von Utopie und Dystopie. Ein anderer Aspekt dieses Kontextes sind Race und Gender. Dazu äußern sich in eurem Band ausführlich Roman Lietz und Natascha Strobl. Sie verbinden zwei Argumente. Das erste ist ein antikapitalistisches Argument. Auf der einen Seite ist „die originale Enterprise mit einer afroamerikanischen Frau (Uhura), einem Japaner (Sulu) und einem Russen (Chekov) als Führungspersonal visionär und utopisch“, auf der anderen Seite „band Roddenberry in seine Vision ein Element ein, welches möglicherweise der Hebel für dieses inklusive Paradigma ist: die Abschaffung des Kapitalismus“. Das zweite Argument ist die Frage nach der Externalisierung des Inhumanen: „Queerness und Race sind (…) in der Star Trek-Zukunft keine sozialen Konzepte mehr, nach denen Menschen kategorisiert werden.“ Das heiße jedoch nicht, dass diese Themen keine Rolle mehr spielen: „Gewissermaßen wird die Thematisierung von Rassismus von der Menschheit abgelenkt und findet stattdessen in den Diskursen rund um den Umgang mit anderen Spezies statt.“
Das ließe sich auch für das Thema Krieg und Frieden sagen. Für alle Episoden lässt sich eine logisch aufeinander aufbauende Zeitlinie beschreiben, zu der nicht nur die Einsicht der Menschheit, nach dem mörderischen Dritten Weltkrieg (2026-2053) in Frieden leben zu wollen, sowie die Gründung der Föderation im Jahr 2161 gehören, sondern auch die verschiedenen intergalaktischen Kriege, der Krieg mit den Klingonen, der Dominion War sowie die verschiedenen Formen asymmetrischer Kriege, zu denen die Auseinandersetzungen mit den Borg oder – in DIS – der Emerald Chain gehören. Imperialismus, Mafia, die Auffassung, man könne alle Probleme mit Gewalt lösen, wird durchweg auf extraterrestrische Spezies externalisiert.
Katja Kanzler: Das ist von Anfang an ein großes Thema bei Star Trek. Die in der TOS entworfene Vision war die einer gleichberechtigten und vielfältigen Gesellschaft. In den 1960er Jahren hatte man natürlich andere Vorstellungen davon als heute. Star Trek ist natürlich immer seiner Zeit verhaftet. Ich habe das Gefühl, dass die humanistische Perspektive und Vision immer noch auf der Agenda stehen. Bei DIS ist es zum Beispiel recht plakativ, aber ich finde es großartig, wie die Serie Seh- und Denkgewohnheiten neu justiert und scharfstellt, was es in der Vergangenheit von Star Trek gab, wer die Führungsfiguren waren. Mein Eindruck: In SNW ist es selbstverständlich, wie mit geschlechtlicher oder rassifizierter Vielfalt umgegangen wird. Ich bin gespannt, in welche Richtung sich das weiterentwickelt, auch angesichts der Verschiebungen in der öffentlichen Meinung in der US-Gesellschaft. Bleibt Star Trek sich selbst treu?
Künstliche Intelligenzen
Norbert Reichel: Ein interessanter Aspekt in DIS und in PIC ist das Thema KI. Das wurde zwar schon in früheren Episoden immer wieder thematisiert, nicht zuletzt bei der Figur des Data und seines bösen Alter Egos Lore. In DIS sehen wir die Konfrontation des Vernichters Control und der empathischen Zora, die sich beide aus der vom Computer der Discovery hochgeladenen Sphere entwickelt haben, auf die das Schiff in der zweiten Staffel trifft. Über die Reihenfolge ließe sich sagen: Zuerst der Schrecken, dann nach dem Sprung der Discovery in eine 900 Jahre entfernte Zukunft ein Segen für Crew und Föderation.
Eine menschliche Gestalt wie Data braucht Zora nicht mehr. Berührend ist die letzte Szene mit Zora in der fünften und letzten Staffel von DIS. Das Schiff wird in den Ruhestand geschickt. Burnham ist alleine auf der Brücke und unterhält sich mit Zora. Über Künstliche Intelligenzen hat in eurem Buch Jenny Joy Schumann geschrieben. Ich habe mit ihr darüber gesprochen, unter anderem auch über die Frage, wann eine Künstliche Intelligenz das Wahlrecht bekommen könnte oder ob ich als Mensch ihr so einfach den Strom abschalten darf.
Sebastian Stoppe: In Star Trek haben wir einen Kommentar auf alles, was Künstliche Intelligenz angeht, auf alle Befürchtungen, auf alle Hoffnungen. Interessanterweise doch ein wenig früher als ChatGPT, Deep Seek und andere Systeme Furore machten. Es ist das alte Science-Fiction-Thema, das uns jetzt auch in der Wirklichkeit beschäftigt: Was geschieht eigentlich, wenn Maschinen Herrschaft übernehmen wollen?
Wir haben Data, wir haben den Doctor als künstliche Lebensformen, künstliche Intelligenzen mit einer physischen Erscheinungsform, die es auch leichter machen, sich mit diesen Figuren zu identifizieren. Es ist eine Art von Aushandlung über Technologie beziehungsweise Künstlicher Intelligenz. Es kann sich in unterschiedliche Richtungen entwickeln, in Überwachung – wie auch bei Control – oder in „Minority Report“. Oder kann es auch in Erinnerung an die Robotergesetze von Isaac Asimov in die Richtung gehen, dass Künstliche Intelligenzen dem Menschen dienen? Aber können sie auch empathisch sein? Das verkörpert Zora.
In „Short Treks” gibt es die kurze Episode „Calypso“, nicht ohne Grund nach der Nymphe benannt, die Odysseus zehn Jahre auf ihrer Insel mehr oder weniger gefangen hält. Ein Mensch und Zora sind alleine auf der Station. Das ist das Schicksal von Zora, nachdem die Discovery außer Dienst gestellt worden ist. Zora verliebt sich. Es ist natürlich ausweglos. In der Episode „…But To Connect“ in DIS überlegt Zora in der Tat: Gebe ich eine Information weiter, könnte die vielleicht der Crew schaden? Das ist Asimov pur. Es ist aber auch ein interessantes Beispiel dafür, wie wir mit ChatGPT oder Deep Seek die Illusion bekommen, dass da am anderen Ende eine reale Person sitzt und mit uns redet.
Norbert Reichel: Diese Illusion haben wir schon mit Alexa und Siri. In „Big Bang Theory“ – die vier Nerds lieben Star Trek und mehrfach sehen wir dort Cameo-Auftritte der Star-Trek-Stars – gibt es die Episode „The Beta Test Initiation“, in der Raj sich in Siri verliebt, sie im Traum besucht und ihr Blumen ins Büro bringt.
Sebastian Stoppe: Man bekommt diese Illusion, auch wenn kein Körper dahinter ist. Sie wird noch stärker, wenn ich bei ChatGPT die Sprachausgabe verwende. Das ist das eine. Es ist aber auch wieder eine Beschäftigung mit der Geschichte von Star Trek selbst. Der Sprachcomputer bei TNG ist auch schon interaktiv. Da überholt sich die Geschichte selbst. Wir haben in der Realität inzwischen kleine Geräte auf dem Tisch, Notebooks, Tablets, Kommunikatoren, wir können mit unseren technischen Geräten reden. Nicht nur mit Befehlen, sondern wir können uns auch semantisch austauschen. Zora ist die Evolution des Bordcomputers.
Norbert Reichel: Da ist der Universalübersetzer möglicherweise nicht weit.
Sebastian Stoppe: Es gibt ja auch schon Physiker, die sich mit dem Warp-Antrieb auseinandergesetzt haben. Es gibt eben Wechselwirkungen. Man könnte sogar noch weiterdenken. Vielleicht lässt sich mit der Science Fiction darüber verhandeln, wie sich manche von Leuten wie Elon Musk blenden lassen. Da spielt das dritte Gesetz von Arthur C. Clarke wieder eine Rolle. Was ist „Technologie“? Was ist „Magie“? Wird da etwas als mögliche „Technologie“ verkauft, das eigentlich nur als „Magie“ vorstellbar ist? Die großen Zauberer, die großen Gott-Figuren, all das hat etwas sehr Gefährliches und ist meines Erachtens auch Teil des dunkleren, dystopischeren Star Trek.
Die Fans sind die Überlebensgarantie von Star Trek
Norbert Reichel: Gedreht wird im demokratischen Kalifornien, aber man weiß nie, wie Hollywood auf die verschiedenen Trump-Erlasse reagiert. In eurem Buch spielen auch Erzähltechniken, die Neuverhandlungen von Figuren, und das Fandom eine wichtige Rolle. Beim Thema Fandom denke ich immer an Siegfried Kracauer, der in seinem Caligari-Buch die These formulierte, dass es eine Wechselwirkung zwischen den von den Produzenten entworfenen Figuren und Handlungssträngen und dem Publikumsgeschmack gibt. Eigentlich ein klassisches Marktmodell. Bärbel Schomers nannte ihren Beitrag durchaus etwas provokativ „Die Geburt der Slashfiction aus dem Geist des Star Trek Universum“. Jannik Müller spielte auf den Unterhaltungsauftrag von Star Trek an: „Set phasers to fun“.
Sebastian Stoppe: Das war auch schon Thema in meiner Dissertation. Es ist die Theorie vom Textual Poaching, das ständige Rückspielen zwischen Produzent:innen, Autor:innen und Rezipient:innen. Wenn man so will ist das eine Art semantisches Dreieck. Wenn man sich die Geschichte der Distribution von Star Trek anschaut, sieht man, dass Star Trek zu Beginn kein großer Erfolg war. Fünf Staffeln waren geplant, es wurden nur drei. Es war ein Nischen-Publikum. Das hing sicherlich auch damit zusammen, dass Star Trek für die damalige Zeit gewagte politische Statements propagierte.
Durch die zahllosen Wiederholungen entstand dann aber ein Fandom, das sich untereinander austauschte. Es gab Petitionen, dass Star Trek wiederkommen sollte. TNG ist sehr stark unter dem Eindruck der Fans der TOS entstanden. Es gab in den 1970er Jahren eine Petition, die dazu führte, dass das erste Space Shuttle „Enterprise“ getauft wurde. Gene Roddenberry und Schauspieler:innen von Star Trek wurden zum ersten Start eingeladen, die Titelmusik wurde gespielt. Im Laufe der Zeit hat sich das verselbstständigt.
Ein gutes Beispiel ist LD. Darüber habe ich mit Sascha Kummer in unserem Band geschrieben, aber auch im Beitrag von Jannik Müller spielt diese Serie eine Rolle. LD zeigt das Fandom. Die Crew bewundert die Crew der TOS, von TNG. Sie sind eben nicht nur Crewmitglieder in der Zukunft, sondern auch selbst Fans. Das ist Inhalt der Crossover-Episode „Those Old Scientists“ in SNW, in der die Ensigns Boimler und Mariner aus LD durch ein Zeitportal auf der Enterprise von Christopher Pike landen. In der Bewunderung des Personals von TOS und TNG liegt auch der große Erfolg dieser Animationsserie. Es ist eine Serie der Fans, die schließlich ebenso wenig Held:innen sind wie das Personal von LD Sascha und ich haben dazu in unserem Beitrag „Hommage oder Parodie?“ geschrieben: „Grundsätzlich sind in Lower Decks allen Figuren eine große Kompetenz und großes Talent in ihrem Fachgebiet gemein, was aber durch ihre soziale Unbeholfenheit, übertriebenen Eifer oder andere Unsicherheiten kontrastiert wird.“ So sieht sich vielleicht auch mancher Fan selbst.
Norbert Reichel: Ihr erwähnt auch das Crossover „Trials and Tribble-Ations“ in DS9. Die Crew der Defiant landet durch eine Zeitanomalie auf einer Raumstation, auf der sich auch die Crew der Enterprise von Captain Kirk befindet. Es muss verhindert werden, dass ein als Mensch verkleideter Klingone die Zeitlinie verändert. Das gelingt, doch am Schluss kann sich Benjamin Sisko nicht zurückhalten und gesteht Captain Kirk seine persönliche Bewunderung. Eine Fan-Figur ist meines Erachtens in gewisser Weise auch Reginald Barclay, in all seiner Genialität, Unbeholfenheit und Ergebenheit. In TNG gibt es die Episode „Hollow Pursuits“, die das Verhältnis zwischen Barclay, dem Fan, und Picard als Repräsentant des Franchise, umkehrt. Zunächst machen sich alle lustig über Barclay. Besonders pikant ist, dass der Teenager Wesley Crusher, selbst höchst genial und ebenso ein Bewunderer Picards und seiner Crew, Barclay den Spitznamen „Lieutenant Broccoli“ gibt. Doch dann hat Barclay den entscheidenden Einfall zur Lösung des anstehenden Problems. In VOY wird dieser Aspekt einer Fangeschichte noch einmal aufgenommen. Niemand nimmt Barclay ernst, er braucht die psychologische Unterstützung von Deanna Troi, aber letztlich schafft er es, den Kontakt zur Voyager herzustellen.
Sebastian Stoppe: Für Außenstehende sind diese Selbst-Referenzen kaum nachvollziehbar. Was in einzelnen Episoden von TNG, VOY, SNW oder DS9 geschieht, ist bei LD Programm. Das ist auch auf einer Metaebene interessant. In der genannten Episode von SNW wird ein Kreis geschlossen. Es heißt ja, man soll die Vergangenheit nicht verändern, die oberste temporale Direktive, weil man die Folgen nicht abschätzen kann. Aber natürlich beeinflussen die Leute aus der Zukunft die Leute aus der Vergangenheit, sodass ein Zirkelschluss entsteht und so entwickelt sich eine komplette Star-Trek-Geschichte so wie sie sich eben entwickelt. Das ist schon sehr klug gemacht.
Katja Kanzler: In LD werden die Fans als Verbündete gezeigt. Das zeigt auch, wie sich das Verhältnis zwischen den Inhaber:innen des Copyrights für Star Trek und den Fans mit der Zeit entwickelt hat. Es gibt eine viel stärkere Wertschätzung dessen, was die Fans sind. Die Fans sind eigentlich das, was Star Trek am Leben hält. Es ist eine Fortschreibung, aber es ist auch eine viel engere Beziehung zu den Fans geworden, die man gerade in den neueren Serien ganz direkt zeigt.
Selbstreflexive Erzähltechnik
Norbert Reichel: Daran lassen sich auch Gedanken zur Erzähltechnik anschließen: Im Grunde sind ENT, DIS und SNW Prequels. In DIS ist man aus dieser Prequel-Situation herausgekommen, indem man am Ende der zweiten Staffel das Schiff samt Crew mit der Ausnahme von Spock und Captain Pike 900 Jahre in die Zukunft schickt. Es wäre auch erzähltechnisch schwierig geworden, die Geschichte der Discovery, die zehn Jahre vor der Handlung der TOS spielt, angesichts des Sporenantriebs und so manch anderer technologischer Besonderheit mit der Geschichte der Original-Enterprise zu harmonisieren. Bei ENT war das schon einfacher. Das spielt immerhin 70 Jahre früher. Bei SNW verfolgen wir die Zeit von Captain Christopher Pike, der in TOS nur in der ersten Pilotfolge „The Cage“ vorkam. Dann wurden einige Personen ausgetauscht und es kam Captain James Tiberius Kirk, Spock wurde Erster Offizier, die bisherige erste Offizierin verschwand aus der Serie, weil den Produzenten eine Frau an solch hoher Stelle dann doch nicht passte. In SNW haben wir mit Una Chin-Riley wieder eine Frau als „Number One“.
In eurem Buch schreibt Andreas Rauscher in seinem Beitrag „All Our Yesterdays“, in SNW „geht es nicht mehr um Parodien und Travestien, sondern um eine Neuverhandlung bestehender Figurentypen und Handlungskonstellationen innerhalb einer transmedialen Storyworld.“ Ein gutes Beispiel ist die Darstellung des von Ethan Speck gespielten jungen Spock in SNW und in DIS, der seine menschliche Seite viel deutlicher zeigt als der von Leonard Nimoy gespielte Spock der TOS. Andreas Rauscher spricht auch über „selbstreflexive philosophische Positionen“, SNW setze „weitaus stärker als Discovery und Picard auf die Strategie des Cross-Overs“. Eine solche „Selbstreflexion“ haben Sascha Kummer und Sebastian in ihrem Beitrag für LD notiert.
Katja Kanzler: Wir haben in unserem Buch versucht abzuklopfen, wie sich die neueren Serien mit der eigenen Franchise-Geschichte auseinandersetzen. Spock ist natürlich eine außerordentlich ikonisch-kanonische Figur. Er ist ein Kristallisationspunkt für diese Auseinandersetzung. Gerade bei der Spock-Figur sieht man, dass sie sich mit jeder Neuauflage ein bisschen verändert, auch in den Rebootfilmen mit Zachary Quinto. Es ist aber keine Veränderung ins Blaue hinein, sondern immer ein Kommentar darauf, wie die Figur zuvor realisiert wurde, im Grunde auch ein Erzählmotor. Vieles in den neueren Serien funktioniert darüber, dass ältere Figuren aufgegriffen und neu gedacht werden.
Sebastian Stoppe: In Star Trek hat man natürlich den Luxus, biographische Lücken füllen zu können. Es bleiben eben immer Leerstellen. Spock ist ein schönes Beispiel. In Fankreisen wurde viel über eine Szene im Pilotfilm „The Cage“ diskutiert, in der Spock lacht. Warum lacht Spock? Der ist doch Vulkanier, der hat doch keine Emotionen! SNW und die zweite Staffel von DIS füllen diese Lücke. Aus der Sicht der Erzählperspektive der TOS ist es eigentlich ein Fehler, dass er damals lachte. Aber in „The Cage“ war der Charakter noch nicht komplett ausgearbeitet. Jahrzehnte später konnte man das aufgreifen und zeigen, dass und wie sich Spock zu der Persönlichkeit entwickelt hat, die wir dann in TOS sehen. Er hatte zum Beispiel eine Liaison mit Nurse Christine Chapel und wollte seine Emotionen, seine menschliche Seite erkunden. Das gibt die Chance, dass man diesem Charakter noch viel mehr Tiefe geben konnte. Als Ambassador Spock erleben wir dann schließlich auch den gealterten weisen Diplomaten und Politiker. Es ist nicht nur eine Beschäftigung mit der Seriengeschichte, sondern auch eine Beschäftigung mit der Geschichte einzelner Personen. Picard ist das andere Beispiel, wenn wir in PIC den gealterten Picard sehen. Und auch die gesamte Crew von TNG: Was ist aus denen allen geworden?
Man konnte auf diese Art und Weise auch zahlreiche Nebenfiguren einbauen, zum Beispiel Ro Laren, die so eine eigene Geschichte bekommt und eben nicht – wie in TNG – als – zumindest empfindet Picard das in diesem Augenblick so – als „Verräterin“ beim Maquis verschwindet. Sie kommt wieder, Picard ist wegen der Vorgeschichte misstrauisch, aber sie stellt sich als hilfreich heraus, opfert sich für die gute Sache. Oder Lieutenant Commander Elizabeth Shelby, die nur in zwei Borg-Folgen auftaucht, die damals schon zu Riker sagte, sie wolle Karriere machen und nicht immer nur die Erste Offizierin bleiben. Sie taucht auch in zahllosen nicht-kanonischen Romanen wieder als Figur auf. Am Ende gibt man ihr eine ganz offizielle Geschichte und sie erscheint in der Episode „An Embarrassement of Dooplers“ in SNW als Flottenkommandeurin. Sie hat Karriere gemacht.
All das macht die Sache so charmant. Man gibt den Hauptfiguren ein ganzes Leben. Man macht das gesamte Star-Trek-Universum auch dadurch glaubhafter, dass man auch Nebenfiguren eine eigene Geschichte gibt. Sie sind woanders hingegangen, haben dort Karriere gemacht und standen für die Ideale von Star Trek. Und wir erfahren davon.
Norbert Reichel: Die längsten Lebensgeschichten, immer wieder mit Rückblicken auf die Kindheit, haben wir bei Picard, Spock und Burnham. Alle sind für die jeweiligen Problemlösungen zentral, aber bei allen ist das menschliche Element entscheidend. Spock hat eben eine menschliche Mutter. Gibt es auch vergleichbare Figuren aus anderen Species? Vielleicht bei T’Pau, die in TOS als alte weise Frau und Führungspersönlichkeit erscheint, aber in der vierten Staffel von ENT – 70 Jahre vor TOS – eine Vorgeschichte als Widerstandskämpferin gegen ein autoritäres Regime auf Vulcan bekommt. Aber insgesamt habe ich eher den Eindruck einer menschlichen Dominanz.
Katja Kanzler: Ich würde sagen: Ja, es gibt eine menschliche Dominanz. Für ein Medienkulturprodukt, das sich an menschliche Rezipient:innen wendet, ist das auch nachvollziehbar. Aber das ist doch auch schon eine Setzung. Ich finde es vor dem Hintergrund interessanter, wie Star Trek in den neueren Szenen versucht, diesen Human Centrism etwas aufzubrechen und zu relativieren, auch bei Burnham oder bei Picard.
(Anmerkungen: Erstveröffentlichung im April 2025, Internetzugriffe zuletzt am 3. April 2025. Titelbild: Brent Spiner und Patrick Stewart, Foto: Beth Madison, Wikimedia Commons, Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.)