Ein kaum erschlossenes Thema
Neue Studien zu Antisemitismus und Shoah in Bildungsprozessen
„Ja, die Kontinuität zwischen dem deutschen Kaiserreich und den Nachkriegsjahren beruhte nicht in erster Linie auf dem Vorhandensein der alten Parteien und gesellschaftlichen Verbände, sondern vor allem auf dem Fortdauern der Kultur und ihres einheitlichen Vokabulars. Während die Nationalsozialisten die sog. ‚germanische Ideologie‘ revolutionierten, verwendeten sie weiter die alten Ausdrücke und Begriffe. Für sie war ‚Antisemitismus‘ ein Schlachtruf mit unmittelbaren Implikationen für das Handeln sowie ein Programm der Einschüchterung und Vernichtung. Für Millionen Deutsche aber und für die Mehrheit der deutschen Juden blieb ‚Antisemitismus‘ ein kultureller Code. Sie wiegten sich in der – wenngleich nicht mehr ganz unangefochtenen – Sicherheit, es mit einem vertrauten Bündel von Auffassungen und Einstellungen zu tun zu haben. Sie waren sich nicht bewusst, dass die Sprache sich verändert hatte und dass sie nicht mehr in der Lage waren, die Botschaft dieses neuen Antisemitismus zu entschlüsseln.“ (Shulamit Volkov, Antisemitismus als kultureller Code, in Leo Baeck Institute Yearbook XXIII, 1978, zitiert nach dem gleichnamigen erstmals 1990 im Verlag C.H. Beck erschienenen Sammelband mit zehn Essays der Autorin)
 Marina Chernivsky und Friederike Lorenz-Sinai sorgen schon längere Zeit gemeinsam im Kompetenzzentrum Prävention und Empowerment in Berlin für Acquise, Durchführung und Veröffentlichung von Forschungsprojekten zum Antisemitismus. Im Jahr 2022 veröffentlichten sie im Verlag Barbara Budrich den Band „Die Shoah in Bildung und Erziehung heute – Weitergaben und Wirkungen in Gegenwartsverhältnissen“. Gemeinsam mit 18 weiteren Autor*innen beschreiben sie in 16 Texten Wirkungen und Narrative der Shoah in Bildungsprozessen. Die Essays verbinden Biografieforschung und Pädagogik, sie verweisen darauf, dass man bei Bildungsprozessen nicht nur an Schule und Hochschule denken dürfe, sondern auch an andere Orte der Bildung, beispielsweise an Ausbildungseinrichtungen für Polizei, Justiz, Verwaltung. Formelle und nicht-formelle Bildungseinrichtungen werden gleichermaßen angesprochen, auch informelle Bildungsprozesse, die mitunter das in formellen Einrichtungen Angebotene und Gelernte konterkarieren. Dies wird beispielsweise in dem Titel des Beitrags von Friederike Lorenz-Sinai deutlich: „Gefühlserbschaften und Narrative von Lehrer*innen zur Shoah“. Der von Shulamit Volkov angesprochene „kulturelle Code“ wirkt nachhaltig, Bildung mag helfen, aber eine Garantie für den Erfolg selbst der besten Bildungsabsichten gibt es nicht.
Marina Chernivsky und Friederike Lorenz-Sinai sorgen schon längere Zeit gemeinsam im Kompetenzzentrum Prävention und Empowerment in Berlin für Acquise, Durchführung und Veröffentlichung von Forschungsprojekten zum Antisemitismus. Im Jahr 2022 veröffentlichten sie im Verlag Barbara Budrich den Band „Die Shoah in Bildung und Erziehung heute – Weitergaben und Wirkungen in Gegenwartsverhältnissen“. Gemeinsam mit 18 weiteren Autor*innen beschreiben sie in 16 Texten Wirkungen und Narrative der Shoah in Bildungsprozessen. Die Essays verbinden Biografieforschung und Pädagogik, sie verweisen darauf, dass man bei Bildungsprozessen nicht nur an Schule und Hochschule denken dürfe, sondern auch an andere Orte der Bildung, beispielsweise an Ausbildungseinrichtungen für Polizei, Justiz, Verwaltung. Formelle und nicht-formelle Bildungseinrichtungen werden gleichermaßen angesprochen, auch informelle Bildungsprozesse, die mitunter das in formellen Einrichtungen Angebotene und Gelernte konterkarieren. Dies wird beispielsweise in dem Titel des Beitrags von Friederike Lorenz-Sinai deutlich: „Gefühlserbschaften und Narrative von Lehrer*innen zur Shoah“. Der von Shulamit Volkov angesprochene „kulturelle Code“ wirkt nachhaltig, Bildung mag helfen, aber eine Garantie für den Erfolg selbst der besten Bildungsabsichten gibt es nicht.
Struktureller Antisemitismus
Am 17. November 2022 stellten die beiden Herausgeberinnen des Bandes in Berlin die Ergebnisse einer Studie mit dem Titel „Unbehagen an der Geschichte“ vor, die im Jahr 2023 in Buchform erscheinen wird. Sie hatten Mitarbeiter*innen in Gedenkstätten zu antisemitischen Vorfällen befragt. Durchgehendes Ergebnis: Bildungsprozesse schützen nicht vor Antisemitismus in der Mehrheitsgesellschaft, sie erlösen die Mehrheitsgesellschaft nicht. Dies stellt diese Bildungsprozesse nicht in Frage, wohl aber die Art und Weise, wie sie in der Gesellschaft und in der Politik bewertet und unterstützt werden. Berechtigt ist die Frage, unter welchen Bedingungen Bildungsprozesse zur Shoah dazu beitragen könnten, Antisemitismus zu erkennen und wirksam zu bekämpfen.
In dem Buch „Die Shoah in Bildung und Erziehung heute“ geht es um Fragen der „Gefühlserbschaften in Bildung und Gesellschaft“ (Marina Chernivsky), die „transgenerationale Weitergabe von Traumata“, die „Geschichte der Forschung über die Shoah“ (Angela Moré), die „Diversität von (Familien-)Narrativen in der postmigrantischen Gesellschaft“ (Thorsten Fehlberg, Swenja Granzow-Rauwald, Natascha Höhn, Oliver von Wrochem), Veränderungen in Judaistik und Jüdischen Studien nach 1990 (Dani Kranz und Sarah M. Ross) sowie die Thematisierung der Shoah an Hochschulen (Julia Bernstein), in der Ausbildung von Lehrer*innen (Friederike Lorenz-Sinai und Aysun Doğmuş), in den Erziehungswissenschaften (Astrid Messerschmidt), in Grundschulen (Romina Wiegemann) analysiert. Über „Nachwirkungen der Shoah in Liebesbeziehungen“ schreibt Ina Schaum, Florian Diddens bietet einen Forschungsbericht, Samuel Salzborn spricht im Sinne seines Buches „Kollektive Unschuld“ (2020 bei Hentrich & Hentrich erschienen) von einer „Dominanz der Schuldabwehr“ und benennt damit einen zentralen Aspekt des „strukturellen Antisemitismus“, Micha Brumlik befasst sich mit dem Thema „Postmemory und transgenerationales Trauma“. Der Band schließt mit einer Untersuchung von Sabine Andresen über Bezüge zur Aufarbeitung sexualisierter Gewalt.
Die am 17. November 2022 vorgestellte Gedenkstättenstudie gibt ebenso wie das hier vorgestellte Buch Gelegenheit, analog zum Begriff der „strukturellen Gewalt“ (Johan Galtung) über „strukturellen Antisemitismus“ nachzudenken. Besucher*innen von Gedenkstätten können diese durchaus beeindruckt, voller Empathie und mit dem besten Wissen, Willen und Gewissen verlassen und sind dennoch nicht in der Lage, „strukturellen Antisemitismus“ zu verstehen. Stattdessen wird Antisemitismus personalisiert, auf bestimmte Äußerungen und Handlungen einzelner Personen bezogen, jedoch nicht auf den gesellschaftlichen Grund und die lange Kulturgeschichte des Antisemitismus, wie sie in ebenfalls aus dem Jahr 2022 stammenden Büchern Monika Schwarz-Friesel und Shulamit Volkov beschrieben haben.
Der Begriff des „strukturellen Antisemitismus“ lässt sich durchaus mit dem von Shulamit Volkov geprägten Begriff des „kulturellen Codes“ erklären, dessen verbale Erscheinungsformen Monika Schwarz-Friesel oder auch Julia Bernstein in ihren Veröffentlichungen offenlegten. Antisemitismus ist ein Weltbild, gerade im Kontext der diversen Verschwörungserzählungen eine Weltanschauung mit quasi-religiösem Charakter, es ist die „Sache ohne Punkt“ oder wie Anna-Patrizia Kahn im Titel ihres 2007 in München bei Droemer erschienenen Buches formulierte: „Die Sache zwischen uns“, so etwas wie der Elefant im Raum.
Eine der von Marina Chernivsky und Friederike Lorenz-Sinai in den von ihnen besuchten Gedenkstätten interviewten Mitarbeiter*innen sagte, die Gedenkstätten wären eben keine „Impfstelle“ gegen Antisemitismus. Andere Mitarbeiter*innen sprachen von der Gedenkstätte als „Exkulpationsort“, der geradezu kathartisch von dem Leiden der Mehrheitsgesellschaft an dem ständigen Vorwurf, es gebe nach wie vor Antisemitismus, erlöse, oder als „historische Müllhalde“. Sie sehen sich vor der Aufgabe, „dass sie möglichst skandalfrei einen der größten Skandale, den es gibt, verwalten und händeln“ sollten, haben aber auch immer damit zu tun, dass die Shoah, die Konzentrationslager nur als Teil der jüdischen, nicht jedoch als Teil der deutschen Geschichte gesehen werden. Der psychologische Fachbegriff dazu wäre „Abspaltung“.
Eine Gratwanderung
Marina Chernivsky und Friederike Lorenz-Sinai benennen in ihrem Essay von „Die Shoah in Bildung und Erziehung heute“ schon im Titel dieses Hindernis, die Gedenkstätten würden – so ein*e Mitarbeiter*in – „irgendwie als jüdische Orte verstanden“. Sie warnen allerdings auch davor, die Problemlagen der Arbeit in den Gedenkstätten allein über „kollektivbiografische Dimensionen“ zu erklären. Sicherlich wurden die meisten Besucher*innen von Gedenkstätten „in ‚Erinnerungsmilieus‘ (…) sozialisiert, die einen sozialen und familienbiografischen Bezug zu der damaligen Täter*innengesellschaft haben. Gleichwohl lässt sich die deutsche Gesellschaft nicht als homogene Täter*innengesellschaft beschreiben. Eine solche Festschreibung hieße, die nationalsozialistische Volksgemeinschaftsideologie fortzuschreiben (…).“
Damit bringen die beiden Herausgeberinnen und Autorinnen die Sache auf den Punkt. Es ist eine Gratwanderung, die Anforderungen an die Mitarbeiter*innen in den Gedenkstätten sind enorm hoch. Möglicherweise aber sind diese aber auch einfach damit überfordert, die Erwartungen der Gesellschaft zu erfüllen, dass sich mit dem Besuch einer Gedenkstätte jeder Antisemitismus eliminieren ließe. Anders gesagt: die Gesellschaft darf sich nicht damit begnügen, die Erinnerung und Aufarbeitung der Shoah auf Gedenkstätten zu delegieren. Aysun Doğmuş resümiert, dass „es an erziehungswissenschaftlichen Überlegungen zur Shoah und dem Nationalsozialismus für den Professionalisierungsprozess fehlt.“
Die immer wieder – nicht nur vom Zentralrat der Juden in Deutschland – erhobene Forderung nach einer Verpflichtung von Schüler*innen, eine Gedenkstätte zu besuchen, wird damit nicht obsolet, im Gegenteil, es geht darum, dass das, was in der Gedenkstätte geschieht, von den Lehrkräften vor- und nachbereitet wird und dass sich in der Gesellschaft ein umfassenderes Bild der Shoah durchsetzt. Diese sind jedoch selbst oft viel zu unsicher, um diese Aufgabe zu erfüllen. Das Kompetenzzentrum hat in einer Studie mit Berliner Lehrer*innen deren Unsicherheiten beschrieben. Ich habe die Studie in dem Essay „Zeitlose Ignoranz“ vorgestellt. Weitere Studien zu anderen Bundesländern sind in Vorbereitung beziehungsweise in Planung, unter anderem in Sachsen und Sachsen-Anhalt. Es ist jedoch leider nicht einfach, Lehrkräfte zu finden, die bereit sind, über das Thema und damit auch über ihre Unsicherheiten zu sprechen.
Dani Kraz und Sarah M. Ross verweisen in ihrem Essay über „Jüdische Selbstermächtigung in der deutschen Wissenschaftslandschaft“ darauf, dass es letztlich in all diesen Fragen um „die Identität der Forschenden und Lehrenden selbst“ geht, „die sich in post-nationalsozialistischen, post-genozidalen Strukturen bewegen.“ Ein*e Interviewpartner*in sprach von einem „Aushandeln von Gefühlen der deutschen Gesellschaft in Form von Wissenschaft“. Möglicherweise lässt sich Antisemitismus nur wirksam bekämpfen, wenn neben den Fakten antisemitischer Sprache und Taten die Gefühle analysiert werden, die be- und verhindern, dass Antisemitismus als das erkannt und benannt wird, was es ist, in Abwandlung einer Formel von Gertrude Stein: Antisemitismus ist Antisemitismus ist Antisemitismus.
Trauma-Transfer und Rückdelegation
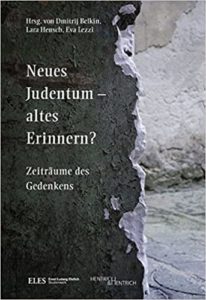 Micha Brumlik beruft sich auf den von Marianne Hirsch geprägten Begriff der „Postmemory“, der sich durchaus auch – zumindest in Teilen – als Trauma-Transfer beschreiben ließe. Dies legt der folgende Satz von Micha Brumlik nahe: „Unter Traumata werden von außen, also nicht innerpsychisch verursachte psychische Beeinträchtigungen verstanden, die mit den Mitteln der eigenen seelischen Anlagen nicht bewältigt, sondern allenfalls auf Zeit ruhiggestellt werden können und daher immer wieder – bei naheliegenden Assoziationen – ungewollt in der Erinnerung, im Erleben und im Verhalten auftauchen – und zwar so, dass sie mit dem üblichen Verhaltensrepertoire nicht unter Kontrolle gebracht werden können.“ Diese Gedanken hat Micha Brumlik auch in anderen Veröffentlichungen vorgestellt, so beispielsweise in dem von Dmitrij Belkin, Lara Hensch und Eva Lezzi herausgegebenen Band „Neues Judentum – altes Erinnern? Zeiträume des Gedenkens“ (Leipzig, Hentrich & Hentrich, 2017). Dieser Band richtete sich vornehmlich auch an die jüdische Gemeinschaft in Deutschland, in dem von Marina Chernivsky und Friederike Lorenz-Sinai herausgegebenen Band wird deutlich, dass dies ein Thema nicht nur für die jüdische Gemeinschaft ist, sondern dass sich auch und vielleicht ganz besonders die nicht-jüdische deutsche Mehrheitsgesellschaft damit auseinandersetzen sollte, migrantische Gemeinschaften darin eingeschlossen.
Micha Brumlik beruft sich auf den von Marianne Hirsch geprägten Begriff der „Postmemory“, der sich durchaus auch – zumindest in Teilen – als Trauma-Transfer beschreiben ließe. Dies legt der folgende Satz von Micha Brumlik nahe: „Unter Traumata werden von außen, also nicht innerpsychisch verursachte psychische Beeinträchtigungen verstanden, die mit den Mitteln der eigenen seelischen Anlagen nicht bewältigt, sondern allenfalls auf Zeit ruhiggestellt werden können und daher immer wieder – bei naheliegenden Assoziationen – ungewollt in der Erinnerung, im Erleben und im Verhalten auftauchen – und zwar so, dass sie mit dem üblichen Verhaltensrepertoire nicht unter Kontrolle gebracht werden können.“ Diese Gedanken hat Micha Brumlik auch in anderen Veröffentlichungen vorgestellt, so beispielsweise in dem von Dmitrij Belkin, Lara Hensch und Eva Lezzi herausgegebenen Band „Neues Judentum – altes Erinnern? Zeiträume des Gedenkens“ (Leipzig, Hentrich & Hentrich, 2017). Dieser Band richtete sich vornehmlich auch an die jüdische Gemeinschaft in Deutschland, in dem von Marina Chernivsky und Friederike Lorenz-Sinai herausgegebenen Band wird deutlich, dass dies ein Thema nicht nur für die jüdische Gemeinschaft ist, sondern dass sich auch und vielleicht ganz besonders die nicht-jüdische deutsche Mehrheitsgesellschaft damit auseinandersetzen sollte, migrantische Gemeinschaften darin eingeschlossen.
Monika Schwarz-Friesel und Shulamit Volkov verweisen in ihren Büchern, Vorträgen und Essays immer wieder auf die emotionale Seite beziehungsweise die Emotionalisierung hinter Antisemitismus. Eben dieser Gedanke wird auch in dem Begriff der „Gefühlserbschaften“ deutlich, den Marina Chernivsky und Friederike Lorenz-Sinai beide im Titel ihrer Essays verwenden. Sie schreiben in der von ihnen gemeinsam verfassten Einleitung: „So zeigen sich die Erinnerung an die nationalsozialistische Vergangenheit oftmals als ritualisierte Leerformel ohne Selbstbezug (vgl. Salzborn in diesem Band). Für Menschen, die von dieser Vergangenheit aufgrund der damals gegen sie oder ihre Gemeinschaft gerichteten Gewalt existenziell betroffen sind, stellt sich jedoch die Vergegenwärtigung der Geschichte als eine unfreiwillige Anforderung dar (vgl. Brumlik und Moré in diesem Band).“ Dies betrifft gleichermaßen die Kinder und Enkel*innen der Opfer wie die der Täter*innen.
Hilfreich wäre vielleicht auch ein Blick in die Displaced-Persons-Forschung, der ich einen eigenen Beitrag gewünscht hätte. Denn eine der Ursachen der Fortdauer des „strukturellen Antisemitismus“ sind nicht zuletzt Unwissenheit und Unsicherheit. Bösen Willen sollten wir niemandem a priori unterstellen, nur dort, wo wir ihn tatsächlich erkennen und belegen können. Die Frage extremistischer Störungen in Gedenkstätten wäre ein weiterer Punkt, der einer tieferen Analyse bedürfte. Die inzwischen in einigen Bundesländern eingerichteten Meldestellen für antisemitische Vorfälle sind nur so stark wie die Bereitschaft in der Gesellschaft, solche Fälle auch zu melden und in Polizei und Justiz, diese zu verfolgen. Auch dies lässt sich nicht erledigen, indem einfach nur auf die Betroffenen verwiesen, sozusagen rückdelegiert wird.
Bei manchen Historiker*innen und Soziolog*innen soll und könnte die Schuldabwehr – so Florian Diddens – durch „Selbstviktimisierung“ legitimiert und verschleiert werden. Marina Chernivsky stellt erheblichen Forschungsbedarf fest, zu oft würde Aufarbeitung, Erinnerung auf die Nachkommen der Opfer delegiert oder gegebenenfalls „weitgehend an Schulen und Gedenkstätten (…) und nicht als genuine Aufgabe von Eltern und Familien verstanden“, die – so wage ich zu ergänzen – wahrscheinlich überfordert wären und sich daher der Aufgabe durchaus verständlicherweise entziehen oder sich mit der ein oder anderen Fernsehserie zufriedengeben. Ein besonders schauriges Beispiel ist die Serie „Unsere Mütter, unsere Väter“, in der der Antisemitismus in der NS-Zeit auf einen Polen delegiert wurde, während die deutschen Hauptpersonen der Serie davon frei zu sein schienen. Marina Chernivsky schreibt: „Das Ergebnis sind bis heute die Distanz und die verkrampften Versuche der Pädagogik, das Unsagbare, das zwischen den Generationen liegt, rational und faktenfokussiert zu erklären und auf diese Weise Antisemitismus zu unterbinden (…).“
Darf man die Shoah Kindern zumuten?

Romina Wiegemann stellt allerdings auch die berechtigte Frage, ob – unabhängig vom Alter der Lernenden – „die historische-politische Bildung über die Shoah und den Nationalsozialismus (…) ein geeignetes Mittel sein“ könne, Antisemitismus zu bekämpfen. Ein solch pädagogischer Optimismus vergesse, dass „Antisemitismus nicht als vergangenes, sondern als gesamtgesellschaftliches Strukturprinzip der Gegenwart verstanden“ werden muss. Bildung gerät sich selbst überschätzend – so Romina Wiegemann – in eine Falle: „Wird hier (d.h. beim Thema „Wissen“ über Juden und Jüdinnen, NR) die Gelegenheit versäumt, Antisemitismus als kontinuierliches soziales und strukturelles Machtverhältnis zu kontextualisieren, fördert das die verbreitete Praxis, imaginierte Besonderheiten von Juden*Jüdinnen in den Mittelpunkt zu stellen und daraus scheinbare Kausalketten für die Entstehung und Ausübung antisemitischer Gewalt abzuleiten“. Romina Wiegemann bezieht sich auf Erkenntnisse der bereits genannten Studie des Kompetenzzentrums zum Antisemitismus an Berliner Schulen.
Damit schließt sich der Kreis. Man braucht schon eine verlässliche Strategie, um nicht im Meer der unverstandenen und dann auch nicht mehr verarbeitbaren Traumata zu versinken. Micha Brumlik zitiert Katja Petrowskaja (aus „Vielleicht Esther“, Berlin, Suhrkamp, 2014), die genau diese Frage stellt: „Manchmal hatte ich das Gefühl, ich bewege mich durch den Baumüll der Geschichte. Nicht nur meine Suche, sondern auch mein Leben wurde allmählich sinnlos. Ich wollte viel zu viele Tote ins Leben zurückrufen und hatte dafür keine durchdachte Strategie.“
Plädoyer für einen Strategiewechsel – schon in der Ausbildung

Letztlich wäre es wünschenswert, dass Lehrkräfte – und möglichst auch Journalist*innen und alle anderen, die beruflich mit Menschen zu tun haben – bereits in ihrer Ausbildung verpflichtende Anteile zum Themenkomplex Shoah und Antisemitismus absolvieren, zu dem auch das Thema des israelbezogenen Antisemitismus gehören muss. Es wäre gut, wenn sie in der Ausbildung Gedenkstätten besuchten und Gelegenheit erhielten, die Bedeutung der Shoah für die Generationen der Kinder und Enkel*innen zu reflektieren. Dazu gehört beispielsweise die Rezeption der von Marina Chernivsky und Friederike Lorenz-Sinai zitierten Forschungsergebnisse von Gabriele Rosenthal zum Trauma-Transfer sowie der von Micha Brumlik formulierten Hinweise zur Thematisierung von Trauma und posttraumatischer Belastung in der Literatur von Art Spiegelmans „Maus“ bis zu Katja Petrowskajas „Vielleicht Esther“. Pädagogische Psychologie ist durchaus Bestandteil der Ausbildung von Lehrer*innen, Erzieher*innen und anderen pädagogischen Berufen, doch stellt sich die Frage, ob das Thema von Traumatransfer und posttraumatischer Belastung auch dazu gehört? Nach meinen Erfahrungen eher nicht, obwohl dieses Thema nicht nur in Bezug auf die zweite und dritte Generation der Shoah, sondern auch auf all diejenigen von Belang ist, die in den letzten Jahren aus Kriegsgebieten in Deutschland eingewandert sind.
Ina Schaum bezieht sich in ihrem intersektionell inspirierten Beitrag auf Erfahrungen der Forschungen zu Feminismus und „Race“, konkret auf Shulamith Firestone und bell hooks. Titel ihres Essays: „Love Will Bring Us Together (Again)? Nachwirkungen der Shoah in Liebesbeziehungen“, das mag romantisch klingen, ist es jedoch ganz und gar nicht, es ist letztlich immer auch eine Frage der Macht und der damit verbundenen Gefühle: „Als Angehörige*r einer Minderheit, die als ‚anders‘ konstruiert wird, werden sie (d.i. Juden*Jüdinnen, NR) damit konfrontiert, dass ihre intimen Beziehungen in einem Machtkontext stattfinden, der die Vergangenheit gegenwärtig werden lassen kann und ihre Entscheidungen kollektive Resonanzen hervorrufen. Diese Situation betrifft die Mehrheit wie die Minderheit, die sich ko-konstituieren. Jedoch hat die Mehrheit die Möglichkeit, sich auf ihren universalen Standpunkt zurückzuziehen. Andererseits wird aber deutlich, worin Beziehungen von Juden*Jüdinnen auch ganz generisch sind: die Suche nach Liebe ist stets von Unsicherheiten und Verletzlichkeiten, manchmal auch von Ungleichheiten geprägt. / Insgesamt handelt es sich um ein kaum erschlossenes Thema (….).“
Norbert Reichel, Bonn
(Anmerkungen: Erstveröffentlichung im Dezember 2022, Internetzugriffe zuletzt am 22. November 2022, Das Titelbild zeigt ein Denkmal in Babyn Jar, Foto und Rechte: Katja Makhotina.)
